

(Paris quadrifolia)
DER KLEINE ZANKAPFEL
Wie vor Schreck erstarrt
stehst du da im Wald,
als Krone eine blaue Beere.
Mit dieser Signatur
wäre es ein Wunder,
wenn diese nicht giftig wäre.
WOLF-DIETER STORL
Trifft man unverhofft das allererste Mal auf diese kleine Waldpflanze, dann staunt man. Egal, ob zur Zeit ihrer Blüte im April oder Mai oder im Herbst, wenn sich aus dem oberständigen Fruchtkoten eine einzige erbsengroße, blauschwarze Beere entwickelt. Sie sieht so ungewöhnlich aus, dass es sich nur um eine Zauberpflanze handeln kann. Dass sie eine solche ist, hat man auch überall, wo sie wächst, in Europa und in Asien, geglaubt. Lediglich eine einzige Blüte bringt dieses ausdauernde, schattenliebende, höchstens zwei Spannen36 hohe Kräutlein hervor. Die Blüte ist grün und besteht aus vier kreisförmig angeordneten (radiärsymmetrischen) Blütenblättern. Über den vier großen, eiförmigen Stängelblättern, die ein Kreuz bilden, findet man vier Kelchblätter und vier Kronblätter, darüber wiederum acht Staubblätter, die den lilaschwarzen Fruchtknoten mit seinen vier roten Narben umstellen. Das Gebilde hat etwas erschreckend Starres an sich. Es schenkt den Kerbtierchen weder Nektar noch Duft; lediglich kleine Fliegen fressen an den Pollen und bestäuben die Blüte.
Einst rechnete man die Einbeere zu den Liliengewächsen, nun aber wird sie zu den Germergewächsen (Melanthiaceae) gezählt, zu denen auch der Schwarze und Weiße Germer sowie die Waldlilien (Trillium spp.) gehören.
Bei einer derartig starren, verkrampft rigide wirkenden Erscheinung könnte man vermuten, dass es sich um eine Giftpflanze handelt. So wenigstens würden es die anthroposophisch orientierten Botaniker sehen: Das Kosmisch-Astralische dringt zu tief in die Leiblichkeit der Pflanze ein und lässt sie sozusagen erstarren (Pelikan 1975 I: 153ff). Wie dem auch sei, die Einbeerpflanze, insbesondere die Beere, ist giftig. Sie enthält Steroidsaponine und Glykoside, die – wenn man sie in Mengen verzehrt – Brechreiz, Magenkrämpfe, Durchfall, Schwindel, Kopfschmerzen und eine Verengung der Pupillen hervorrufen können. Zum Glück werden die Giftstoffe vom menschlichen Körper sehr langsam absorbiert, also schlecht aufgenommen. Außerdem – wer würde sie schon essen, es sei denn, man hat sie versehentlich für eine Heidelbeere gehalten? Da sie wirklich schlecht (bitter) schmeckt –, im Gegensatz zur Tollkirsche, die lecker süß schmeckt – spuckt man sie aus und meidet sie fürderhin. Daher gibt es kaum Meldungen von Vergiftungen.


Ihres auffälligen Aussehens wegen hielt man die Einbeere früher für eine Zauberpflanze: Sie hat normalerweise vier, selten fünf Laubblätter und nur eine Blüte (links), die sich später im Jahr zu einer Beere entwickelt (rechts).
Die alten Botaniker des 16. Jahrhunderts kannten das ungewöhnliche Kräutlein unter dem Namen Herba Paris. Die wie auf dem Präsentierteller hervorgehobene, einzige und allein stehende Beere erinnerte diese klassisch gebildeten Doktoren an den sogenannten »Zankapfel«, den die Eris, Göttin der Zwietracht und des Streites, bei einem Götterfest unter die Gäste warf. Auf dem Apfel stand geschrieben: »der Schönsten«. Der trojanische Königssohn Paris sollte den Apfel der schönsten Göttin reichen. Er musste sich entscheiden, ob er den Apfel Athena, Göttin der Vernunft und Weisheit, Aphrodite, Göttin der Schönheit und der sinnlichen Liebe, oder Hera, der Schutzgöttin von Ehe und Geburt, geben sollte. Hera versprach Paris als Belohnung Wohlstand und Macht, Athena versprach ihm Weisheit und Herrlichkeit, aber Aphrodite versprach dem Jüngling die sinnliche Liebe der schönsten Frau der Welt, Helena. Deshalb wählte er Aphrodite und erhielt die bezaubernde Helena als Preis. So kam es, dass er diese Schöne entführte und in seine Heimatstadt Troja mitnahm, obwohl sie schon mit dem König von Sparta verheiratet war. Die geschassten Göttinnen Hera und Athena zürnten und zettelten daraufhin den Krieg an, der mit der Vernichtung Trojas endete.

Die Einbeere bildet im Mai oder Juni nur eine einzige, endständige Blüte mit vier grünen Blütenblättern an jedem Stängel und einem dunklen Fruchtknoten in der Mitte.
Linnaeus, der die wissenschaftliche Doppelbenennung der Pflanzen systematisierte, hat Paris als den Namen der Gattung beibehalten, und quadrifolia (lateinisch »vierblättrig«) als Name der Art hinzugefügt. Einige Sprachwissenschaftler lehnen diese eher romantische Erklärung ab und führen den Ursprung des Namens auf lateinisch par (= »gleich, regelmäßig«) zurück, was zu dieser Pflanze auch passen würde. Weitere Namen der Pflanze beziehen sich auf die vier kreuzförmig angeordneten Blätter: Vierblatt (niederländisch vierblad; englisch four-leaved gras), Kreuzkraut, Chrüzblatt (Nordschweiz), Sternkraut, (französisch herbe à la croix; italienisch erba crociona). Dass es sich um eine eher giftige Pflanze handelt, kommt in folgenden Benennungen zum Ausdruck: Teufelsbeere, Teufelsglotzen und englisch devil-in-a-bush. Giftpflanzen wurden in Nord- und Mitteleuropa oft dem bösen Wolf zugeordnet. Daher kommen mundartliche Benennungen wie Wolfstraube, Wolfsbeere, Wolfskirsche und, in der Eifel und in Luxemburg, Wolfsdüttl oder Wolfsdutt, wobei Dutt oder Dütt Beule, Auswuchs oder Brustwarze bedeutet. Auch anderen zwielichtigen Tieren wie dem Fuchs, dem Hund und der Schlange ordnete man die Einbeere zu: Fuchstraube, Fuchskirsche, französisch raisin de renard; italienisch uva di volpe; Hundskirsche, Hundsbeere; Schlangenkraut und, im Berndeutsch, Schlange-beri.

Die giftige Beere hielt man für Teufelswerk und benannte die Pflanze entsprechend abfällig als Teufelsbeere, Wolfstraube, Hundskirsche oder auch Pestbeere.
Ein im Mittelalter weitverbreiteter Name der Pflanze war Pestbeere. Man verglich die Beeren mit Pestbeulen. Zur Pestabwehr hängte man die Einbeere über die Tür, nähte sie in die Kleider oder steckte sie ans Kreuz im Herrgottswinkel. Es hieß, am besten tauche man die Beere vorher kurz in den Weihwasserbrunnen. Als Herrgottswinkel bezeichnete man übrigens die Nische in der Nordostecke der Stube, wo traditionell ein Kruzifix, die Statue der Muttergottes, Heiligenbilder und andere Devotionalien aufgestellt waren. In diese heilige Ecke stellte die Hausfrau auch ihre Medizinfläschchen und Kräuter, um sie mit göttlicher Segenskraft aufzuladen. Bei den Schwarzwälder Bauern ist es noch immer Brauch, die Heilkraft des Bärwurz- oder Blutwurzschnaps zu potenzieren, indem man ihn zu diesem kleinen Hausaltar stellt. Kulturanthropologen bezeichnen den Brauch, Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen oder abzuwehren – etwa Pestbeulen mit der dunklen Frucht der Einbeere – als »homöopathische Magie«.
Im Böhmerwald und anderswo sollten die Pestbeeren am Tag des heiligen Rochus (16. August) gesammelt werden. Dieser Pestheilige sei selber von der Pest befallen worden; er zog sich in den Wald zurück, wo ihn ein Engel pflegte und ein Hund ihm jeden Tag Brot brachte und ihm die Pestgeschwüre leckte, bis er genesen war. Mit der Corona-Pandemie blühte in Bayern sein Kult erneut auf.
Wie bei ihren heidnischen Vorfahren, sollte die Heilpflanze zuerst angesprochen und ihre Heilkraft geweckt werden, ehe man sie sammelt. Der überlieferte Spruch bei der Einbeere lautet:
...
Einbeere, wer hat dich gepflanzt?
Unsere Frau mit ihren fünf Fingern.
Durch all ihre Macht und Kraft
hat sie dich hierhergebracht,
dass ich werd‘ gesund.
...
Der ungewöhnlichen Waldpflanze traute man sogar noch mehr zu als den Schutz vor der Pest. So helfe sie auch, Menschen von Hexenzauber zu befreien. In Dr. Johann Schröders Werk (Trefflich versehene Medicin-Chymische Apotheke, 1685) lesen wir, die Beere »taugt denen, die durch Hexerei närrisch geworden sind«.
Im niederländischen Aberglauben gilt die Einbeere (Eenbes) als »Verirrkraut«, das heißt, wer darauf tritt, verliert seinen Weg, er verirrt sich.

In der Volksheilkunde wandte man die Einbeere bei Augenerkrankungen an, weil man in ihr die Signatur des Auges sah (Abbildung: Hieronymus Bock, 1546).
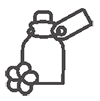
In früheren Zeiten wurde das zerquetschte Kraut der Einbeere äußerlich auf Wunden und Verletzungen aufgelegt. Der große Kräutermann Hieronymus Bock schreibt von der »Wolffsbeer«, dass sie »wie die kalten Nachtschattenkräuter äußerlich bei hitzigen Schäden aufgelegt« helfe; auch »das Kraut grün zerstossen / und Pflasters weiß auff die geschwollene Macht und heimliche Glider gelegt / ist ein Principal und fürtreffenliche Hülf / bei Hitz und Geschwulst derselben nider zu legen. Etliche meinen/ so man diß Kraut mit der linken Hand abbrech / und an die geschwollene Macht37 binde / es soll danach der Schmertzen gemildert und gewendet werden.«
Auch der astrologische Kräuterarzt Nicholas Culpeper verschreibt den Blätterbrei der Einbeere bei »schmutzigen« Geschwüren und Schwellungen der Leiste und der »privaten Körperteile« (privy parts). In Wein gekocht sei das Wurzelpulver gut gegen Kolik. Wie für andere seiner Zeitgenossen galt ihm die Einbeere als ein wirksames Gegengift (Antidotum) bei Vergiftungen. Die Pflanze – Culpeper nennt sie herb true-love – stehe unter der Herrschaft des Planeten Venus.
Manche gelehrten Ärzte der Renaissance sahen in der auffälligen Beere die Signatur des Auges und daher sei sie ein probates Augenmittel – sie wirkt ja auch pupillenverengend, wenn man sie einnimmt. Benennungen wie Augenkraut, Sauauge, Krähenauge oder Glotzbeere deuten diesen Zusammenhang an.
Bei Grippe, Erkältung und Gelenkrheumatismus, Neuralgien und starken Kopfschmerzen kannte die Volksmedizin einst einen stark verdünnten Tee des Krauts. Als »Schwarzblatternkraut« wurde es in Bayern und Schwaben gegen die »Blattern« (Ausschläge, Pusteln, Bläschen, auch Pocken) verwendet.
Heutzutage spielt die Einbeere in der Phytotherapie keine Rolle mehr. Allein in der Homöopathie findet sie in der Dosierung zwischen D3 bis D6 Anwendung bei neuralgischen Kopf- und Gesichtsschmerzen und bei erhöhtem Augeninnendruck.

(Aconitum napellus, A. lycoctonum)
EINE PFLANZE MIT KRIMINELLER VERGANGENHEIT
Dein Anblick, Eisenhut, beflügelt meine Fantasie …
Wie einst, als ich saß auf Großvaters Knie,
und lauschte voller Gruseln gespannt
Geschichten vom Zauberwald und Geisterland,
von Tarnkappen der Wichtel und verhüllten Leut‘,
vom Nachtgespenst, das Sonnenlicht scheut,
vom Giftmörder seiner Giftblum‘, von fiesen Verbrechen,
von Hexenmeistern und wie sie sich rächen.
Sturmhut, vor deiner kalten Wut sei man auf Hut!
WOLF-DIETER STORL
Der Eisenhut ist die giftigste Pflanze Europas überhaupt. Der tiefblau blühende Eisenhut wächst heutzutage vor allem in unseren Ziergärten, kommt aber auch in freier Natur vor, besonders in höheren Berglagen Eurasiens. Dem Gelben Eisenhut (A. lycoctonum) begegnet man in den lichten Laubwäldern des Mittelgebirges oder auch, wie bei uns im Allgäu, in den Voralpen. Eisenhut ist selten. Gott sei Dank! Denn so schön er ist, er ist wirklich hochtoxisch. Sein Hauptgift Akonitin ist stärker als Strychnin. Manchmal genügt das bloße Anfassen der Pflanze, und schon zeigen sich leichte Vergiftungserscheinungen – Kribbeln und Brennen der Haut und Taubheit der Finger. Das ist mir als Gärtner selbst passiert, als ich mal eine Staude umpflanzte und noch nicht wusste, dass das Akonitin sogar über die Haut resorbiert werden kann. Wenn man gar ein Blatt oder an der Wurzel kaut und etwas schluckt, dann kann man die Hölle erleben. Zu den Symptomen gehört das Absinken der Körpertemperatur – es ist, so sagten die alten Griechen »die Kälte des Hades (Totenwelt)«, die man spürt. Dabei erlebt man, wie sich die Seele vom Leib ablöst und schwebt – und dann, nach rund sechs Stunden, kommt es zu Herzversagen und Atemlähmung. Das Gift betäubt nicht, das Bewusstsein bleibt die ganze Zeit erhalten.
Einmal besuchte ich einen Freund, der in Graubünden auf einer hoch gelegenen Alp, auf über 2000 Metern, das Sommervieh hütete. Auf dem Weg sah ich eine noch nicht blühende Pflanze, deren Blätter mich an den Beifuß erinnerten. Wie ich es gewohnt war, pflückte ich ein Blättchen und wollte es kosten. Gerade als ich draufbiss, wurde mir klar, dass es eines der Grundblätter des Eisenhuts war! Ich spuckte es sofort aus und wusch meinen Mund an einer Viehtränke aus. Zum Glück hatte ich nichts geschluckt, dennoch merkte ich, dass meine Seele abhob und ich kaum an der Unterhaltung teilnehmen konnte. Nach einigen Stunden war ich, Gott sei Dank, wieder richtig da.
Der Eisenhut gehört zur Familie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae), jener Familie, die uns das Leberblümchen, das Scharbockskraut und auch die Waldrebe schenkt. Die ausdauernde Eisenhutstaude blüht von Juni bis August. Die Blüte ist, wie Botaniker sagen, dorsiventral oder zygomorph. Das heißt, sie ist nicht radiärsymmetrisch, wie etwa die Walderdbeere oder das Buschwindröschen, sondern hat spiegelgleiche Hälften, einen Bauch und einen Rücken, was sie tierähnlich macht, wie die Anthroposophen sagen.

Der Überlieferung zufolge wuchs der Eisenhut aus dem giftigen Geifer des Höllenhunds Zerberus, den Herakles auf die Erde gebracht hatte (Grafik, 1606).
Der Name Eisenhut oder auch Sturmhut rührt davon her, dass die Blüten an die Helme der Krieger im 16. und 17. Jahrhundert erinnern. Mönchskappe (englisch monk’s hood), Venuswagen und Teufelswurz sind weitere Benennungen. Der Name Wolfswurz erinnert daran, dass man Wölfe tötete, indem man die Wurzel in Fleisch wickelte und als Wolfsköder verwendete. Apollonienkraut hieß sie im Mittelalter, da man die Wurzel der Zahnpatronin, der heiligen Apollonia, weihte und damit Zahnschmerzen zu heilen versuchte. Das Martyrium der Heiligen hatte darin bestanden, dass ihr die Folterknechte bei lebendigem Leibe sämtliche Zähne herausbrachen. Es gilt ja die Regel: Das, was der oder die Heilige erlitt, das wird er oder sie auch heilen können.
In der klassischen Antike war die Giftwurzel wohl bekannt. Ovid schreibt, dass die gepulverte Wurzel von Stiefmüttern gerne als Gift verwendet wurde. Immer wieder wurden Herrscher und später Päpste mit Akonit gemeuchelt, da kein Gegengift bekannt war. Eines der berühmtesten Opfer war der römische Kaiser Claudius, den man im Jahr 54 n. u. Z. mit einem Pilzgericht aus dem Weg zu räumen suchte. Um ihm beim Erbrechen behilflich zu sein, kitzelte man seinen Schlund mit einer Adlerfeder. Diese aber hatten die Meuchelmörder mit Eisenhutgift (Akonitin) bestrichen. Es wirkte. Daraufhin bestieg Kaiser Nero den Thron. »Aconita trinkt man nicht aus irdenen Krügen. Denn nur der fürchte sie, der einen edelsteinbesetzten Becher zum Munde führt«, kommentierte dazu der römische Satiriker Juvenal.
In einem frühen wissenschaftlichen Experiment versuchte Kaiser Ferdinand II. ein Antidot zu dem Gift zu finden. Er und seine Gelehrten knöpften sich einen gefangenen Dieb vor und versprachen ihm seine Freiheit, wenn er das Wurzelpulver schlucken und daraufhin ein vielversprechendes Gegengift einnehmen würde. Leider ging das Experiment in die Hose, das arme Versuchskaninchen starb einen schrecklichen, qualvollen Tod. Der Botaniker Petrus Matthiolus (1501–1577), der Leibarzt Ferdinands, war bei dem Experiment anwesend. Er schreibt in seinem Kreuterbuch, »(das Opfer) verwandelt die Augen scheußlich, sperrete und zerrte das Maul, krümmt den Hals … nachdem erbrach er sich, und speiete viel stinkenden Wust und Gewässer aus von Farben gelb und bleich und schwarz … und darauf starb er.«
Wie das tödliche Toxin auf die Erde kam, erzählt die griechische Überlieferung: Der Held Herakles brachte den dreiköpfigen Höllenhund Zerberus, den Wächter des Totenreiches, herauf auf die Erdoberfläche. Das Untier schnappte um sich und sonderte giftigen Geifer ab, der sich in das Eisenhutkraut verwandelte.

Der Eisenhut wächst gern in höheren Berglagen und blüht wunderschön blau oder auch lichtgelb.

Die Laubblätter verraten die Verwandtschaftsverhältnisse: Der Eisenhut gehört zur Familie der Hahnenfußgewächse.
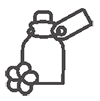
Von einer dermaßen giftigen Pflanze würde man keine Heilwirkung erwarten. Doch schon der große Mediziner und Philosoph Paracelsus (1493–1541) lehrte: »Alles ist Gift. Allein die Dosis macht, ob es ein Gift ist oder nicht.« In diesem Sinne haben die Schüler Samuel Hahnemanns ein hochverdünntes homöopathisches Heilmittel aus der Pflanze hergestellt (Verdünnung D30 bis C30), um sie bei Rheuma, Gicht und Erkältung anzuwenden.
Extra
Giftpflanzen
Schwerer ist es, Gift zu erkennen, als einen Feind.
QUINTILIAN,
RÖMISCHER RHETORIKER, UM 80 V. U. Z.

Den giftigen Gefleckten Schierling erkennt man an den roten Flecken auf seinem Stängel, die ihm zu seinem Namen verholfen haben.
Warum haben wir die schöne, aber gefährliche Pflanze in diese Sammlung mit hineingenommen? Das will ich euch gleich sagen: Einer der ersten Schritte für jemanden, der sich für Wildkräuter und das Sammeln von Wildgemüsen und Heilpflanzen interessiert, ist das Erkennen der einheimischen Giftgewächse. Davon gibt es in Mitteleuropa glücklicherweise recht wenige, nur eine Handvoll. Dazu gehören etwa der Schierling, die Hundspetersilie, die Blätter der Herbstzeitlosen, der Seidelbast, der Rote Fingerhut, der Weiße Germer oder der hier besprochene Eisenhut. Diese aber muss der Pflanzenfreund unbedingt auf den ersten Blick bestimmen können. Viele der unbekömmlichen oder giftigen Pflanzen warnen uns durch bizarres Aussehen, unangenehmen Geruch oder – wenn man sie trotzdem kostend in den Mund nimmt – durch widrigen, ätzenden oder schlechten Geschmack, sodass man sie instinktiv wieder ausspuckt oder gar erbricht. Dieser Warnhinweis ist aber nicht ganz so eindeutig bei einigen wenigen dieser toxischen Burschen. Oft genügen da kleine Mengen, um selbst gestandene Männer in Lebensgefahr zu bringen – von kleinen Kindern und leichtgewichtigen Personen ganz zu schweigen. Die Tollkirsche erweist sich sogar geradezu als heimtückisch, denn die schwarze »Kirsche« schmeckt recht süß und lecker, wobei zehn Stück davon für einen Erwachsenen tödlich sind. Die alten Griechen weihten das Nachtschattengewächs nicht ohne Grund der Schicksalsgöttin Atropa, deren Aufgabe es ist, den Lebensfaden zu durchschneiden. Die Tollkirsche löst die Seele vom Leibe, bringt Halluzinationen, Delirium, Herzrasen und schließlich den Tod durch Atem- und Herzstillstand.

Besonders tückisch ist die Tollkirsche: Sie schmeckt nämlich süß und angenehm. Dabei können zehn Beeren einen Erwachsenen töten.
Schierling und Taumelkälberkropf sind weitere einheimische Giftgewächse, die man unbedingt kennen muss. Auch im jungen Entwicklungsstadium muss man sie identifizieren können, und zwar ehe man sie mit in die Frühlingssalatschüssel tut.
In den heutigen Pflanzenerkennungsbüchern wird die Giftigkeit einer Pflanze recht simplifiziert dargestellt. Da steht entweder »giftig« oder »ungiftig«. Die giftige Pflanze wird mit einem kleinen Totenkopfsymbol markiert. Aber so einfach geht das nicht. Die sogenannte Giftigkeit ist ein ziemlich dehnbarer Gummi-Begriff. Denn auch die Gartenbohne oder die grüne Kartoffel gelten als Giftpflanzen, wenn sie roh genossen werden. Oft ist es gerade die Giftigkeit, die eine Pflanze – in der richtigen Dosierung – zur Heilpflanze macht. Da ist es wichtig, sich genau zu informieren.

(Digitalis purpurea)
EINE ELFENPFLANZE FÜRS HERZ
Im dunklen Fichtenwald, auf sauren, kalkarmen Böden, am schattigen Wegrand oder auf Kahlschlägen stößt der Wanderer zuweilen auf hohe Blütenstängel mit zahlreichen glockenförmigen, purpurrot leuchtenden Blüten. Es ist der Rote Fingerhut. Diese Blüten faszinieren. Sie haben etwas Magisches an sich. Wem kämen da beim Anblick nicht die Waldelfen in den Sinn?
Der stattliche Rachenblütler38 ist zweijährig. Nach dem Keimen der winzigen, rechteckig geformten Samen bildet dieser Rachenblütler im ersten Jahr eine Blattrosette aus, die Licht einfängt und Kraft sammelt. Die eiförmigen bis lanzettlichen Blätter sind runzelig und fein flaumig. Im zweiten Jahr treibt die Pflanze aus der Rosettenmitte den bis zu 1,20 Meter hohen Blütenstängel empor, wobei sich die Blütenknospen entwickeln. Ehe sie sich öffnen und ihre volle Größe entfalten, richten sie sich himmelwärts, aber wenn sie größer werden, ist es, als ziehe die Schwerkraft sie nach unten. Die tiefschlündigen Blüten, die wie Glöckchen dahängen, sind nicht sternstrahlig wie etwa Astern, sondern zygomorph, also gewissermaßen tierähnlich, indem sie eine zweiseitige Symmetrie, ein Hinten und ein Vorne, ein Links und ein Rechts haben. Sie sind, wie es die anthroposophischen Botaniker sagen würden, stark astralisiert. Das heißt, das Seelenhafte der Pflanze dringt tief in ihre Physis ein (Simonis 1991: 220). Es ist dieses stark ausgeprägte Seelenelement –, die bunte Farbe, die Tiefschlündigkeit, die Toxizität, die zweiseitige Symmetrie – das uns Menschen seelisch anspricht und unwillkürlich fasziniert.
Auch für die Erdhummeln ist die Blüte attraktiv, ja, sie ist geradezu für diese schweren Brummer gemacht. Die dunklen, hell umrandeten Flecken auf der Unterlippe des Blütenrachens zeigen der Hummel den Weg zum Nektar; gleichzeitig gaukeln sie dem Insekt Pollen vor, der aber nicht vorhanden ist. Die Blüten bieten den Hummeln Schutz vor Regen und werden nachts als Schlafplatz aufgesucht. Kleineren Insekten wird der Zugang durch senkrecht hochstehende Sperrhaare verwehrt (Lüder 2008: 260). Die unteren Blüten sind zuerst reif und werden von den Hummeln als Erste bestäubt. Wenn man genau hinschaut, dann merkt man, dass sich die Blüten alle auf der einen Seite des Stängels befinden. Sie blühen immer auf der Seite des stärksten Lichteinfalls. Botaniker sprechen von »einseitswendigen« Blütentrauben. Wenn der Fingerhut nicht im Schatten wächst, dann richten sich die Blüten allgemein nach Süden aus.
Die Zeit des Blühens ist der Hochsommer, sie erstreckt sich je nach Standort bis in den August hinein. Die viereckigen Samen, die in den herzförmigen Samenkapseln heranreifen, sind so klein, dass 10 000 von ihnen lediglich ein Gramm wiegen. Pro Pflanze werden ein bis zwei Millionen Samen erzeugt. Sie brauchen Licht, um zu keimen.
Das Verbreitungsgebiet des Roten Fingerhuts erstreckt sich in Westeuropa von Südschweden bis nach Portugal. Die Pflanze ist vom feuchten atlantischen Klima abhängig. In Osteuropa findet man sie kaum – allenfalls als Zierblume in Gärten. Besonders häufig ist der Fingerhut auf den Britischen Inseln und in Irland anzutreffen, wo er anscheinend seit keltischen Zeiten volksmedizinisch verwendet wurde.
In den Wäldern östlich der Elbe ist die Pflanze zwar selten, dafür gibt es aber mehrere andere Arten der Gattung, die in Süd- und Osteuropa bis über Kleinasien hinaus gedeihen, wie etwa den Rostfarbenen Fingerhut (D. ferruginea), den Blassen Fingerhut (D. grandiflora), den Wolligen Fingerhut (D. lanata) und den Gelben Fingerhut (D. lutea), um nur einige zu erwähnen.
Die Ärzte der griechischen und römischen Antike kannten den Fingerhut nicht. Es war Leonhart Fuchs, der als erster Botaniker diese Pflanze im Jahr 1542 beschrieb. Wegen der Blütenform nannte er sie Digitalis39. Digitale ist das lateinische Wort für die metallene Fingerkappe, die Schneider benutzen, um sich beim Nähen nicht in die Finger zu stechen. Es sind keine altdeutschen Namen für das Waldkraut bekannt. Sicherlich hat es sie einst gegeben, aber irgendwie sind sie verloren gegangen. Nicht einmal Hildegard von Bingen erwähnt den Fingerhut.
In England sieht es jedoch anders aus, für die Kelten und dann auch für die Angelsachsen spielte der Fingerhut eine wichtige Rolle in Heilkunde und Brauchtum. Volkskundler haben auf den Inseln um die 90 verschiedene mundartliche Namen für die Pflanze sammeln können. Nirgendwo beflügelt dieses Kraut die Imagination des Volkes so sehr wie auf den Britischen Inseln. Dichter wie Tennyson und Wordsworth schrieben ihm zu Ehren blumige Gedichte. Und in der Blumensprache, die die Imagination britischer Romantiker beflügelte, war die Pflanze, wenn man sie bei sich trug, ein Zeichen für: »Deine Liebe ist wankelhaft.«
Allgemein heißt der Fingerhut im Englischen foxglove. Das lässt sich als »Handschuh des Fuchses« übersetzen. Der Name macht wenig Sinn, denn wann tragen Füchse Handschuhe? Eigentlich ist Foxglove eine Verballhornung des angelsächsischen folks-gliev. Mit folks (oder good folk) bezeichneten die Angelsachsen die Feen und das Zwergenvolk, die Bewohner der Anderswelt; und gliev (oder gleow) bedeutet »Glöckchen« oder, besser, der »Klang der Glöckchen« und ist nicht mit dem modernen englischen Wort glove (»Handschuh«) verwandt. Es sind also die Glöckchen der Elfen und Feen. Daraus entstanden viele englische mundartliche oder landessprachliche Varianten: fairy bells (Elfen- oder Feenglocken), fairy fingers (Feenfinger) oder fairy pettycoat (Unterröcke der Elfen) oder goblin gloves (Handschuhe der Kobolde); in Schottland sind es die Fingerhüte der Hexen (witches thimbles), in Irland die Fingerhüte des toten Mannes (dead man’s thimble). Einer der walisischen Namen ist maneg ellyllon, »Elfenhandschuh«. Im schottischen Gälisch ist es die lus nam bansith, die »Pflanze der Banshee«, der Feenkönigin, der »Alten«, die in den Feenhügeln, den Síde (den Megalithgräbern) wohnt und deren Schrei den Menschen die Haare zu Berge stehen lässt. Die Pflanze ist granny’s glove, »Handschuh der Großmutter« oder our Lady’s glove, womit die alte paläolithische Erdgöttin, die Herrin der Naturgeister und Zwerge – unsere Frau Holle – ursprünglich gemeint sein könnte.

Die viereckigen Samen des Roten Fingerhuts sind so winzig klein, dass 10 000 von ihnen lediglich ein Gramm wiegen.
Um noch einmal auf den Fuchs zurückzukommen – es gibt neben foxglove auch weitere englische Volksnamen für den Fingerhut, die sich auf das Tier beziehen: fox-docken (Fuchsblätter), fox tree (Fuchsbaum), fox and leaves (Fuchs und Blätter) und irisch, lus a bhalgair (Fuchskraut). Revebjelle, »Fuchsglöckchen«, ist der norwegische Name. Es ist wohl der Fuchs als Zaubertier, der da angesprochen wird – als verschlagener, listiger Schelm, für die Christen eine Erscheinung des Teufels, Begleiter verführerischer Feen und Reittier rothaariger Hexen, die durch die dunkle Nacht streifen. Füchse in Märchen und Sagen vermögen die Tür zum Schattenreich zu öffnen. Sie gehören zu den Tricksern, den Grenzgängern, den Zauberern und den Schamanen, wie Hermes/Merkur einer ist. Gestandene Esoteriker könnten sich fragen: Ist es Zufall, dass es der Botaniker Leonhart Fuchs war, der sich der Pflanze besonders zuwandte?
Offensichtlich war der Fingerhut für die alten Briten, Iren, Waliser und Schotten eine magische Pflanze. Im Aberglauben dieser Völker heißt es, wo sie wachse, seien die Andersweltlichen nicht weit entfernt. Die dunklen Flecken in der Blüte deutete man als Abdrücke der Feenfinger.
Feen, Elfen und Kobolde waren dem traditionellen Landvolk nicht unbedingt willkommen. Wie wir schon sahen, stahlen diese astralen Wesen gerne Kleinkinder aus ihren Wiegen, holten sich besonders schöne Jugendliche oder begabte Sänger und verschleppten sie in ihr Reich, in die Parallelwelt. Sie konnten den Menschen sogar Krankheiten schicken. Da eignete sich der Fingerhut als Gegenmittel. In Schottland streuten die Mütter das Kraut um die Kinderwiegen, um die Elfen fernzuhalten; in Wales legte man den Kindern zum selben Zweck ein ganzes Jahr lang Fingerhutblätter in die Schuhe. Die walisischen Hausfrauen stellten aus den Blättern eine schwarze Farbe her, mit der sie sich überkreuzende Linien auf die Steinfußböden ihrer Häuser malten, um böse Wesen abzuhalten. In Irland wurde die Pflanze »verhexten« Kindern gegeben, um den Elfenfluch zu bannen. In England dagegen heißt es, man dürfe die Pflanze nicht ins Haus nehmen, sonst komme der Teufel mit herein. Oder die Milch werde sauer.
In früheren Zeiten, ehe man die Heilpflanzen auf ihre molekularen Wirkstoffe reduzierte, hat man sie beim Sammeln als Persönlichkeiten angesprochen und sie gebeten, ihre Kraft beim Heilen oder Zaubern zur Verfügung zu stellen. Aus dem keltischen Siedlungsgebiet in der Basse-Bretagne ist ein Sammelspruch für den Fingerhut überliefert worden:
...
Ich grüße dich, bleicher Fingerhut,
ich bin gekommen, um dich zu pflücken,
dass du mir die Gesundheit wiedergibst,
denn ich bin mit einem Kropf belastet.
...
Weitere Namen der magischen Pflanze sind Knallblume, Klatschblume, Platzblume, Schnackeblume oder niederländisch paffers; in Cornwall heißt sie pop-glove und in Frankreich pétards (Krachmacher). Das sind vor allem Kindernamen, denn überall machten sich Kinder einen Spaß daraus, die Blüten oben zusammenzudrücken und dann damit auf die Hand oder auf die Stirn zu schlagen, sodass ein klatschendes Geräusch entsteht.
Wegen dem tiefschlündigen Blütenrachen nannte man den Fingerhut auch Froschmäuler (in Wiesbaden) und im englischen Sprachraum rabbit’s mouth oder bunny’s mouth (Hasenmaul), dragon’s mouth (Drachenmaul) oder auch throatwort (Rachenwurz), wobei die schlundigen Blüten mit ihren dunklen, weiß umrandeten Flecken als Signatur für einen entzündeten Rachen galten. Throttlewort – »Wurzel der Erdrosselung« ist der eher düstere Name dieser Pflanze, wahrscheinlich weil eine unvorsichtige volksmedizinische Anwendung öfter zum Tode führte. Auf Seeland, der größten dänischen Insel, nannte man die Pflanze tòrskefláb (Dorsch-Maul) und in Frankreich Katzenmaul, Löwenmaul oder Wolfsmaul.
Fingerglöckerl, Herrgottsfinger, Waldglöckchen, Waldschellen, Tränenpott, Giftblume und, wahrscheinlich wegen ihrer Gefährlichkeit, Schlangenblume, waren weitere deutsche Benennungen der Pflanze.
Schwulstkraut nennt man sie auch, denn aus den getrockneten Blättern bereiteten die Kräuterfrauen eine Salbe gegen Geschwülste aller Art. Als Scharlachkraut wurde der Fingerhut, wahrscheinlich wegen der Signatur der purpurnen Blüten, gegen die Entzündungskrankheit Scharlach angewendet, deren Symptome eine himbeerrote Zunge und rötlicher Ausschlag sind.
Extra
Die Entdeckung der Digitalis-Herztherapie

William Withering (1741–1799) entdeckte den Roten Fingerhut als Herzmedikament, nachdem die Pflanze vorher bei anderen Krankheiten verwendet wurde.
William Withering kam aus einer angesehenen Ärztefamilie. Auch er wollte Mediziner werden und studierte an der Universität Edinburgh, die zu dieser Zeit eine der fortschrittlichsten medizinischen Fakultäten in der westlichen Welt besaß.
Mit voller Begeisterung legte sich der Student ins Zeug. Es war das Zeitalter der Vernunft, der Aufklärung. Es galt, die abergläubischen und längst überholten galenischen Praktiken, die aus der klassischen Antike stammten, wie alte Zöpfe abzuschneiden und die Medizin auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen. Der Organismus wurde nun als ein komplizierter Mechanismus definiert und die physiologischen Lebensvorgänge ließen sich bestens als chemische und mechanische Abläufe erklären. Da hatten die Kräuter, derer sich die alten Weiber und das Landvolk bedienten, sowie die astrologischen Zuordnungen nichts mehr zu suchen. Kräuter waren out, es sei denn, es handelte sich um wirklich drastisch wirkende, meist giftige Pflanzen, wie die abführend wirkende Jalapa-Wurzel, die Brechreiz erzeugende südamerikanische Ipecacuanha, die Belladonna, den Tabak, das Bilsenkraut oder das schmerzstillende Opium (Laudanum). Die hatten offensichtlich Schlagkraft. Für besser hielt man jetzt chemische Präparate wie etwa das Quecksilberpräparat Mercurius dulcis (Kalomel), Antimon (Spießglanzoxid), Nitrum (Salpeter), Spiritus vitrioli (verdünnte Schwefelsäure), Kaliumsulfat und ähnliche mineralische Stoffe. Bei diesen Mitteln stellte sich, im Gegensatz zu den lächerlichen Kräutertees, die Wirkung – Geifern, Schwitzen, Harndrang, Zittern, Durchfall – sofort ein. Ein Zeichen, dass sie wirkten. Neben der Anwendung der chemischen Substanzen spielten das Purgieren, der Aderlass, das Schröpfen und Anlegen blasenziehender Pflaster die Hauptrollen in dieser neuartigen Therapie.
Der junge William Withering war mit diesem Zeitgeist völlig im Einklang, für ihn waren Pflanzen gänzlich uninteressant. In einem Brief an seine Eltern schrieb er, dass ihm das Studium viel Freude mache, allein die Pflichtvorlesung zum Thema Botanik sei unerträglich öde (dreary).
Diese Einstellung änderte sich jedoch bald. 1766 eröffnete der gerade Approbierte seine Praxis. Eine künstlerisch begabte junge Dame namens Helena war seine allererste Patientin und er verliebte sich in sie. Wie viele Mädchen aus gutem Hause spielte sie virtuos Clavichord und schrieb Verse, aber ihre Lieblingsbeschäftigung war es, Blumenaquarelle zu malen. Wegen ihrer Krankheit und der langen Genesungszeit konnte sie ihre Wohnung nicht verlassen. Da brachte ihr der verliebte William jeden Tag frische Wildblumen, die sie porträtieren konnte. Dabei wurde der junge Arzt zum Botaniker. Er schrieb sogar ein Buch40 über die Flora Großbritanniens, indem er die Pflanzen nach dem neuen, von Linné geschaffenen, wissenschaftlichen System klassifizierte. Bald verlobten sich die beiden und vier Jahre später heiratete William seine Helena.
Als das junge Paar einmal in der ländlichen Grafschaft Shropshire, an der Grenze zu Wales, in die Sommerfrische ging, kam eine schluchzende, völlig aufgelöste Frau auf den jungen Arzt zu. Ihr Mann sei todkrank, er habe Wassersucht. William begleitete die Frau und fand ihren Mann, um Atem ringend, mit ballonartig aufgedunsenem Leib. Bei der Wassersucht (Hydrops) war die damalige moderne Medizin mit ihrem Latein am Ende. Das Einzige, was vorübergehende Erleichterung bringen könnte, wäre ein Einstich in den Bauch, wobei das überflüssige Wasser teilweise abtropfen würde. Withering gab ihm einige Placebopillen und dachte bei sich, dass der Mann nicht mehr lange leben würde.

Wassersucht, also Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe, wurde früher unter anderem durch Schröpfen behandelt (Holzschnitt, 1483).
Als er jedoch ein Jahr später wieder in dem Dorf war, lebte der Mann nicht nur, sondern er war praktisch beschwerdefrei. Wie konnte das sein? Man berichtete dem Doktor, dass eine auld Hag, eine alte Kräuterhexe, den Kranken mit einem Gebräu aus Wildpflanzen behandelt habe. Er habe zwar heftig erbrechen müssen und Durchfall gehabt, aber die Wasseransammlung habe sich aufgelöst. Withering spitzte die Ohren. Leider konnte er die Kräuterfrau nicht persönlich befragen. Es geziemte sich nicht, sich mit einem Kräuterweib, einer Frau von niedrigem Stand, abzugeben. Was würden seine Kollegen sagen? Gegen Geld ließ er ausspionieren, welche Pflanzen dieses Weib für ihren Hexentrunk sammelte. Es waren ungefähr 20 verschiedene Pflanzen, die ihm vorgelegt wurden. Dank seiner botanischen Kenntnisse konnte er sie bestimmen. Die meisten verwarf er, denn er hielt sie für wirkungslos. Allein der giftige Rote Fingerhut hatte, nach modernen Gesichtspunkten, eine physiologische Wirkung. Leider hat sich Withering nicht die Mühe gemacht, die Namen der übrigen Kräuter aufzuschreiben. Damals wusste man ja nichts von der komplizierten chemischen Zusammensetzung der Pflanzen und ihren möglichen synergistischen Wirkungen.

Den Puls fühlen und eine – wirkungslose – Arznei verabreichen, mehr konnte man gegen Wassersucht nicht tun (Druckgrafik, 1784).
William Withering war ein gewissenhafter Arzt. Er versuchte, die Wirkweise des Rachenblütlers exakt zu erkunden. Vor allem die richtige Dosierung herauszufinden stellte ein Problem dar. Tierexperimente waren zu der Zeit gerade en vogue. Er fütterte Truthähne mit den Blättern. Die Vögel erbrachen den Inhalt ihrer Mägen, torkelten herum und fielen tot um. Sinnvoll wäre es, überlegte er, die Pflanze mit aller Vorsicht an seinen an Ödemen leidenden Patienten zu testen. Aber seine Frau riet ihm, den Fingerhut nicht an zahlenden Privatpatienten auszuprobieren.
Bald darauf zog er in die Stadt Birmingham, wo er arme Patienten an einer free clinic kostenlos behandeln konnte. Da gab es immer wieder welche, die an Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe litten. Das gab ihm die Möglichkeit, sorgfältig mit der Dosierung zu experimentieren und die Nebenwirkungen, wie etwa die Verlangsamung des Herzschlags, zu studieren. Er lernte, dass die Dosis zu hoch war, wenn es beim Patienten zu heftigem Erbrechen und Übelkeit kam. Auch fand er heraus, dass ein Kaltwasserauszug der getrockneten Blätter besser war als ein heißer Tee. In den klinischen Versuchen verlor er leider immer wieder Patienten, was er auch zugab.
Nach zehn Jahren veröffentlichte er die Resultate seiner Forschung in dem inzwischen zum medizinischen Klassiker gewordenen Werk An Account of Foxglove (1785). Erasmus Darwin, der Großvater von Charles Darwin, versuchte, das Verdienst der Entdeckung der Digitalis-Therapie für sich zu reklamieren, aber es war William Withering, der schließlich zum »Vater der Herztherapie« gekürt wurde. Dass William Withering sich nur auf den Fingerhut konzentrierte und die anderen Kräuter in dem Gebräu der Kräuterfrau nicht einmal aufschrieb, zeugt von einem Geist des wissenschaftlichen Reduktionismus. Dieser Geist spielte weiterhin eine Rolle, als man die Pflanze als Ganzes ignorierte und sich nur auf einen einzigen Wirkstoff, das Digitoxin, konzentrierte.
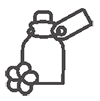
Leonhart Fuchs, dem wir, wie erwähnt, die erste Beschreibung des Fingerhuts verdanken, erklärt in seinem New Kreüterbuch (Basel, 1543): Das Fingerkraut »ist in summa ein schön lustig kraut anzusehen, habs derhalben nit künnen übergeen, unangesehen das es noch in keinem brauch ist bey den ärtzeten, so vil und mir bewußt.«
Was dieser gelehrte »Vater der Botanik« nicht wusste, ist, dass diese Elfenpflanze schon im alten Irland im 5. Jahrhundert bei Krampfanfällen von Säuglingen (puerperale Eklampsie) und auch gegen den »bösen Blick« zum Einsatz kam. Und von den Heilern in Wales, den Meddygon Myddfai, die ihr Wissen auf lange keltische Tradition zurückführten und sich als Nachkommen einer Elfenfrau bezeichneten, wird aus dem 13. Jahrhundert berichtet, dass sie mit der äußerlich angewendeten Pflanze Geschwülste des Unterleibs, Abszesse, Kopfschmerzen und anderes behandeln konnten, und zwar mit Dosierungen, die ihre Patienten nicht vergifteten (Urbanovsky 2008: 300).
Leonhard Fuchs schreibt: »Die Fingerhütkreüter gesotten unnd getruncken / zerteylen die grobe feüchtigkeyt / seubern und reynigen / nemen hinweg die verstopffung der leber unnd anderer inwendigen glider. Der gestalt gebraucht / bringen sie den frawen jhre zeit / machen außwerffen / und reynigen die brust. Dise kreüter seind gut für allerley gifft in wein gesotten unnd getruncken. Gepulvert in die wunden gestrewet / heylen sie dieselbigen. Mit hönig vermischt und angestrichen / vertreiben sie die masen und flecken under dem angesicht / und an dem gantzen leib.«
Ähnliche Angaben finden wir bei Nicholas Culpeper (1653). Der Armenarzt kennt die Anwendung der Blätter zur Wundheilung, den Saft gegen alte Geschwüre, die Aufkochung mit Honig oder Zucker zur Reinigung und Purgierung des Körpers, »nach oben und nach unten«, und zur Öffnung der verstopften Leber und der Milz. Foxglove habe eine sanfte, reinigende Qualität und allgemein eine sehr freundliche Natur, schreibt er, und es stehe unter der Herrschaft der Venus.

Die Fingerhutblüten sind einseitswendig, wie die Botaniker sagen: Sie wenden sich alle auf eine Seite, und zwar nach Süden, wenn die Pflanze in der Sonne steht.
Von einer Herzwirksamkeit wusste die damalige Medizin nichts; sie wurde erst von dem englischen Arzt William Withering (1741–1799) entdeckt (siehe >).
Was Withering nicht wusste, war, dass Wassersucht keine Krankheit an sich ist, sondern entweder auf Nieren- oder auf Herzinsuffizienz basiert. Digitalis wirkt nur, wenn eine Herzschwäche vorliegt, nicht aber bei Nierenschwäche. Das wurde erst später von französischen Forschern entdeckt. Das Digitoxin stärkt als Hauptwirkstoff in der Pflanze die Kontraktion des Herzens, korrigiert unregelmäßigen Herzschlag und verlangsamt den Puls. Die Ärzte zögerten lange mit der Anwendung dieser Erkenntnisse an ihren Patienten; sie benutzten den Fingerhut lieber als Mittel gegen Tuberkulose, was sich später als unsinnig herausstellte. Im 19. Jahrhundert, als man die Wirkweise besser erkannte, wurde die »Digitalisierung« der Herzpatienten Mode und zugleich die häufigste iatrogene41 Todesursache.
Der Fingerhut besitzt 30 verschiedene Herzglykoside – Digitalin, Digitoxin, Gitoxin, Gitalin, Verodoxin und so weiter. Diese wirken in dem pflanzlichen Drogenpräparat synergistisch. Aber ab 1914 wurden die wichtigsten Herzglykoside, insbesondere Digitoxin, dann Digoxin, synthetisch nachgebaut. Der international bekannte amerikanische Medizinprofessor Andrew Weil schreibt, er lernte als Medizinstudent, dass es drei Stufen der Digitalis-Vergiftung gebe:
Bei den synthetischen Präparaten werde das erste Stadium – das Warnstadium – übersprungen. Wenn man den Patienten zu viel von dem Blätterpräparat verabreichte, bekamen sie immer zuerst Magenschmerzen. Sie zeigten niemals Herzrhythmusstörungen und man konnte in aller Ruhe die Dosis herabsetzen, schreibt Weil. Er folgert daraus: »Die ganze Pflanze hat bestimmte, eingebaute Sicherheitsmechanismen, die verloren gehen, wenn die kardiotonen (herzstärkenden) Elemente extrahiert werden und in ihrer reinen Form verwendet werden. Man kann das, wenn man will, die Weisheit der Natur nennen oder auch nicht; jedenfalls ist es eine erwiesene Tatsache.« (Weil 1988: 230)
Was Andrew Weil sagt, ist Musik in den Ohren der Befürworter natürlicher Heilkräuter. Dennoch seien Laien gewarnt, diese hochgiftige Pflanze eigenmächtig anzuwenden.
_______
WEISSDORNTEE ZUR HERZSTÄRKUNG
_______
So vielversprechend die Behandlung von Herzschwäche mit dem Roten Fingerhut auch klingt – sie gehört in professionelle Hände! Wer seinem Herzen etwas Gutes tun möchte, kann zum Weißdorn greifen. Er entlastet auch vorbeugend das Herz, indem der Herzmuskel besser mit Sauerstoff versorgt wird. Für den Tee 2 TL Weißdornblüten mit 1 Tasse (250 ml) heißem Wasser übergießen, 20 Minuten ziehen lassen und abseihen. Morgens und vor dem Schlafengehen je 1 Tasse trinken.

(Prenanthes purpurea)
»MEIN NAME IST HASE, ICH WEISS VON NICHTS."
Im August im schattigen Wald,
blüht der Hasenlattich zart und fein
purpurviolett, wie edler Wein.
Ein Elfenkräutlein bist du sicherlich,
wenn ausgeblüht verwandelst du dich
in lauter weiße Engelein,
die sich, wenn‘s windet, heben und schweben.
Du gehörst der Dea-Ana, der holden Frau,
den Hasen, den Rehen, dem Mondenschein.
Und kommt der Frühling wieder ins Land,
haucht die Holle dir neues Leben ein.
WOLF-DIETER STORL
Die zarte Waldpflanze mit den nickenden, purpurnen Blüten ist eine Schönheit. Sie wird deshalb auch Purpur-Hasenlattich oder nur Purpurlattich genannt und gehört zu der riesigen Familie der Korbblütler, und zwar zur Tribus42 oder Unterfamilie der Cichorieae. Dieser Tribus angehörig sind jene Korbblütler, die Milchsaft enthalten, wie etwa unser Gartensalat. Auch Milchlattich, Mauerlattich, Golddistel, Schwarzwurzel, Bocksbart, Wegwarte, Rainkohl, Löwenzahn, Habichtskräuter, der stinkende Hainsalat, Gänsedisteln, Ferkelkräuter und andere gehören dazu.
Die bescheidene Schattenpflanze ist in unseren Mischwäldern, seltener in reinen Laub- oder Nadelwäldern heimisch. Ihr Areal erstreckt sich über Eurasien hinweg. In Ostasien und Nordamerika gibt es viele Arten dieser Gattung, aber in unseren Wäldern ist einzig und allein Prenanthes purpurea vertreten. Auffallend und schön anzusehen sind die nach unten hängenden Blüten mit ihren zwei bis fünf purpurvioletten Zungenblüten und dunkelgelben Griffeln. Die Griffel ragen weit aus den Blütenblättern heraus. Die Blütezeit erstreckt sich von Juni bis August. Fliegen, Bienen oder Käfer bestäuben sie, falls diese aber nicht vorhanden sind, rollen sich die Narbenlappen rückwärts und es kommt zur Selbstbestäubung – eine geniale Einrichtung der Natur! Die kleinen, länglichen Früchte haben einen schneeweißen Flugschirm (Pappus) und werden vom Wind verbreitet.
Der Hasenlattich ist eine Nahrungspflanze für den Eulenfalter (Kompasslatticheule), auch Rehe fressen sie gerne. Anhand von verbissenen Hasenlattichen und dem Vergleich zu unversehrten Pflanzen können Förster auf den Rehbestand im Revier schließen.

Der Hasenlattich wächst gern in Mischwäldern, seltener in reinen Laub- oder Nadelwäldern.

Seine hübschen kleinen, purpurfarbenen Blüten haben ihm zu dem Namen Purpurlattich verholfen.
Der Ethnobotaniker Heinrich Marzell, der über Jahrzehnte die mundartlichen Namen sammelte, gibt unter anderem folgende Benennungen an: Waldlattich, Hasenlattich, Butterstriezel, Dürre Henne – letzteres im Gegensatz zur »Fetten Henne« (Sedum), einem Steinbrechgewächs mit dicken, fleischigen Blättern.
Die Engländer nennen die Waldpflanze purple lettuce und die Amerikaner kennen sie als rattlesnake-root (Klapperschlangenwurzel).
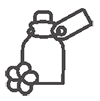
In der europäischen Volksheilkunde ist kaum etwas über eine Heilwirkung dieser Pflanze bekannt. Womöglich hat sie wegen ihrer Bitterkeit eine anregende Wirkung auf Leber und Galle. Aber für diese gibt es viel bessere Alternativen, etwa die verwandte Wegwarte (Cichorium intybus)43oder die Kohldistel (Cirsium oleraceum). Was die in Amerika wachsenden Arten betrifft, die zu dieser Gattung gehören, so kennen die Indianer viele Heilwirkungen, insbesondere als Mittel bei Schlangenbissen, weswegen sie in der Neuen Welt, wie wir gehört haben, auch als rattlesnake-root (Klapperschlangenwurzel) bekannt ist. Man legte die zerstampften Wurzeln auf die Bissstelle und trank einen Sud aus der Milch der Pflanze.

Der Hasenlattich schmeckt bitter und ist deshalb ungeeignet für die Küche. Angeblich enthält er aber beruhigende, angstlösende Stoffe.

Giftig ist der Hasenlattich nicht, aber die Blätter schmecken recht bitter. Höchstens die ganz hartgesottenen, verwegenen Rohköstler wagen es, sich aus diesem Lattich einen Salat zu machen oder wenigstens einige Blätter in den Salat zu streuen. Wahrscheinlich heißt die Pflanze Hasenlattich, weil man sie gerne den Hasen als Futter überlässt. Andererseits glaubte man, dass die Hasen sie – ähnlich wie die ebenfalls eine Latexmilch enthaltende Gänsedistel (Sonchus) – fressen, um ihre Angst und Melancholie zu überwinden. Diese Tiere, heißt es, legen sich in den »Hasenkohl«, um ihr hitziges Temperament zu kühlen (Storl 2018b: 124). Tatsächlich haben wissenschaftliche Untersuchungen des alkoholischen Auszugs der Pflanze eine angstlösende Wirkung, ähnlich dem Clonazepam, einem Antiepileptikum mit Suchtpotenzial, nachgewiesen. Auch aus der nepalesischen und chinesischen Volksheilkunde wird von einer beruhigenden Wirkung berichtet (Huber 2017: 80).

(Circaea lutetiana)
DAS GEHEIMNIS DER ZIRZE
Wir gehen durch den Wiesentau,
wir gehen zu der Kräuterfrau,
die wohnt im dichten Wald.
RICHARD SCHAUKAL (1874–1942),
»DIE HEXE«
Das Hexenkraut ist ein zartes, ausdauerndes Kräutlein aus der Familie der Nachtkerzengewächse (Onagraceae), das zirkumpolar von Europa über Sibirien bis nach Nordamerika wächst. Wie die slawische Baba Jaga, die Blair-Witch oder die Hexe im Märchen von Hänsel und Gretel findet man die Hexenpflanze vor allem in tiefen, schattigen Wäldern. Die kleinen, weiß bis rötlich angehauchten, zweiteiligen Blüten sind zu einer lockeren Traube angeordnet. Während seiner Blütezeit im Juli und August wird das Hexenkraut von Schwebfliegen besucht und bestäubt. Die kleinen Früchte haben borstige Haken, die wie Kletten an vorbeilaufenden Tieren oder auch an der Kleidung von Wanderern hängen bleiben.
Als Nachtkerzengewächs ist das Hexenkraut verwandt mit der Gewöhnlichen Nachtkerze, der Fuchsia, die aus Südamerika kommt und dort von Kolibris bestäubt wird, und dem bei uns einheimischen Schmalblättrigen Weidenröschen, dem Bergweidenröschen und dem Sumpfweidenröschen. Weltweit gibt es ungefähr 250 weitere Arten der Familie der Nachtkerzengewächse.
Zur selben Gattung wie das hier beschriebene Große Hexenkraut gehört das etwas kleinere Alpen-Hexenkraut (C. alpini), das Mittlere Hexenkraut, das ein Bastard zwischen dem Großen und dem Alpen-Hexenkraut ist, sowie das in Nordamerika wachsende Kanadische Hexenkraut (Circaea lutetiana subsp. canadensis).

Im tiefen Schatten dunkler Wälder fühlt sich das unscheinbare Hexenkraut wohl. Seine Blüten locken im Hochsommer Schwebfliegen an.

Die Blätter erinnern an die Verwandtschaft zur Gewöhnlichen Nachtkerze.
In der heutigen, technokratisch orientierten Zeit, in der Frauen genötigt sind, mit Männern in Berufen zu konkurrieren, in der das altüberlieferte weibliche Heilwissen und die Hebammenkunst dem rational-wissenschaftlichen Diktat professioneller Mediziner und dem Labor unterworfen sind, und die Sexualität bis ins letzte Detail wissenschaftlich analysiert wird, ist viel von der femininen Macht und Magie verloren gegangen oder unterdrückt worden. Nun aber versuchen Frauen, die sich als »Hexen« oder wilde Weiber verstehen, ihre weiblich-magischen Kräfte wieder der Vergessenheit zu entreißen und erneut zur Geltung zu bringen. Da ist es kein Wunder, dass dieses sogenannte Hexenkraut plötzlich Konjunktur hat. Es wurde ja nach der Erzhexe Zirze (griechisch Kirke; lateinisch Circe) benannt, die den Helden Odysseus (lateinisch Ulysses) mit ihrem Liebeszauber festhielt und seine Mannschaft in grunzende, Eicheln fressende Schweine verwandelte. Als der Seefahrer auf der Insel Aiaia landete, schickte er einige Männer aus, um das Eiland zu erkunden. Auf ihrem Weg durch die wilde Landschaft wurden sie von Wölfen und Löwen umzingelt, diese aber griffen sie nicht an, denn es waren verzauberte Männer. Tief im Wald entdeckten Odysseus‘ Seeleute ein Schloss und erblickten darin eine traumhaft schöne, an einem Webstuhl webende Frau, die Zauberlieder sang. Sie lud die Männer freundlich ein, gab ihnen Speise und köstlichen Met zu trinken. In das Getränk aber hatte sie »böse Kräuter« gemischt. Und als ihre Gäste betrunken waren, berührte sie sie mit einem Zauberstab und verwandelte sie in Borstenviecher. Einer entkam und berichtete dem beim Schiff wartenden Odysseus davon. Da gürtete sich der Held mit scharfen Waffen und machte sich auf den Weg zum Schloss. Gerade, als er den Wald betrat, erschien ihm der Götterbote Hermes in der Gestalt eines schönen Jünglings und reichte ihm eine Wurzel. Bei Homer, der die Irrfahrt des Odysseus in seiner klassischen Epik beschrieb, heißt es:
»Also sprach Hermes, und gab mir die heilsame Pflanze, die er dem Boden entriss, und zeigte mir ihre Natur an: Ihre Wurzel war schwarz, und milchweiß blühte die Blume, Moly wird sie genannt von den Göttern. Sterblichen Menschen ist sie schwer zu graben; doch alles vermögen die Götter.«
Auch den kühnen Seefahrer wollte die Zaubergöttin mit Kräutern und Gesang bezirzen – ein Wort übrigens, das sich auf die Zirze bezieht. Als sie merkte, dass ihr Zauber nichts bewirkte, fiel sie dem Mann, der sein scharfes Schwert gezückt hatte, zu Füßen, umklammert seine Knie und versprach ihm die süßeste sinnliche Liebe. Ein ganzes Jahr verbrachte er mit ihr in wunderbarster Liebesekstase, bis sie ihn wieder gehen ließ, seiner Mannschaft die menschliche Gestalt wiedergab und sie mit ihrem Segen davonziehen ließ.
Botaniker rätseln noch immer, welche Pflanze dieses mysteriöse Moly wohl gewesen sein könnte. Das Wort geht auf molyein zurück, mit der Bedeutung, »(vom Zauber) abhalten«. Zu den unwahrscheinlichen Kandidaten gehören der Schwarzlauch (Allium nigrum), die Steppenraute, die Meereszwiebel, das Schneeglöckchen und andere. Der gelehrte Botaniker Adam Lonitzer – bekannt als Lonicerus – schlägt in seinem Kreüterbuch (1557) vor, dass es der Allermannsharnisch oder Siegwurz-Lauch (Allium victorialis) hätte sein können. Man weiß es jedoch nicht. Vielleicht ist es gar keine irdische Pflanze.
Und genauso, wie man nach Moly suchte, suchten Botaniker nach den in der Odyssee erwähnten »bösen Kräutern«, welche die schicksalspinnende Hexengöttin Zirze ihren Opfern in den Met mischte. Der im 16. Jahrhundert lebende, flämische Botaniker Matthias Del’Obel (1538–1616) – auch Lobelius genannt – suchte ebenfalls nach ihnen. Er vermutete, darunter befinde sich die Kirkaia, eine bis dato nicht identifizierte Pflanze, die der alte Dioskurides in seinem Werk, dem ersten Kräuterbuch der westlichen Welt (Materia medica), erwähnte. Andere Gelehrte waren der Meinung, es könnte die psychoaktive Mandragora (Alraune) oder die Schwalbenwurz gewesen sein. Lobelius mutmaßte, es wäre der Bittersüße Nachtschatten, doch dann schien ihm das unscheinbare, in unseren Wäldern wachsende »Hexenkraut« (Circaea lutetiana) die richtige Wahl zu sein. Der große Linnaeus, dem wir die Klassifizierung der Pflanzen- und Tierwelt verdanken, übernahm diese Benennung. Und damit begann die heutige Faszination für die vorher wenig beachtete Waldpflanze.
Eigentlich spielte die unauffällige Schattenpflanze in der Volksmedizin kaum eine Rolle. Älter als »Hexenkraut« ist der Name Stephanskraut – niederländisch stevenskruid; dänisch steffensurt; französisch herbe de Saint-Etienne; italienisch erba di S. Stefano. Der heilige Stephan, der erste Märtyrer der Kirche – er wurde zu Tode gesteinigt – wird von Gläubigen gegen Kopfschmerzen und Steinleiden angerufen. Gelegentlich flehte man ihn in Zeiten der Pest um Hilfe an, aber auch gegen Hexenmachwerk. Meistens – so der Glaube im christlichen Mittelalter – helfen die Heiligen durch die Pflanze, die nach ihnen benannt wurden. Eine große Rolle als Heilpflanze spielte das Stephanskraut in unserer Volksheilkunde jedoch nie.44 Allein die nordamerikanischen Irokesen kannten einen Tee aus dem Kraut für leichte Hautverletzungen. Tatsächlich soll das ungiftige Kraut eine leicht entzündungshemmende und adstringierende (zusammenziehende, blutstillende) Wirkung haben.
Von den alten Angelsachsen wird der Name Aelfthone (»Elfenfänger«) für diese Pflanze überliefert. Sie soll gegen den Spell, den magischen, aber verderblichen Zaubergesang der Elfen, und gegen Aelfsogota, die »Elfensucht«, helfen, die die Kräfte eines Menschen dahinschwinden lassen.
Elfen necken die Menschen gerne und machen, dass sie sich im Wald verlaufen, führen sie auf Irrwege. In einigen Regionen glaubte man, dasselbe geschehe, wenn man aus Versehen auf ein Hexenkraut trete.

Aus den kleinen Blüten des Hexenkrauts werden Früchte mit borstiger Hülle, die sich im Fell vorbeilaufender Tiere verhaken können.
Wie gesagt, begann die moderne Karriere des kleinen Nachtkerzengewächses erst, als es seinen lateinisch-wissenschaftlichen Namen Circaea bekommen hatte und als »Hexenkraut« oder »Zauberkraut« die Einbildungskraft der Menschen beflügelte. Enchanters nightshade (Nachtschatten der Zauberer) oder witchwort (Hexenwurz) heißt es im Englischen; häxört im Schwedischen; herbe aux sorciers, herbe enchanteresse im Französischen. Ebenso bringen die Benennungen in den slawischen und baltischen Sprachen das Waldkraut mit Zauberinnen und Hexen in Verbindung, auch das geht vermutlich auf die Namensgebung durch Linnaeus zurück. Siegfried Seligmann, ein Hamburger Arzt, der sich für die magische Anwendung von Pflanzen interessierte, schreibt, dass hier und da die Bauern das Kraut gegen Behexung in die Viehställe steckten, aber er verwechselt das womöglich mit dem Johanniskraut (Hypericum perforatum), das gelegentlich auch Hexenkraut genannt wird (Seligmann 1996: 128). In Hessen soll man es als »Unruh« an die Zimmerdecke gehängt haben – ein Kräuterbüschel, das sich leicht bewegt, wenn eine Hexe oder auch ein unholder Geist das Zimmer betritt. Und im Vogtland legte man das Hexenkraut gegen das Alpdrücken ins Bett.
Unsere neuen »Hexen« sind überzeugt, dass das Hexenkraut eine tiefgreifende Wirkung auf die menschliche Seele hat. Frauen, die das frische Kraut bei sich tragen, berichten von einer plötzlichen Anziehungskraft auf Männer (Hirsch/Grünberger 2005: 249). Auch wenn sie den Tee trinken, wird es angeblich leichter, die Männer um den Finger zu wickeln. Durch das Hexenkraut, heißt es, kommt die Frau mit der Zirze, dem Archetypus der verführerischen Weiblichkeit, in Verbindung.
Weitere mundartliche Benennungen der Schattenpflanze sind Läusekraut – weil die kleinen Kletten wie Läuse kleben oder sich wie die Flüche der Hexen an den Betroffenen anhaften. Waldklette ist ein weiterer Name. Bei dem Namen Walpurgiskraut sind wir wieder beim Thema Hexen.

Hexen, hieß es, kochen aus allerlei geheimen Zutaten eine Flugsalbe, mithilfe derer sie sich in die Lüfte erheben können (Holzschnitt, 1571).

Das Hexenkraut ist mit der aus Amerika stammenden Nachtkerze (Oenothera biennis) verwandt. Diese öffnet ihre großen, gelb leuchtenden Blüten erst in der Dämmerung, nachdem die Sonne untergegangen ist. An warmen Abenden öffnen sich die Blüten so schnell, wie der frisch aus dem Kokon geschlüpfte Schmetterling seine Flügel entfaltet. Als die Pflanze 1612 zuerst in Italien eingeführt wurde, war man von diesem Spektakel dermaßen beeindruckt, dass es zur ästhetischen Unterhaltung wurde, dem zuzuschauen. Fürsten und Großbürger pflanzten die Nachtkerze in ihre Gärten. Rund 100 Jahre später entdeckten die Bauern – der Nährstand – die Pflanze und zugleich, dass die Wurzel, wie auch die jungen Blattrosetten, gut essbar sind. Die Pfahlwurzel hat eine rosa Farbe, so wie gekochter Schinken, also nannte man sie Schinkenwurzel. In katholischen Regionen wurde ihr sogar ein Schutzheiliger zugewiesen, der heilige Antonius, der »Sau-Töni« im Allgäu oder der Swinetünnes im Niederdeutschen, der für das Wohl der Rüsseltiere zuständig ist. Emsige Züchter verbesserten die Wurzel, die dann im 19. Jahrhundert ein Modegemüse wurde. Vor kurzem hat man dieses inzwischen vergessene Gemüse wiederentdeckt.
Die kleine Verwandte der Nachtkerze, das Hexenkraut, hat dagegen wenig zu bieten. Aber dennoch könnte man die Blätter mit in der Wildkräutersuppe verwenden.

(Geum urbanum)
EINE WAHRHAFT CHRISTLICHE PFLANZE
Deine Wurzel duftet so fein
nach Weihnachtsguetzlis und Glühwein.
Nichts an dir ist gemein,
du linderst Zahnweh und machst die Leber rein.
WOLF-DIETER STORL
Unter fast jeder Hecke, auch in der Stadt, an Waldrändern, im Gebüsch und in Eichen-Hainbuchen-Wäldern trifft man die Nelkenwurz an. Das wärmeliebende Kräutlein ist in Europa, Asien und Nordafrika verbreitet. Es mag nährstoffreiche Böden und kann bis zu einem Meter hoch werden. Dass es sich um ein Rosengewächs (Rosaceae) handelt, erkennt man an den gelben, fünfzähligen Blüten, die von Mai bis Oktober erscheinen. Der Blütenstand ist sparrig verzweigt.
Die Nelkenwurz ist ausdauernd; im Winter, auch wenn es schneit und gefriert, bleibt die Blattrosette grün und drückt sich fest an die schützende mütterliche Erde. Im Frühling treibt sie dann ihre neuen Triebe aus den kurzen gelbbraunen, stark nach Gewürznelken duftenden Speicherwurzeln hervor. Die unregelmäßig gefiederten Blätter sind Futter für Falter, die man häufig im Wald oder an Waldrändern findet, wie etwa verschiedene Blattspanner, Erdeulen oder Waldschatteneulen. Unterschiedliche Fliegenarten, Käfer und Schwebefliegen bestäuben die kleinen »Röschen«. Wenn sie ausgeblüht sind, entwickeln sich die Fruchtknoten zu kleinen Nüsschen. Die dazugehörigen Griffel verlängern sich, verhärten und bilden kleine Haken, die an den Fellen vorbeihuschender Tiere hängen bleiben und so weitergetragen werden.
Einige endemische Kräuter werden immer seltener und landen zuletzt als bedrohte Arten auf der Roten Liste. Nicht so die Nelkenwurz. Man findet sie immer häufiger, vor allem in den Städten; ihr spezifischer lateinischer Name ist übrigens urbanum, das ist von lateinisch urbs, »die Stadt«, abgeleitet und bedeutet »zur Stadt gehörend«. Warum ist die Waldpflanze in städtischen Parkanlagen, Hinterhöfen und unter den Hecken so verbreitet? Das liegt vor allem daran, dass es inzwischen so viele Katzen gibt, die dort herumstreifen und in ihrem Fell die kleinen Klettfrüchte verbreiten.
Ganz nahe verwandt mit der Echten Nelkenwurz ist die hübsche Bachnelkenwurz (Geum rivale), und zwar steht sie ihr genetisch so nahe, dass die beiden Arten gelegentlich bastardisieren, das heißt sich kreuzen. Wie der Name besagt, wächst diese kleine Schwester der großen Nelkenwurz gerne in der Nähe von Bächen (lateinisch rivus). Ihre attraktiven, kirschgroßen, nach unten hängenden, orangeroten bis blutroten Blüten haben ihr den Namen »Blutströpfli« eingebracht. Sie sei entstanden, als das Blut des gekreuzigten Heilands auf die Erde tropfte – so wenigstens erklärte es mir mein guter Nachbar, der kräuterkundige Eddi Eisele. Anderswo in katholischen Landen heißt die Bachnelkenwurz »Muttergottesblutstropfen«. Die Heilpflanze sei entstanden, als das Menstrualblut der Maria auf den Waldboden fiel. Die Heilige Jungfrau war gerade auf den Weg zu ihrer Base Elisabeth, um ihr die freudige Nachricht zu bringen, sie sei in guter Hoffnung. Das – so fabulierten die Mönche – beweise, dass sie trotz ihrer Schwangerschaft noch immer jungfräulich sei.

Die Laubblätter der Nelkenwurz sind unregelmäßig gefiedert und als Nahrung beliebt bei einigen Faltern, etwa dem Blattspanner oder den Erdeulen.
Was die Aufmerksamkeit der Menschen für diese an sich recht unscheinbare Schattenpflanze erregte, ist vor allem der würzig-aromatische Duft der Wurzeln. Schon der lateinische Name der Gattung, Geum – von lateinisch geuein, »schmecken, würzen« – deutet das an. Gein, das Glykosid des ätherischen Nelkenwurzelöls, ist dafür verantwortlich.
Der Name Nelkenwurz – vom mittelniederdeutschen Negelken (Nägelchen), die Verkleinerungsform von Nagel – bezieht sich auf die exotische Gewürznelke. Das sind die getrockneten, stark aromatischen, scharf und leicht süß schmeckenden Blütenknospen des Gewürznelkenbaumes (Syzygium aromaticum), der ursprünglich auf den Molukken (Indonesien) zu Hause ist. Im Mittelalter brachten arabische Zwischenhändler das sündhaft teure Gewürz nach Europa, wo man die rostfarbenen, harten Knospen sogleich mit den Nägeln verglich, mit denen Christus ans Kreuz geschlagen wurde. Da der Duft der meist rot blühenden Gartennelken (Dianthus caryophyllus) dem Duft des teuren exotischen Gewürzes ähnelte, nannte man die Blumen ab da nun auch Nelken oder »kleine Nägel«45. Niederländische Seefahrer eroberten im 17. Jahrhundert Indonesien und erlangten dadurch das Monopol für das begehrte Gewürz. Es war zwar nicht viel billiger, aber erschwinglich, und wurde so – in Pfefferkuchen, Spekulatius, Glühwein, Lebkuchen – Teil des Weihnachtsfestes.

An den gelben, fünfzähligen Blütenblättern kann man erkennen, dass die Nelkenwurz zu den Rosengewächsen gehört.

Nach dem Verblühen bildet sich ein Fruchtstand aus vielen kleinen Nüsschen, deren Griffel hakenbewehrt sind, sodass sie sich durch vorbeistreichende Tiere verbreiten können.
Da das Aroma der Wurzel unseres Waldkräutleins identisch mit dem der Gewürznelke ist, wurde es von da an auch Nelkenwurz, Nägelewurz, Buschnelkenwurz oder Mauernelkenwurz, alemannisch Nägeli, niederdeutsch Negelken und niederländisch geel nagelkruid (gelbes Nagelkraut) genannt. Wir sehen, dieser Name ist gar nicht so alt, er geht höchstens auf das 16. Jahrhundert zurück.46
Eine ältere Benennung der Pflanze ist Benediktenkraut. Man könnte das als »gesegnetes« Kraut deuten, weil im Lateinischen benedictus »gesegnet« heißt, aber der Name bezieht sich auf eine historische Persönlichkeit, auf Sankt Benedikt (480–547 n. u. Z.). Was das Christentum angeht, ist dieser Heilige ein echtes Schwergewicht. Schon dass sein Namenstag auf den 21. März, die Frühlings-Tagundnachtgleiche, fällt, unterstreicht das. Der Asket, der sich zur Läuterung auf Dornen wälzte, gründete in der sich auflösenden Spätantike auf einer Bergspitze, wo zuvor ein heidnischer Apollo-Tempel gestanden hatte, das allererste Kloster der westlichen Welt. In diesem Kloster, der Abtei Montecassino, 150 Kilometer südlich von Rom gelegen, herrschten äußerst strenge Regeln. Ora et labora, »bete und arbeite«, war der Leitspruch.
Nicht nur Römer nahm Benedikt als Mönche auf, sondern auch Germanen und Kelten. Es waren auch nicht nur ältere Männer auf der Suche nach dem Seelenfrieden – oft wurden Kinder47 hinter die Klostermauern gesteckt, hungrige Mäuler, die man in armen Familien nicht durchfüttern konnte, oder Sühneopfer für Missetaten, die ein Sippenmitglied ausbaden musste. Die Kelten nannten dieses ein »weißes Opfer«, im Gegensatz zu einem blutigen »roten Opfer«.

Den Namen Benediktenkraut hat die Nelkenwurz in Erinnerung an den heiligen Benedikt bekommen, aus dessen Giftbecher das Gift in Form einer Schlange herausgekrochen kam.
Für die schwarze Kutten tragenden Mönche war das Klosterleben eine Qual, das Essen war karg, die Schlafstätte bestand aus harten Brettern, die Arbeit war erschöpfend. Die Folge war eine – auch für damalige Zeiten – kurze Lebenserwartung. Mehrmals rebellierten die Mönche gegen ihren gnadenlosen Zuchtherren, den Abt Benedikt. Mehrmals versuchten sie, ihn zu töten, einmal mit vergiftetem Brot, aber ein Rabe kam und trug das Brot fort. Ein anderes Mal taten sie tödliche Gifte – Eisenhutsaft, Arsen und dergleichen – heimlich in den Messwein und warteten darauf, dass ihr Peiniger während des Sakraments einen Schluck trank und dann jämmerlich krepierte. Aber dank seiner Heiligkeit geschah ein Wunder. Das Gift ballte sich in Form einer Viper zusammen und kroch aus dem Messkelch.48 Eine Giftschlange, die sich über den Rand eines Kelches windet, ist noch immer ein Attribut dieses Heiligen.
Warum erzähle ich diese Geschichte so ausführlich? Weil sie ein Schlüssel zum Verständnis der mittelalterlichen Kräuterheilkunde ist. Alle Heilpflanzen wurden damals einem Heiligen oder einer Heiligen geweiht. Aufgrund der Legende schrieb man alle giftausleitenden Kräuter dem heiligen Benedikt zu. Diese sind vor allem leberentgiftende Kräuter, etwa die Benediktendistel (Carduus oder Cnicus benedictus), die Silberdistel, die Artischocke und vor allem die Nelkenwurz. Sie würden das Gift zusammenballen und wie beim besagten Abendmahlkelch aus dem Körper ausleiten. Die damaligen Ärzte schauten immer, welcher Heiliger in der jeweiligen Pflanze wirkt, so wie wir heute schauen, welche Wirkstoffe – Glykoside, Alkaloide, Terpene, Säuren und dergleichen – darin enthalten sind. In der Renaissance wiederum suchte man den Planeten, der in einem Medizinkraut wirkt. Bei der Nelkenwurz wäre das – nach Nicholas Culpeper – der Jupiter, der ja auch für die Leber und deren Entgiftung zuständig ist.
In ganz Europa wurde die Nelkenwurz diesem strengen Heiligen geweiht. In England heißt sie wood avens oder goldy star of the earth (goldener Stern der Erde), sie ist aber auch unter den Namen Herb Bennet oder St. Benedict’s herb bekannt; in Frankreich ist sie benoît commune und herbe de Saint Benoît; in Spanien hierba Bennet oder hierba de San Benito, und so geht es weiter in anderen europäischen Sprachen. Selbstverständlich wurde eine dermaßen heilige Pflanze von den Mönchen und Nonnen in den Klostergärten fleißig angebaut und fand ihren Weg in die »geistigen« Getränke, in Liköre, wie etwa den Benediktiner Kräuterschnaps, der bei den Klosterbrüdern und -schwestern so beliebt war.
Die außergewöhnlich heilige Pflanze habe, glaubte man, auch die Fähigkeit, alle Dämonen und alles Zauberblendwerk zu vertreiben und zunichtezumachen. Im Gart der Gesundheit (Mainz 1485), dem ersten Heilkräuterbuch in deutscher Sprache, heißt es von der Benedictenwortz: »Wo die Wurzel sich im Haus befindet, kann Satan nichts ausrichten« und: »Wenn ein Mann dieses Kraut bei sich trägt, wird kein giftiges Tier ihn beißen.« In katholischen Gebieten bereitete man aus den Wurzeln gerne ein antidämonisch wirkendes Pulver zu, das »Malefiz-Pulver«. In Frankreich wird die Nelkenwurz gelegentlich herbe du bon soldat (»Kraut des guten Soldaten«) genannt. Diese guten Soldaten waren Ausübende der »weißen Magie«, sie waren Exorzisten, die die Pflanze benutzten, um den Teufel zu verjagen.
...
»Dem St. Benediktskraut hat der Schöpfer die Kraft gegeben, alles aus Augen, Nase, Zähnen, Gehirn und vom Herzen zu vertreiben, was nicht hingehört; es heilt Augenweh, Kopfweh, Zahnweh, Nasenkatarrh, auch Durchfall, stärkt das Herz wundersam und macht frohmütig«, schreibt der Gartenliebhaber Jürgen Dahl (Dahl 1999: 353).
...
Märzwurzel ist ein weiterer Name der Pflanze, die man am 21. März, dem alten49 Tag des heiligen Benedikt, sammeln sollte. Das Datum macht durchaus Sinn, denn in diesem Monat ist die Kraft noch in den Wurzeln konzentriert, da das Kraut noch nicht ausgetrieben ist.
Manneskraft ist einer der mittelalterlichen Namen, man benutzte die Wurzel bei Erschöpfungszuständen. Waldklette oder Igelkraut heißt es wegen den spröden, stacheligen Borsten des Fruchtstands, die sich in Tierfellen, in den Socken und Beinkleidern festhaken. Johanneswurzel nennt man sie, da die Pflanze um den Johannistag am 24. Juni am üppigsten blüht. Der Name Weinwurz deutet an, dass man in der Klostermedizin – auch bei Hildegard von Bingen – den Wurzelstock in Wein mazerierte.
Wegen der hochwertigen Gerbstoffe, die zusammenziehend und keimtötend wirken, hieß die Pflanze bei den Bauern auch Heil-aller-Welt oder Heil ‘n Arsch. Die Benennung Sanamundenkraut oder Sanamunda – vom lateinischen sanare (»gesund«) und mundare (»reinigend«) – geht wiederum auf die Klostermedizin zurück.
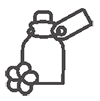
Schon Hildegard von Bingen verkündete, die gesegnete Nelkenwurz stärke Haupt und Gehirn und erquicke das Herz, sie werde zum »Entflammen der Liebe« empfohlen und auch der Wein würde mit Nelkenwurz einen edleren und lieblicheren Geschmack annehmen. Mit Liebe meinte die fromme Äbtissin aber wohl eher die geistige als die sinnliche Liebe.
In der Volksheilkunde gilt der aromatische Wurzelstock wegen der enthaltenen Gerbstoffe noch immer als probates zusammenziehendes, blutstillendes und keimhemmendes Mittel. Er findet Anwendung als Gurgelmittel bei entzündetem Zahnfleisch, bei Zahnweh, als Sitzbad oder Badezusatz bei Hämorrhoiden, Frostbeulen, Hautkrankheiten und Geschwüren und, innerlich, bei Durchfällen und Ruhr.
Um die Gerbstoffwirkung zu optimieren, sollten die Wurzeln drei bis vier Minuten geköchelt werden – also nicht nur überbrüht wie ein Tee oder zu lange gekocht wie ein Dekokt.
Wegen des ätherischen Nelkenöls wirkt ein Tee aus der zerkleinerten Wurzel anregend, nervenstärkend und als ein kräftigendes Tonikum in Zeiten der Rekonvaleszenz.
Die enthaltenen Bitterstoffe machen die Nelkenwurz zum probaten Mittel bei Stoffwechselstörungen und bei Leber- und Gallenstau. Lange galt sie auch als Fiebertonikum, ähnlich wie die bittere Chinarinde. Der berühmte Arzt der Goethezeit, Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836), verschrieb die pulverisierte Wurzel bei »typhösem« Wechselfieber, Leberleiden und Brustbeschwerden.
Rudolf Steiner erklärte, die Nelkenwurz bringe, wie viele Rosengewächse, strenge Ordnung in das wuchernde ätherische Geschehen im Leib. Mit ihren Gerbstoffen und dem ätherischen Öl »regt sie die Ich-Organisation im Stoffwechselgebiet an und durchwärmt den Unterleib.«

Der wirkstoffreichste Teil der Nelkenwurz ist, wie der Name schon sagt, die Wurzel. Wegen ihrer entgiftenden Wirkung heißt sie auch „europäischer Ginseng“.
Wenn man heftige Zahnschmerzen hat, etwa aufgrund einer Zahnmarkentzündung (akuter Pulpitis) oder Zahnfleischentzündung (akuter Parodontitis), und nicht gleich zum Zahnarzt gehen kann, dann ist man gut beraten, eine Gewürznelke zu kauen. Einer der wichtigsten Wirkstoffe in der Gewürznelke ist Eugenol, ein ätherisches Öl. Das Nelkenöl wirkt betäubend, schmerzstillend, entzündungshemmend, antibakteriell, antiviral und pilzhemmend. Innerhalb weniger Minuten tötet es Salmonellen, Staphylokokken und Candida-Pilze ab.
Alles, was die Gewürznelke kann, kann die einheimische Echte Nelkenwurz auch. Auch sie enthält in den ausdauernden Wurzelstöcken Eugenol. Aus eigener Erfahrung weiß ich, als ich bei heftigem Zahnweh die Wurzel kaute, dass sie gut hilft. Man sollte das aber nicht über einen langen Zeitraum machen, denn Eugenol kann bei längerer Anwendung die Schleimhaut und die Haut am Gaumen schädigen. Die verwandte Bachnelkenwurz enthält zwar wertvolle Tannine, aber weniger Eugenol und ist deswegen weniger wirksam.
Wer schon einmal beim Zahnarzt eine Wurzelbehandlung über sich ergehen lassen musste, wird den Geschmack des Eugenols gut kennen. Denn das ätherische Öl wird in das Loch geträufelt, um sämtliche Keime abzutöten.
Das kostbare Nelkenöl wehrt auch Stechinsekten ab. In Gegenden, in denen es Borreliose übertragende Zecken gibt, kann man die Haut prophylaktisch mit einigen wenigen Tropfen dieses ätherischen Öls einreiben. Man kann auch Mücken- und Wespenstiche damit behandeln, sodass sie weniger anschwellen und weniger jucken. Auch gegen Milben hilft diese Essenz. Ein heißes Fußbad mit etwas Eugenol soll vorbeugend bei Erkältungen wirken. Eugenol hilft gegen Pilzbefall von Samen, die man über den Winter für Äcker und Gärten aufbewahrt.
Nelkenöl sollte nicht während der Schwangerschaft verwendet werden.
Sepp Ott, der 2012 verstorbene Mitbegründer und Vorsitzender des Gesundheitsvereins Vitalia, war als »Stadtwildkräuterführer« – so nannte sich dieser Meister der Heilkräuterkunde selber – in München wohlbekannt. Seine mehrstündigen Stadtkräuterwanderungen führten meistens die kurze Strecke von einer U-Bahn-Station zur anderen. Viel Lustiges hatte er über die Stadtunkräuter – »alles Heilkräuter!« – zu erzählen, nur musste man der bayerischen Mundart kundig sein, um ihn zu verstehen. Einmal bemerkte ich gegenüber Sepp, es sei doch merkwürdig, dass sich diese Pflanze in der heutigen Zeit immer mehr ausbreite.
»Warum wohl?«, fragte der Kräutermeister zurück. »Mutter Natur hat der Pflanze den Marschbefehl gegeben, weil die heutigen Menschen sie bitter nötig haben! Noch nie war unsere Umwelt, die Luft, das Wasser und unsere Lebensmittel, mit so vielen Chemikalien und Schadstoffen verseucht. Die Nelkenwurz regt die Leber an und wirkt entgiftend in unserem Organismus!«
Das war mir damals neu. Bisher hatte ich die Nelkenwurz lediglich als hervorragende Gerbstoffdroge gekannt, weshalb sich die Wurzel, kurz aufgekocht, sehr gut bei Darmkatarrh und Kolik, bei Entzündungen des Rachenraums, bei Zahnfleischblutungen und als Badezusatz bei Hämorrhoiden und Hautausschlägen bewährt hat. Dass sie aber der Leber beim Entgiften helfen solle, war mir nicht bekannt gewesen. Für Sepp Ott war die Nelkenwurz der »europäische Ginseng«. Sie helfe auch bei Herz- und Kreislaufbeschwerden, fügte er hinzu.
_______
NELKENWURZABKOCHUNG
_______
1 TL zerkleinerte getrocknete Nelkenwurz-Wurzel mit 250 ml Wasser zum Kochen bringen und 3-4 Minuten leise kochen lassen. Abseihen und abkühlen lassen.

Die ganz jungen Blätter lassen sich im Salat verwenden, sie können aber auch wie Spinat gekocht werden. Der bekannte und begeisterte Gärtner Jürgen Dahl schreibt dazu: »Mir schmeckt das Gemüse, in Pfannkuchen eingewickelt, sehr gut. Seit ich es kenne, darf die Nelkenwurz sich selber aussäen (was sie bereitwillig tut) und wird nicht mehr gejätet, sondern geerntet.« (Dahl 1999: 354).
Die kleinen, gelben Blüten der ungiftigen Pflanze eignen sich als Salatdekoration.
Einst wurde die Jupiterpflanze – dieser Planetengott ist ja auch für Bier und andere alkoholische Getränke zuständig – anstatt Hopfen als Würze ins Bier getan. Sie kam ins Augsburger Weizenbier und wurde deswegen sogar feldmäßig angebaut. Nelkenwurz verleiht einen guten Geschmack und verhindert das Sauerwerden des Gebräus.
Zu guter Letzt noch ein Tipp zur Aufbewahrung der Wurzel: Man lege sie nie in eine Blechschachtel, da sie mit dem Metall eine chemische Wechselwirkung eingeht.

(Salvia glutinosa)
JUPITERS LICHTFACKEL
Salbeiblüten tief im Wald, zitronengelb,
mit weit aufgerissenem Rachen,
wie edelsteinfunkelnder Morgentau
im Frauenmantelblatt,
wie Glühwürmchen, Feuersalamander
und andere solche Sachen,
die Menschenkindern Freude machen.
WOLF-DIETER STORL
Es war eine richtige Freude für mich, diese Salbeiart hier in einer Schlucht, nicht weit von unserem Haus, zu entdecken. Zuerst faszinieren die großen, drei bis vier Zentimeter langen, hellgelben, zygomorphen Blüten, die man im tiefschattigen Wald kaum erwartet. Wenn man genau hinschaut, sind die gelben Blüten mit kleinen, rotbraunen Pünktchen besprenkelt. Diese Blüten haben – wie es sich für Salbeiarten gehört – einen weit aufgerissenen Rachen. Sie sind in Quirlen zusammengefasst und umfassen den bis zu einem Meter hohen, vierkantigen Stängel. Wenn man die Blüten berührt, merkt man, dass sie beziehungsweise ihre Blütenkelche mit klebrigen Drüsenhaaren besetzt sind. Führt man dann die Finger zur Nase, kommt die nächste Überraschung: ein wunderbarer zitronenartiger Duft entströmt ihnen. Nimmt man sich Zeit, etwas länger mit dem Klebrigen Salbei zu verweilen, merkt man, dass er einem guttut, dass er eine angenehme Ausstrahlung hat. Er zieht – das sagten mir Kräuterfrauen – die guten Waldgeister an.
Das Areal dieses Lippenblütlers erstreckt sich von den Wäldern Sibiriens und dem Himalaja bis nach Europa. In den Bergen wächst er bis auf rund 1800 Metern Höhe. Allerdings liebt er den Schatten oder zumindest den Halbschatten und braucht frischen, feuchten Boden.
Der Klebrige Salbei blüht im Hochsommer und wird von Bienen und Hummeln, hauptsächlich aber von Hummelarten mit ihren langen Rüsseln bestäubt. Andere Insekten klauen einfach den Nektar, indem sie die Blüte an der Seite aufbeißen, ohne sich durch Bestäubungsdienste zu bedanken. Wenn die Hummeln in den weit geöffneten Rachen eindringen, lösen sie einen Hebelmechanismus der Staubblätter aus – einen »Schlagbaumeffekt« –, wobei der Pollenstaub dem Tierchen auf den Rücken getupft wird. In einem späteren Blühstadium streckt sich unter der Oberlippe ein langer Griffel hervor, der den von einem Insekt mitgebrachten Blütenstaub von dessen Rücken abstreift. Im Ganzen ist das eine fein ausgeklügelte Weise, die Fremdbestäubung zu gewährleisten.
Und was hat es mit den klebrigen Drüsenhaaren auf sich? Einige Biologen meinen, es sei ein Schutz gegen kleine Insekten, die den Nektar stehlen wollen, ohne dabei die Blüte zu bestäuben. Andere sind der Ansicht, dass die reifen Klausen50, die einsamigen Teilfrüchte, an den Fellen vorbeistreifender Tiere hängen bleiben und sich so besser verbreiten.

Die lichtgelben Lippenblüten des Klebrigen Salbeis sondern eine Flüssigkeit ab, die einen herrlichen Zitronenduft verströmt und damit die guten Waldgeister anzieht.
Der offizielle Name der Gattung Salvia – von lateinisch salvus = »gesund« – bedeutet schlicht Heilpflanze. Und wenn es in den berühmten Merksprüchen aus der mittelalterlichen Ärzteschule in Salerno51 heißt: »Warum sollte der Mensch sterben, in dessen Garten Salbei wächst?«52, dann ist nicht unbedingt der Gartensalbei gemeint, sondern die Heilpflanze an sich.
Glutinosa, der spezifische Name, heißt »klebrig, voller Leim«. Das kommt auch zum Ausdruck in dem umgangssprachlichen Klebkraut oder Leimsalbei.
Auch Gelber Salbei heißt er manchmal; Gelbes Scharlachkraut in einigen Schweizer Gemeinden, wobei Scharlachkraut sonst der Muskatellersalbei (S. sclarea) ist.
Flohkraut ist eine Bezeichnung aus Österreich, Oberbayern und Tirol; Flöhchrut ist der Name in Bern. Er rührt daher, dass die blühenden Pflanzen einst zu Besen gebunden wurden, mit denen man die Schlafkammerböden fegte. Man hoffte, die Flöhe würden daran kleben bleiben. Aus demselben Grund legten sich die Holzknechte in Oberbayern das frische Flohkraut ins Stroh der Bettgestelle. Man glaubte, auch der kampferartige Duft würde das lästige Ungeziefer vertreiben.
Hirschbrunst ist eine in Oberbayern häufige Bezeichnung für den Klebrigen Salbei. Die Pflanze fühlt sich in den Wäldern wohl, in denen der Hirsch zu Hause ist, und angeblich frisst er auch gerne an ihr. Die kompetente Kräuterfrau Astrid Süßmuth, die selber aus Oberbayern stammt, bringt das Kraut mit dem keltischen Hirschgott Cernunnos in Zusammenhang. Die hirschgeweihtragende Gottheit galt als die Sonne in der Tiefe und als Herr der Tiere. Er verkörperte die Vitalität des Waldes und den Reichtum der Natur.
Für die Römer war Jupiter der Götterkönig und Herr allen Reichtums, und auch zu dieser Gottheit besteht bezüglich dieser Pflanze ein flüchtiger Bezug. Der flämische Botaniker Carolus Clusius (1526–1609) – er führte die Rosskastanie, die Tulpe und die Kartoffel in Wien ein – nannte den klebrigen Salbei Colus Jovis, also »Jupiters Spinnrocken«. Auch im Englischen ist der gebräuchlichste Name der Pflanze (neben sticky sage = Klebriger Salbei) Jupiter’s distaff (Jupiters Spinnrocken). Merkwürdig. Die gelbe Farbe der Blüte ist durchaus eine Signatur des Jupiters. Aber was hat der Jupiter mit der Kunkel oder dem Spinnrocken zu tun, wobei das doch eindeutig ein Frauensymbol beziehungsweise das Zepter der schicksalsspinnenden Göttin, der Holda/Percht ist? Ich will da nicht spekulieren. Mit dem Spinnrocken konnte gezaubert werden.53 Und es hieß einst, mit dem Klebsalbei wäre es möglich, Flüche aufzulösen.
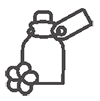
Relativ wenig ist über die Heilkraft des Klebrigen Salbeis berichtet worden. Im Alpenraum wurde er vor allem angewendet bei allen Arten von Magen-Darm-Beschwerden. Die Wirkstoffe – Rosmarinsäure, ätherische Öle, Flavone und Phenole – lassen eine antibakterielle, antivirale, entzündungshemmende und pilzwidrige Wirkung des Tees oder der Tinktur vermuten.

Der Klebrige Salbei ist nicht giftig. Aber er ist auch kein so tolles Wildgemüse. Man könnte lediglich die Triebspitzen als Würze in Speiseölen, Suppen, Kartoffelmus und Eintöpfen verwenden. Auch in Salate, Kräuterbutter und Quark kann man sie sparsam mischen (Dreyer 2010: 255). Die getrockneten jungen Blätter und die Blüten könnte man in kleinen Mengen mit in den Kräutertee tun oder zum Aromatisieren dem Wein oder dem Rauchtabak beimischen.
Astrid Süßmuth verrät uns noch eine Rezeptur aus den bayerischen Bergen: Semmelknödel mit Klebsalbeiblüten passen gut zum Hirschragout.
Extra
Salbeiarten

Die bei uns bekannteste Salbeiart ist der Gartensalbei, der sowohl in der Küche als auch als Heiltee eingesetzt wird.
Der Klebsalbei gehört zur Gattung Salvia, der zwischen 850 und 900 Arten angehören, zum Beispiel folgende:

Der heimische Wiesensalbei mit seinen hübschen, leuchtend blauen Blüten ist vor allem bei Hummeln und Bienen beliebt.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu sagen, dass die indigenen Völker Nordamerikas ansonsten nicht mit Salbeiarten (Salvia spp.) räucherten – die Gattung ist in der nordamerikanischen Flora kaum vertreten –, sondern mit verschiedenen Beifußarten (Artemisia spp.), die im amerikanischen Englisch fälschlicherweise als Sage (= Salbei) bezeichnet werden.

(Gnaphalium sylvaticum)
WALDZWERG IM GRAUEN FILZMANTEL
Das Waldruhrkraut ist ein 10 bis 40 Zentimeter hoher, ausdauernder, aufrecht stehender Korbblütler, der durch sein hellgraues, filziges Blattwerk und seinen ährenförmigen Stängel auffällt. Er ist besetzt mit kleinen, braun-weißen Rohrblüten, die vom Juli bis September blühen. Die kurzstieligen Blätter sind lanzettlich geformt, oben kahl oder schwach flaumig und auf der Unterseite filzig. Das Ruhrkraut ist ein Verwandter von Strohblumen, Katzenpfötchen und Filzkräutern, von denen sich viele für Trockensträuße eignen. Auch mit dem Edelweiß ist das Ruhrkraut nah verwandt.
Das kleine Kraut wächst zirkumpolar, von Eurasien bis ins östliche Nordamerika. Sein bevorzugtes Habitat sind Waldwege, Moore, Kahlschläge und trockene Nadelbaumwälder.
Der wissenschaftliche Name Gnaphalium kommt vom griechischen gnaphalon und bedeutet »Wollsträhne« – ein Name, der sich auf die feine Behaarung bezieht, die das kleine Kraut bedeckt. Der spezifische Name sylvaticum deutet auf den Standort im Wald (lateinisch silva) hin.
Der allgemein bekannte Name Ruhrkraut bezieht sich auf die volksheilkundliche Anwendung bei der Ruhr. Im Englischen heißt die Pflanze heath cudweed, wobei cud wiedergekäutes Futter bedeutet. Die Franzosen nennen sie gnaphale des bois, die Niederländer bosdroogbloem, also »Waldtrockenblume«, ähnlich im Dänischen rank evighedsblomst, »Aufrechte Ewigkeitsblume«. Stopp-mer-s‘-Loch heißt sie in der Mundart nahe Pirmasens mit Bezug auf die stopfende Wirkung der Pflanze.
Galt-Chrut nennen die Senner in der Nordostschweiz und in Vorarlberg das Ruhrkraut, wobei das mundartliche galt »keine Milch gebend« bedeutet. Galtvieh nennt man junge Rinder vor der Geschlechtsreife oder Kühe, die aufgrund ihres Alters oder, weil sie trächtig sind, keine Milch geben. Oft sind dem Milchvieh die ertragreichen Weiden vorbehalten, galte Tiere werden auf mageren Weiden gehalten. Was das Ruhrkraut betrifft, so heißt es, wenn eine Kuh davon nur eine Handvoll fresse, gebe sie mehrere Tage keinen Tropfen Milch mehr. Neidkraut hieß die Pflanze im Böhmerwald, dort glaubten die Bauern auch, dass die Kühe keine Milch mehr geben, wenn sie das Kraut fressen, so, als seien sie »verneidet« oder verhext worden. Im ländlichen Aberglauben verwendete man Neidkräuter wie die Haselwurz oder auch die Nelkenwurz gegen das »Verneiden« durch neidische Nachbarn, in diesem Fall jedoch ist es die Pflanze selber, die den negativen Zauber auslöst.
Wald-Immortelle, Katzenpfötchen und Falsches Edelweiß sind weitere Namen, die dem Waldruhrkraut gegeben wurden. Diese Bezeichnungen nehmen jedoch vor allem auf die filzig-weißen Blätter Bezug, denn die Blüten geben ja eigentlich keinen Anlass zur Verwechslung.

Wegen seiner weißfilzigen Blätter wird das Waldruhrkraut auch Wald-Immortelle oder Falsches Edelweiß genannt.
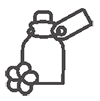
Im Namen liegt das Wesen. Mit anderen Worten: Man suchte das tanninhaltige, adstringierende Waldkraut bei Durchfall, Diarrhöe, und eben der Ruhr. Das Kraut wird im Mai, also noch vor der Blüte, gesammelt. Es wurde als Tee oder als Dekokt – kurz aufgekocht – verwendet und als Umschlag bei entzündeten Wunden und Eiterbeulen.
Der englische Name chafeweed bezieht sich wahrscheinlich auf die wundheilenden Qualitäten des kleinen Korbblütlers, denn to chafe lässt sich mit »wundscheuern« übersetzen. Ein besonders starker Tee – zwei Teelöffel pro Tasse Wasser – soll, äußerlich angewendet, gegen Ausschläge und entzündete Wunden helfen. Dafür den Tee abkühlen lassen, bis er nur noch handwarm ist, ein Leinen- oder Baumwollläppchen damit tränken und als Umschlag auflegen.
In der heutigen Volksmedizin findet der Tee eher Anwendung bei Atemwegsproblemen, Katarrhen und – wegen der Gerbstoffe – bei Durchfällen. Auch bei Magengeschwüren soll eine Abkochung helfen.

Als essbare Pflanze ist das Waldruhrkraut bei uns praktisch unbekannt. In Japan jedoch hat es einen besonderen Status. Es gehört zu den besonderen Kräutern, die in dem traditionellen jahreszeitlichen »Fest der sieben Kräuter« (Nanakusa no sekku) mit Reisbrei rituell verspeist werden. Zu diesen Kräutern, die nicht in großen Mengen, sondern eher als Gewürze in den Brei kommen und die Langlebigkeit und Gesundheit vermitteln sollen, gehören:
Das Fest wird am 7. Januar gefeiert, mit Wildkräutern, die noch im Winter zu finden sind. Das Fest hat sein Gegenstück im Herbst mit dem »Fest der sieben Blüten des Herbstes«.

Wie sein Name schon sagt, schätzt man besonders die adstringierende Wirkung des Waldruhrkrauts bei Durchfall oder eben der Ruhr.
Beim Ruhrkraut, das beim japanischen »Fest der sieben Kräuter« verzehrt wird, haben wir es offensichtlich nicht mit einer üblichen Nahrungspflanze zu tun, sie ist lediglich Bestandteil einer jahreszeitlichen Kultspeise. Sie gehört also nicht zu den Speisen des Alltags, sondern markiert einen Zeitpunkt im sakralen Kalender. Kultspeisen dieser Art kennt jede Kultur, sie gliedern den Jahreslauf. In unserem Kulturkreis ist es zum Beispiel die Neunkräutersuppe, die unsere heidnischen Vorfahren der Göttin des Lebens, Freya, weihten und die in der Gründonnerstagssuppe bis heute weiterlebt (siehe >). Eine weitere Kultspeise im Spätfrühling, zu Pfingsten, war Spargel; er wurde oft mit Rinderzunge gegessen, da an diesem Tag der Heilige Geist über die Apostel kam und sie, wie in der Bibel steht, »in fremden Zungen« redeten, also das Evangelium in allen Sprachen der Welt verkünden konnten. Die Engländer kennen den Rainfarnkuchen (tansy cake), der seit angelsächsischen Zeiten zum Fest der Frühlings-Tagundnachtgleiche genossen wurde. Bei dem Freudenfest wurde geschmaust und ausgelassen barfuß getanzt. Heute werden auf der Insel Rainfarnkuchen zum Osterfest verzehrt. Inzwischen ist man vorsichtig mit der Dosierung, denn Rainfarn enthält das Nervengift Thujon.
Zur Sommersonnenwende oder zu Johanni werden in Mitteleuropa noch immer Holunderblütendolden als Küchlein frittiert. Einst glaubte man, dass sie Kraft und Gesundheit verleihen. Derjenige, der am meisten davon isst, hieß es, würde am höchsten über das Sonnwendfeuer springen können, das wiederum würde den Lein und das Futtergras höher wachsen lassen. Jede Region hat ihre Kultspeisen, die der Zeit einen sakralen Rhythmus verleihen.

(Sanicula europaea)
MACHT DEN WUNDARZT ARBEITSLOS
Den Waldsanikel lernte ich erst kennen, als wir ins Allgäu zogen. Jedes Jahr, wenn in der Dorfschule unten im Tal Projekttage angesagt waren, fragte mich der Lehrer, ob ich mit den Kindern eine Kräuterwanderung im Wald machen würde. Und bei diesen Ausflügen war mindestens immer ein Bauernkind mit dabei, das unbedingt darauf bestand, ich solle ihm den »Saunigel« zeigen. Das hätte die Oma befohlen, es sei nämlich eines der wichtigsten Heilkräuter. Was gemeint war, war der Sanikel, welchen ich auch bald bestimmen konnte und im Laufe der Zeit sehr zu schätzen gelernt habe.
Der Sanikel gehört zur Familie der Doldenblütler (Apiaceae oder Umbelliferae), aber das erkennt man auf den ersten Blick nicht sofort. Wenn man die handförmig gelappten, bodenständigen Blätter anschaut, würde man meinen, man hätte den Kriechenden Hahnenfuß vor sich. Im Gegensatz zum Hahnenfuß glänzt die Unterseite der Blätter jedoch, als sei sie lackiert. Und wenn man ein Blättchen kostet, dann entdeckt man, dass es erfrischend und angenehm würzig schmeckt. Auch die weißen, selten rötlich angehauchten Blüten sehen für einen Schirmblütler ungewöhnlich aus: Es sind kleine, köpfchenförmige Dolden, die wie die Antennen von Außerirdischen auf den langen Stängeln aus dem Grün herausragen – so kommen sie mir wenigstens vor. Daraus entstehen kugelige Früchte, die sich, wenn sie reif sind, mit hakenförmigen Stacheln an das Fell vorbeistreifender Tiere heften.
Die einheimische Sanikelart wächst auf feuchten, kalkhaltigen Waldböden und ist in Sibirien, dem Kaukasus, Nordafrika und Europa zu Hause. Andere Mitglieder der Gattung – es gibt rund 40 Arten, davon die Hälfte in Nordamerika – finden sich in Ostasien und in der Neuen Welt.
Der Sanikel wurde zuallererst von Hildegard von Bingen unter dieser Bezeichnung erwähnt. Die Autoren der Antike kannten die Pflanze nicht. Der Name ist vom lateinischen sanare abgeleitet, was »heilen« bedeutet. Daraus wurde in verschiedenen ländlichen Regionen und Mundarten Sennikel, Saunigel (Voralberg, Westallgäu), Zaunickel, Zanniggele, Sanittle (Bern), Scharnikel, Zornigel, Kranickel und so weiter.
Vor allem aber bringen die volkstümlichen Benennungen die große Heilkraft dieses Doldenblütlers zum Ausdruck: Hoalblatt (Heilblatt) oder Fünfwundenkraut heißt es in Oberbayern, Heil aller Welt, Heil aller Schäden, Wundkraut, Heildolde, Heilkraut, (niederländisch heelkruid), Selbstheil (englisch self heal) und dergleichen sind die zahlreichen lokalen Namen.
Ein mittelalterlicher Name ist herba St. Laurentii, auch Sankt Laurentzenkraut; französisch herbe Saint-Laurent. Solche Namen stammen aus fernen Zeiten, als die Kirche die Heilkräfte der Pflanzen mit dem Heilwirken der Heiligen und Märtyrer verbinden wollte. Ein böser römischer Kaiser ließ der Überlieferung nach den Laurentius auf einem glühenden Rost »braten«, bis der Tod den heiligen Glaubenszeugen von seiner Pein erlöste. Seither wird er bei Brandwunden und heißen Fiebern angerufen. Die Idee dahinter ist, dass ein Heiliger angeblich das, was er erlitten hatte, auch heilen könne. Alle Kräuter, die bei Verbrennungen und Verbrühungen angewendet werden, wie etwa Günsel (Ajuga reptans) und eben der Sanikel, waren dem Laurentius geweiht.
Wegen der haftenden Früchte nennt man das Kräutlein gelegentlich auch Waldklette. Im Großen Walsertal (Vorarlberg) kennt man es als Tannilichruut und die Gälisch sprechenden Briten nennen es »Waldmännlein« (Bodan coille).

Der Waldsanikel oder »Heil aller Welt« wird schon seit Jahrhunderten gegen vielerlei Beschwerden eingesetzt (Holzschnitt aus: Gart der Gesundheit, 1485).
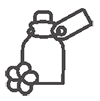
Überall, wo er wächst, gilt der Sanikel als mächtige Heilpflanze, auch in den abgelegenen Tälern des Westallgäus, Vorarlbergs und des Appenzells, jener Bergregion, in der sich das einfache Volk oft den Arzt nicht leisten konnte. Bei ihnen galt der Sanikel praktisch als Universalheilmittel. Vor allem bei inneren und äußeren Verletzungen, bei Geschwüren, alten Wunden, Hämorrhoiden und Quetschungen fand er Anwendung, entweder durch frisch zerstoßene Blätter oder durch Bäder und Umschläge mit dem Absud aus getrockneten Wurzeln und Blättern. In der Schweiz gibt es den Spruch:
...
Wer Günsel und Sanikel hat,
schlägt den Wundarzt mit einem Patt!54
...
Aber auch bei Magen- und Darmproblemen, Bronchitis, Husten, Erkältungen und Lungenleiden aller Art kommt der Sanikeltee infrage. Zur Mundspülung und als Gurgelwasser bei Gaumen- und Rachengeschwüren, wundem Zahnfleisch und Kehlkopfleiden leistet das Allheilmittel gute Dienste. Sogar bei Wackelzähnen kam die Pflanze in ländlichen Regionen zum Einsatz. Magengeschwüre, Blutspucken, Durchfall, Nieren- und Unterleibsblutungen, Weißfluss und zu starke Monatsblutung sind weitere ländliche Indikationen.
Der Name Bruchkraut deutet darauf hin, dass die Volksmedizin ihn zum Herstellen von Bruchpflastern verwendet. Wenn man ein in zwei Hälften geteiltes Stück Fleisch mit Sanikel koche, hieß es, dann wachsen die beiden Hälften im Topf wieder zusammen. Dasselbe sagte man übrigens auch von Beinwell oder Wallwurz (Symphytum officinale). Das ist natürlich eine krasse Übertreibung, aber wenn man die Sprache der Kräuterkundigen kennt, besagt das lediglich: »Diese Pflanze hilft wirklich!« Anthroposophische Mediziner drücken diesen Sachverhalt anders aus: Sanikel, wie auch Beinwell, regen den Ätherleib stark zu regenerativer Tätigkeit an und helfen dabei, den Körper mit gesunden Formkräften zu durchdringen. Unter Ätherleib oder auch Bildekräfteleib versteht man das geistige Modell (die Matrix) des Körpers, welche den physischen Leib vor dem Zerfall bewahrt.

Die Laubblätter des Waldsanikels ähneln denen des Kriechenden Hahnenfußes, glänzen an der Unterseite aber, als seien sie lackiert.
Wie sehr man noch immer an die Fähigkeit dieser Pflanze zur Knochenheilung glaubt, führte mir ein Bauer aus, der auf dem gegenübergelegenen Berg wohnt: »Ich hatte einen komplizierten Knöchelbruch. Die Ärzte waren mit ihrem Latein am Ende. Mit Saunigel konnte ich ihn jedoch vollkommen ausheilen.«
Gesammelt wird diese Heilpflanze im Spätfrühling, wenn sie gerade zu blühen anfängt. Die Blätter und auch die Wurzeln werden getrocknet und als Teeaufguss – ein Teelöffel pro Tasse – eingenommen. Kräuterpfarrer Künzle lässt das Sanikelkraut samt Wurzel in den Sommermonaten ausgraben und mit einer Zugabe von Honig und Süßholz zu einem Heiltrunk kochen. Für den Winter empfiehlt er den Tee aus dem Pulver der gedörrten Pflanze.
Nicholas Culpeper empfiehlt ein Dekokt des Pulvers oder auch den frischen Saft der Pflanze, um schädliche Säfte (Humore) aus dem Körper zu vertreiben. Er stellt Sanikel unter die Herrschaft des Mars. Diese Zuordnung erfolgt wahrscheinlich, weil Mars mit Verwundung und Wundheilung zu tun hat.
In den nordamerikanischen Wäldern wachsen verschiedene Sanikelarten (S. marilandica; S. canadensis), die unserem einheimischen Sanikel ähneln. Im amerikanischen Englisch werden sie snake root (Schlangenwurzel) genannt, da die Indianer die gekochte, zerstampfte Wurzel als Breiumschlag (Kataplasma) bei Schlangenbiss verwendeten. Aber auch bei Problemen mit der Periode, Lungen- und Nierenleiden, Rheuma und Geschlechtskrankheiten benutzten die verschiedenen Stämme diese »Schlangenwurzel«.