4.5.2 Beteiligung der Mitarbeiter
Qualifizierung und Zufriedenheit der Mitarbeiter sollten in ein gesundes Betriebsklima eingebettet sein mit einem umfassenden betrieblichen Informationswesen. Das interne Berichtswesen z. B. beinhaltet Informationen über neue Entwicklungen, Ereignisse und betriebsinterne Entscheidungen. Durch Information, Motivation und Qualifikation der Belegschaft wird eine „offene und lernfähige“ Organisation geschaffen. Die Mitarbeiter müssen fähig und bereit sein zum Lernen und die Lernpotenziale müssen durch die Organisation aktiviert werden in Form von
-
Mitarbeitermotivation,
-
Personalentwicklung (Fort- und Weiterbildungen),
-
interner Kommunikationskultur und Berichtswesen sowie
-
dem Aufspüren von Problemstellen und deren Bearbeitung/Beseitigung.
Merke
In dieser mitarbeiterorientierten Organisationsform nehmen die Mitarbeiter aktiv am Geschehen teil. Ihnen wird ein Mitspracherecht eingeräumt bei geplanten Veränderungen oder anstehenden Entscheidungen. Dies gilt v. a. für Entscheidungen, die sie selbst betreffen („Betroffene zu Beteiligten machen“).
Wird dieses Prinzip nicht verfolgt und werden Entscheidungen und Veränderungen den Mitarbeitern einfach „auferlegt“, steigt der Widerstand gegen Veränderungen. Die Mitarbeiter haben persönliche Vorbehalte gegen die Entscheidungen, da sie sich nicht mit den Entscheidungen identifizieren und ihre eigenen Interessen darin nicht vertreten sehen. Hierdurch wächst der Unmut über den eigenen Arbeitsplatz und die Mitarbeiter verlieren die Freude an ihrer Arbeit. Dies kann sich in erhöhten Fehlzeiten niederschlagen, die Mitarbeiter machen nur noch „Dienst nach Vorschrift“. Ihnen fehlen das berufliche Engagement, das Vertrauen in den Arbeitgeber und die Motivation (Hokenbecker-Belke 2006).
4.5.3 Optimierung und Systematisierung der Arbeitsabläufe
Neben der Beteiligung der Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen sollten die Arbeitsbedingungen und Arbeitsabläufe optimiert werden. Vorteilhaft sind in dieser Hinsicht klare Stellenbeschreibungen und klare Arbeitsanweisungen. Durch die Anwendung von Standards werden Tätigkeiten innerhalb eines Handlungsprozesses gebündelt. Qualifikation und Spezialisierung der Mitarbeiter gewährleisten eine ganzheitliche Aufgabenerfüllung und erhöhen die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter.
Für die organisationsbezogenen Entwicklungen empfiehlt es sich, die Einrichtung in überschaubare autonome Organisationseinheiten zu unterteilen und hierbei die Entscheidungsbefugnisse auf die tiefstmögliche Ebene zu delegieren, sodass der jeweilige Mitarbeiter seinen maximalen Handlungs- und Entscheidungsspielraum ausschöpfen kann. Zudem sollte großes Augenmerk darauf gelegt werden, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern (z. B. in gemeinsamen Projektgruppen, Qualitätszirkeln, Fallbesprechungen und innerhalb der Neugestaltung von Arbeitsprozessen).
4.6 Pflegediagnosen
Wenn Sie Ihre ersten Einsätze in verschiedenen ▶ Handlungsfeldern der Pflege absolviert haben, dann wird Ihnen das Wort „Diagnose“ schon öfter begegnet sein. Ohne eine eindeutige Diagnose fällt es schwer zu entscheiden, welche Maßnahmen und Therapien angewendet werden sollen und ob die Bemühungen Erfolg haben werden. Wir benötigen also Diagnosen als Ausgangspunkt für weiteres Handeln.
Das ist im Prinzip nichts Neues und auch nichts, das nur in der Medizin Anwendung findet. Wenn Sie mit Ihrem Auto in die Werkstatt fahren, weil der Motor bockt, dann wird auch zunächst versucht, eine Diagnose zu erstellen, die Ihnen sagt, was denn an Ihrem Gefährt möglicherweise defekt ist (und was die Reparatur wohl kosten wird). Sind Ihre Haare trotz vieler Mühen glanzlos und fahl, erhoffen Sie, von Ihrem Friseur eine Diagnose zu erhalten und die richtigen Empfehlungen für die weitere Pflege Ihres Haarschopfes.
In diesem Kapitel soll es um den Begriff der Diagnose, genauer den der Pflegediagnose gehen. Das scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich und bedarf der näheren Begründung, waren praktisch Pflegende doch bisher i. d. R. nur mit medizinischen Diagnosen konfrontiert. Warum soll es nun auch noch Pflegediagnosen geben? Und was ist der Unterschied zwischen medizinischen Diagnosen und Pflegediagnosen?
Alles das wird in diesem Beitrag geklärt. Und noch einiges mehr. Sie lernen verschiedene Diagnosesysteme kennen, wissen am Ende des Kapitels (hoffentlich), was eine Klassifikation ist, wozu man Diagnose- und Klassifikationssysteme benötigt, welche Vor- und Nachteile sie möglicherweise haben und was eine „verstehende Diagnostik“ bedeutet.
4.6.1 Grundlagen und Begriffserläuterungen
Die Bedeutung von Pflegediagnosen ergibt sich u. a. aus den z. T. neuen und großen Herausforderungen, die die Pflege zu bewältigen hat. Zu nennen sind hier stichwortartig:
-
die demografischen Veränderungen mit der Zunahme alter Menschen und damit vermehrter Pflegebedürftigkeit
-
die Veränderungen im Krankheitsspektrum (vermehrtes Auftreten chronischer Erkrankungen und damit erhöhter Unterstützungs-, Beratungs- und Anleitungsbedarf, z. B. bei demenziell erkrankten Menschen)
-
die immer kürzeren Verweildauern im Krankenhaus und damit einhergehend die Verdichtung von Arbeitsprozessen
-
der ökonomische Druck, der zur umstrittenen Einführung von medizinischen ▶ Fallpauschalen (DRGs) zur Abrechnung im Krankenhaus geführt hat, in denen die pflegerischen Leistungen nicht oder nur unzureichend abgebildet werden
-
die Forderung nach Legitimation von Pflege und damit die Darstellung pflegerischer Leistungen
-
die Einführung von EDV-basierter Dokumentation (elektronische Patientenakte, Patienten-Daten-Management-Systeme = PDMS)
In einem in der Pflegewissenschaft berühmt gewordenen Satz haben 2 Autorinnen die Gründe für die Entwicklung und Einführung von Pflegediagnosen folgendermaßen ausgedrückt: „If we cannot name it, we cannot control it, finance it, research it, teach it, or put it into public policy“ (Clark u. Lang 1992, ▶ Abb. 4.30).
Pflegediagnosen.
Abb. 4.30 Was wir nicht benennen können, können wir auch nicht kontrollieren, finanzieren, erforschen, lehren oder anwenden.
(Foto: K. Oborny, Thieme)

4.6.1.1 Prozess der Diagnosestellung
Zum professionellen Handeln gehört das Lösen menschlicher Probleme, das ist in der Pflege nicht anders als in der Medizin oder auch in anderen helfenden Berufen wie Sozialarbeit, Psychologie, Behindertenpädagogik. Die Legitimation professioneller Arbeit ergibt sich durch die Zuständigkeit für einen bestimmten Bereich, in unserem Fall der Pflege. Der Anspruch für die Zuständigkeit beinhaltet, ein bestimmtes Problem zu durchdenken und Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt aber nichts anderes, als die folgenden 3 Schritte auszuführen (vgl. Cassier-Woidasky 2007):
-
Stellen einer Diagnose
-
Ziehen einer Schlussfolgerung
-
Durchführung der Behandlung
Ein Beispiel aus dem Alltag soll das veranschaulichen.
Fallbeispiel
Sie kommen in der Spätschicht in ein Patientenzimmer und stellen bei Ihrer Patientin Frau M. fest, dass die Mundschleimhaut sehr trocken, etwas belegt und schmerzhaft gerötet ist. Sie wissen, dass Frau M. über 80 Jahre alt ist, sie oft mit offenem Mund atmet, relativ wenig trinkt und die Mundpflege nicht selber durchführen kann. Sie kommen nach einigen wenigen Überlegungen, den gerade gemachten Beobachtungen und dem Gespräch mit Frau M. zu der Diagnose „geschädigte Mundschleimhaut“ aufgrund von drohender Dehydratation, Mundatmung und unangemessener Mundhygiene.
Daraufhin schließen Sie, dass bei Verschlechterung der Situation weitere Probleme folgen könnten (z. B. schmerzhafte Defekte der Schleimhaut, Pilzinfektionen, Pneumonie) und Sie entsprechende Pflegemaßnahmen einleiten müssen, die Sie mit Frau M. absprechen. An den weiteren Tagen beobachten Sie den Status der Mundhöhle häufiger, sprechen öfter mit Frau M. über ihr Empfinden, beraten sich im Kollegenkreis und können schließlich nach einigen Tagen und erfolgreichen Pflegemaßnahmen eine intakte und von Beeinträchtigungen freie Mundhöhle feststellen.
Wie und warum
Schon dieses einfache Beispiel zeigt, dass eine Diagnose zu stellen ▶ (in diesem Falle eine NANDA-Diagnose) kein einmaliger, statischer Vorgang ist, sondern ein Prozess, der mühsam erlernt werden muss und sowohl theoretisches Wissen („know that“ = Wissen, dass) als auch praktisches Wissen bzw. Erfahrungswissen („know how“ = Wissen, wie) erfordert. Dazu gehören Denken, Wahrnehmen, Beurteilen ebenso wie das Sichhineinversetzen, Spüren und Verstehen (Brater 2016, Böhle, Brater u. Maurus 1997, Benner 2012, Schrems 2003). Pflegende müssen also distanzierte Beobachtung und Zuwendung gleichermaßen realisieren.
Pflegediagnosen im Klassifikationssystem
Es wird auch deutlich, dass das Stellen einer Diagnose im Rahmen von Klassifikationssystemen mit einer formalisierten Sprache einhergeht, d. h., es wird ein feststehender Begriff benutzt, um den Zustand der Mundschleimhaut zu beschreiben. Während es in der Medizin vorrangig um die Diagnose von Krankheiten geht, deren weltweites Klassifikationssystem der ▶ ICD-10 ist, geht es in der Pflege um Reaktionen auf Krankheiten, um Symptome und Bewältigung. Dafür gibt es weltweit unterschiedliche Klassifikationssysteme (z. B. NANDA-I, ICNP, ICF).
4.6.1.2 Begriff „Pflegediagnose“
Woher kommt der Begriff Diagnose? Der ursprünglich griechische Begriff „diágnosis“ meint so viel wie „unterscheiden, auseinandererkennen“. Durch eine Diagnose wird eine Situation, ein Sachverhalt oder eben ein Phänomen wie „geschädigte Mundschleimhaut“ (NANDA-International 2016) definiert. Diese Definitionen der zentralen Begriffe eines Faches sind die Grundlage für den Aufbau von Wissen. Pflegediagnosen können somit als „grundlegendste Begriffe des Pflegefachs betrachtet werden“ (Mortensen 1998).
Definition
Pflegediagnose: Die gängigste Definition von Pflegediagnosen ist die der NANDA-I und lautet: „Eine Pflegediagnose ist eine klinische Beurteilung (clinical judgement) einer menschlichen Reaktion auf Gesundheitszustände/Lebensprozesse oder die Vulnerabilität (Verletzbarkeit, H.F.) eines Individuums, einer Familie, Gruppe oder Gemeinschaft für diese Reaktion“ (NANDA-International 2016).
4.6.1.3 „Terminologie – Klassifikation – Taxonomie“
Definition
Terminologie: Liegen die zentralen Begriffe einer Disziplin in standardisierter Form vor, sprechen wir von einer Terminologie.
Klassifikation: Werden die Begriffe in eine bestimmte Ordnung oder Systematik gebracht, nennt man das Klassifikation. Diese dient der Einteilung von Gegenstandsbereichen in Klassen, sie ordnet ein Fachgebiet und fördert die Systematik innerhalb einer Disziplin.
Klassifikationen kommen in vielen Wissenschaften zur Anwendung, auch die Pflege kennt einige Klassifikationssysteme. So gibt es seit vielen Jahren die Schweregradklassifikationen zur Erhebung des Pflegeaufwands und zur Personalbedarfsermittlung.
Definition
Taxonomie: Der Begriff Taxonomie wird international oft synonym für „Classification“ benutzt. Darunter kann ganz allgemein ein Ordnungsschema, aber auch die Wissenschaft von der Systematik verstanden werden (Friesacher 2007).
Praxistipp
Sehen Sie sich die Ausführungen in Anamnesebögen an. Vergleichen Sie die Beschreibungen der Einschätzung des Zustands eines Patienten mit der Beschreibung einer anderen Kollegin. Was fällt Ihnen auf? Sind die Beschreibungen identisch? Benutzen die Kolleginnen und Kollegen die gleichen Begriffe? Werden dieselben Schwerpunkte gesetzt? Was wird ausführlich beschrieben, was wird vernachlässigt?
4.6.1.4 Historische Entwicklung der Pflegediagnosen
Der Begriff Pflegediagnose taucht zuerst in der US-amerikanischen Fachliteratur in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts auf, etwa zeitgleich mit der Vorstellung von Pflege als einem prozesshaften Vorgehen. Häufiger wurden zunächst aber die Begriffe „Problem“, „Bedürfnis“ und „Bedarf“ benutzt, bis der Diagnosenbegriff sich in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts durchsetzte. Das hat maßgeblich mit der Etablierung von Pflegewissenschaft zu tun und den seit 1973 bis heute regelmäßig stattfindenden Pflegediagnosenkonferenzen und der Gründung der North American Nursing Diagnosis Association (NANDA).
▶ Tab. 4.5 zeigt die wesentlichen historischen Entwicklungen der Pflegediagnosen in den USA. Die Einführung der Pflegediagnosen verlief auch in den USA nicht problemlos. So wurde die eher unkritische Übernahme des Diagnosebegriffes, der ja stark vom medizinischen Denken geprägt ist, ebenso bemängelt wie die mangelnde Beteiligung der Praktiker vor Ort bei der Entwicklung und Einführung (vgl. Powers 1999).
|
Jahr |
Entwicklung |
|
1953 |
Frey erwähnt den Begriff Pflegediagnose in einer amerikanischen Pflegefachzeitschrift |
|
1960 |
Abdellah identifiziert und beschreibt im Rahmen einer großen Studie in amerikanischen Krankenhäusern 21 typische Pflegeprobleme |
|
1972 |
der Staat New York erteilt den gesetzlichen Auftrag zur Entwicklung von Pflegediagnosen |
|
1973 |
die erste Konferenz der American Nursing Association (ANA) zur Klassifikation von Pflegediagnosen findet statt Veröffentlichung der „Standards of Nursing Practice“ |
|
1974 |
die ersten Pflegediagnosen werden in den USA publiziert |
|
1982 |
die NANDA wird gegründet und mit der Entwicklung eines Klassifikationsschemas beauftragt |
|
1986 |
das als Taxonomie I bezeichnete Ordnungsschema der „Human Response Pattern“ (menschliche Verhaltensmuster oder Reaktionen) wird verabschiedet |
|
1989 |
der Versuch scheitert, die NANDA-Pflegediagnosen in die 9. Ausgabe der internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD-9) aufzunehmen. Das Vorhaben wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelehnt, da die NANDA-Pflegediagnosen nur die Entwicklung in einem Land widerspiegeln |
|
1998 |
die Taxonomie II wird auf der 13. NANDA-Konferenz vorgestellt |
|
2003 |
die NNN-Taxonomie (Verbindung von NANDA mit NIC und NOC) wird geschaffen |
|
2005 |
die NANDA-Pflegediagnosen 2005 – 2006 (176 Diagnosen) werden durch NANDA-International veröffentlicht (deutsche Übersetzung) |
|
2008 |
die NANDA-Pflegediagnosen 2007 – 2008 (188 Diagnosen) werden durch NANDA-International veröffentlicht (erstmalig durch NANDA-International autorisierte deutsche Übersetzung) |
|
2016 |
NANDA-International: Pflegediagnosen: Definitionen und Klassifikation 2015 – 2017 |
4.6.2 Pflegediagnosen und Pflegeklassifikationssysteme
4.6.2.1 NANDA-International-Pflegediagnosen
Aktuell gibt es 235 NANDA-I-Pflegediagnosen. Damit die Diagnosen in einer gewissen Form geordnet werden können, hat die NANDA sich auf ein bestimmtes Ordnungsschema geeinigt. Die Taxonomie II besteht aus 3 Ebenen (Level):
1. Ebene Hier werden folgende 13 Bereiche (Domänen) aufgeführt:
-
Gesundheitsförderung
-
Ernährung
-
Ausscheidung und Austausch
-
Aktivität und Ruhe
-
Wahrnehmung/Kognition
-
Selbstwahrnehmung
-
Rollenbeziehung
-
Sexualität
-
Coping/Stresstoleranz
-
Lebensprinzipien
-
Sicherheit/Schutz
-
Wohlbefinden
-
Wachstum/Entwicklung
2. Ebene Die 13 Bereiche sind anhand von 47 Klassen weiter spezifiziert. So umfasst z. B. der Bereich „Sicherheit/Schutz“ folgende Klassen:
-
Infektion
-
physische Verletzung
-
Gewalt
-
Umweltgefahren
-
Abwehrprozesse
-
Thermoregulation
3. Ebene Die einzelne Pflegediagnose wird dann einer der Klassen zugeordnet. Die NANDA-Taxonomie II umfasst insgesamt 235 Diagnosen (NANDA-International 2016).
Diagnosearten
Die einzelnen Pflegediagnosen werden nach folgenden Typen oder Formen unterschieden (nach NANDA-International 2016):
-
Problemfokussierte Pflegediagnosen: klinische Beurteilung einer unerwünschten menschlichen Reaktion auf einen Gesundheitszustand/Lebensprozess, der bei einem Individuum, einer Familie, Gruppe oder Gemeinschaft auftritt.
-
Risiko-Pflegediagnosen: klinische Beurteilung der Vulnerabilität eines Individuums, einer Familie, Gruppe oder Gemeinschaft, eine unerwünschte menschliche Reaktion auf Gesundheitszustände/Lebensprozesse
-
Pflegediagnosen der Gesundheitsförderung: eine klinische Beurteilung der Motivation und des Wunsches, das Wohlbefinden zu steigern und das menschliche Gesundheitspotenzial zu verwirklichen. Diese Reaktionen werden durch die Bereitschaft ausgedrückt, spezielle Gesundheitsverhaltensweisen zu verbessern, und können bei jedem Gesundheitszustand angewendet werden. Gesundheitsfördernde Reaktionen können bei einem Individuum, einer Familie, Gruppe oder Gemeinschaft vorliegen.
Darüber hinaus gehören zur NANDA-I-Taxonomie auch einige wenige Syndrome. Ein Syndrom ist eine klinische Beurteilung hinsichtlich einer speziellen Gruppe von Pflegediagnosen, die zusammen auftreten und am besten zusammen und mit ähnlichen Interventionen behandelt werden.
▶ Abb. 4.31 zeigt als Beispiel die Darstellung der aktuellen NANDA-I-Pflegediagnose von Frau M. aus unserem Fallbeispiel.
Aktuelle NANDA-I-Pflegediagnose von Frau M. (nach NANDA-I-2018-2020).
Abb. 4.31
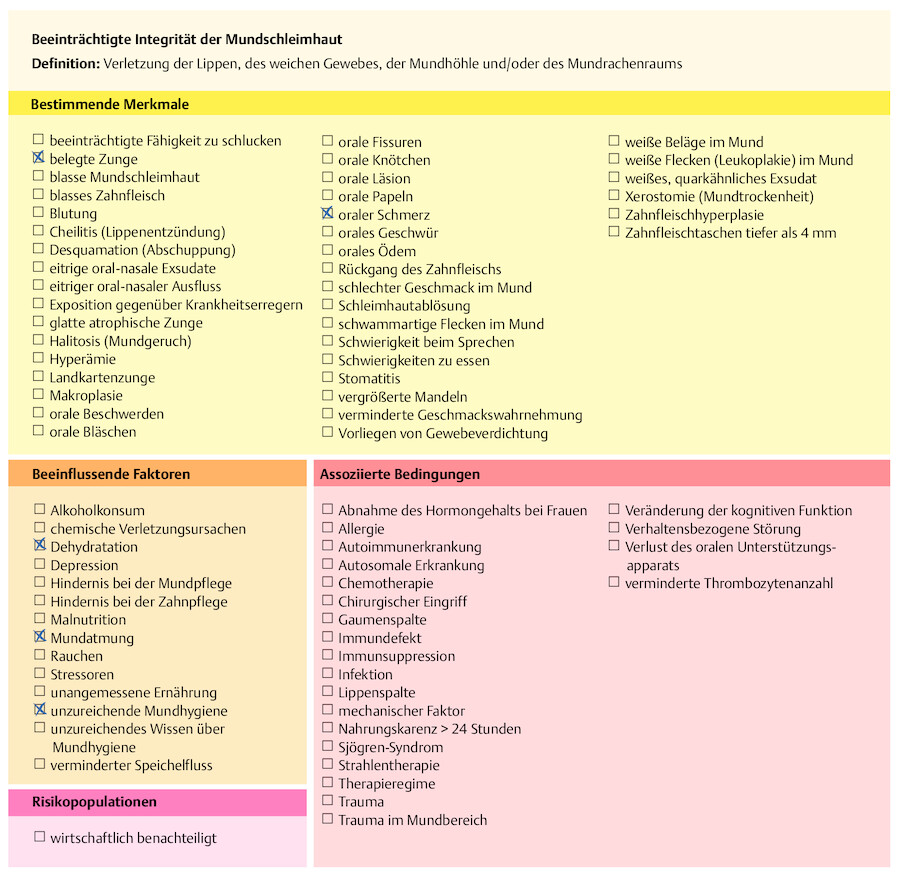
Bestimmende Merkmale Die bestimmenden Merkmale sind die Kennzeichen und Symptome, die zu beobachten und nachweisbar sind. Dabei müssen natürlich nicht alle Kennzeichen vorliegen, um zu einer Pflegediagnose zu gelangen.
Beeinflussende Faktoren Die beeinflussenden Faktoren sind im weitesten Sinne die Ursachen.
4.6.2.2 Pflegeinterventions- und Pflegeergebnisklassifikation (NIC und NOC)
Neben der Entwicklung von Diagnosen zur Beschreibung von Zuständen von Patienten/Bewohnern, Familien und Gruppen gibt es Bestrebungen, auch die Interventionen und die Ergebnisse der Pflege zu klassifizieren und diese mit den Diagnosen zu verbinden.
NNN-Taxonomie der Pflegepraxis Das vorläufige Ergebnis dieser Bestrebungen ist die sogenannte NNN-Taxonomie der Pflegepraxis. Die NNN-Taxonomie stellt die gemeinsame Struktur von NANDA, NIC und NOC dar (NANDA-International 2008).
Die Arbeiten zur Entwicklung der NIC und NOC gehen bis in die 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. 1992 wurde die erste Version der NIC, 1997 die erste Version der NOC publiziert.
Nursing Interventions Classification (NIC)
Ziele Die Zielsetzungen der Pflegeinterventionsklassifikation (NIC = Nursing Interventions Classification) sind u. a.:
-
die Standardisierung in der Bezeichnung pflegerischer Leistungen
-
die Ermittlung der Kosten
-
die Entwicklung von Informationssystemen
-
die Schulung in der Entscheidungsfindung
Struktur In der derzeitigen 4. Version enthält die NIC mehrere Hundert Interventionen und einige Tausend Einzelaktivitäten. Diese sind in 7 Domänen und 30 Klassen geordnet. Zu den Domänen zählen u. a. Bereiche wie „Physiologisch elementar und komplex“, „Verhalten“, „Gesundheitssystem“ (Bulechek et al. 2013).
Nursing Outcome Classification (NOC)
Ziele Die Klassifikation der Pflegeergebnisse (NOC = Nursing Outcome Classification) hat u. a. eine Kosten-Nutzen-Analyse und den Nutzen bzw. Effekt für den einzelnen Patienten wie auch für die Gesamtbevölkerung zum Ziel. Es soll auch einen Vergleich von Abteilungen und Einrichtungen ermöglichen (das sog. Benchmarking) wie auch die Kosten im Verhältnis zur Qualität zu bestimmen.
Struktur Ähnlich wie bei NIC sind bei NOC 490 Outcomes in 7 Domänen aufgeführt, die in 33 Klassen unterteilt sind. Zu den Domänen zählen u. a.:
-
„physiologische und psychische Gesundheit“
-
„Gesundheitswissen und -verhalten“
-
„Gesundheit und Familie“ bzw. „Gesundheit und Gemeinde“ (Moorhead u. Johnson 2013)
In einem vertieften und fortgeschrittenen Pflegeprozess (Advanced Nursing Process) werden definierte Konzepte zusammengeführt. Er umfasst nach Müller-Staub 2016:
-
„validierte Assessments,
-
evidenzbasierte Pflegediagnosen,
-
Pflegeinterventionen sowie
-
Pflegeergebnisse und
-
beruht auf Pflegeklassifikationen“.
Damit soll der Pflegebedarf besser erfasst und wirksamere Pflegemaßnahmen eingeleitet werden, die zu besseren Patienten- bzw. Bewohnerergebnissen führen.
4.6.2.3 Internationale Klassifikation der Pflegepraxis (ICNP)
Während NANDA, NIC und NOC ursprünglich als 3 voneinander unabhängige Klassifikationsbestrebungen anzusehen waren, kann die „International Classification of Nursing Practice“ (ICNP) als das umfassendste System betrachtet werden. Nachdem die WHO die NANDA-Klassifikation der Pflegediagnosen 1989 nicht in die geplante ICD-9-Version (ICD = International Classification of Diseases) aufgenommen hat, einigte man sich im ICN auf die Entwicklung einer weltweit gültigen und akzeptierten Klassifikation für die Pflegepraxis.
Die ICNP ist eine internationale Klassifikation und ein Projekt des ICN (International Council of Nurses). Sie ist kombinierbar, stützt sich auf bestehende Terminologien aus verschiedenen Ländern und versteht sich als umfassende Klassifikation und Referenzterminologie.
Merke
Die ICNP soll die pflegerische Praxis, d. h. die Handlungen der Pflegenden beschreiben, sie soll die Patientenzustände, die zu diesen Handlungen führen (Pflegediagnosen), enthalten und die Wirkung (Ergebnis, Outcome) der Pflege verdeutlichen. Sie ermöglicht die Nutzung einer natürlichen lokalen Sprache und die Abbildung (mapping) mit einer standardisierten Bedeutung in ICNP (König 2014).
Klassifikationsstruktur der ICNP
Die gesamte ICNP besteht aus 3 „Klassifikationspyramiden“:
-
Pflegephänomene (Diagnosen)
-
pflegerische Interventionen
-
Pflegeergebnisse
Klassifikation Die ICNP wurde unter sprach- und klassifikationstheoretischen Kriterien entwickelt. Einen Begriff klassifizieren heißt dabei, seine allgemeinsten Kennzeichen zu beschreiben und die Begriffe dann in Klassen einzuteilen. Klassifikation meint also das Einteilen von Gegenstandsbereichen in Klassen.
Dieses Prinzip kennen Sie aus anderen Bereichen, z. B. aus der Biologie mit der Klassifikation der Säugetiere oder der Klassifikation der Pflanzen, aber auch im privaten Bereich wird klassifiziert. Bücher ebenso wie die DVD-Sammlung und jedes Mal entscheiden Sie sich für Kriterien, nach denen Sie klassifizieren. Bei DVDs z. B. nach Genre (Komödie, Drama …)
Wissenschaftliche Klassifikation Beim wissenschaftlichen Klassifizieren gibt es jedoch einige wichtige Regeln, die eingehalten werden müssen:
-
Die wesentlichen Kennzeichen eines einzelnen Individuums (Begriffs) müssen mit denen der Klasse übereinstimmen. Jeder Begriff sollte auch nur einer Klasse zugeordnet werden und Überschneidungen und andere Möglichkeiten der Einordnung sollten ausgeschlossen sein.
-
Eine weitere Forderung ist die Vollständigkeit, d. h., die Klassifikation muss so angelegt sein, dass sie Platz bietet für alle Begriffe, die man klassifizieren möchte.
-
Darüber hinaus werden die Begriffe in eine Hierarchie gebracht und die Beziehungen zwischen den Begriffen festgelegt. Man erhält so eine Begriffspyramide, die nach dem Unterordnungsprinzip aufgebaut ist. Der oben stehende Begriff wird als Topterminus bezeichnet, das ist der Begriff mit dem höchsten Abstraktionsniveau. Die weiter unten stehenden Begriffe sind spezifischer und enthalten mehr Kennzeichen.
Spezifische Definition der Pflegephänomene Jedes Pflegephänomen hat dabei eine spezifische Definition, die sich logisch von den jeweiligen Oberbegriffen ableitet. Ein konkretes Pflegephänomen wie „Dyspnoe“ wird dann in folgender Art beschrieben: „Dyspnoe ist Atmung mit folgenden spezifischen Merkmalen: Atmung, die einhergeht mit Beschwerden, verstärkter Atemarbeit, Kurzatmigkeit, Nasenflügelatmung, veränderter Atemtiefe, Gebrauch der Atemhilfsmuskulatur, veränderter Atemexkursion und Fremitus“ (van der Bruggen 2002).
Dieser spezifische Begriff weist alle Merkmale des übergeordneten Begriffs („Atmung“) auf und mindestens ein weiteres unterscheidendes Merkmal.
Erstellung einer Pflegediagnose nach ICNP
Die Pflegephänomene werden anhand von 7 Achsen klassifiziert. Die Bildung einer Pflegediagnose aus den Achsen der ICNP könnte wie folgt aussehen (nach König 2014) ( ▶ Tab. 4.6 ):
|
Achsen |
Beispiele |
|
Mobilität |
|
beeinträchtigt; hoher Grad |
|
|
|
|
|
kontinuierlich |
|
rechter Arm |
|
Patient |
Durch Auswahl von Begriffen aus den unterschiedlichen Achsen wird die Pflegediagnose erstellt ( ▶ Abb. 4.32).
Pflegediagnose.
Abb. 4.32 Durch die Auswahl von einzelnen oder mehreren Begriffen aus den unterschiedlichen Achsen wird nach ICNP die Pflegediagnose erstellt.

Ziele der ICNP
ICNP hat zum Ziel, einen internationalen gemeinsamen Begriffsrahmen für die Pflege vorzugeben, der dann in den jeweiligen Nationalsprachen ausgedrückt werden kann. Nielsen beschreibt die Veränderungen in der Zielsetzung der ICNP-Entwicklung folgendermaßen: „Die Verschiebung des Interesses weg von Daten in Richtung Begriffe wird also begleitet von einer Verschiebung von den Inhalten der professionellen ‚Menschensprache‘ im Gesundheitswesen in Richtung der Strukturen der ‚Maschinensprache‘ im Bereich der Gesundheitsinformatik“ (Nielsen 2003).
4.6.2.4 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)
Die International Classification of Functions (ICF) ist die weiterentwickelte Form der von der WHO erstmals 1980 veröffentlichten Internationalen Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen (International Classification of Impairmans, Disabilities and Handicaps, ICIDH). War die ICIDH noch als Krankheitsfolgenmodell konzipiert, ist die seit Oktober 2005 in der Endfassung vorliegende ICF „ein an der Person orientiertes, multiprofessionell nutzbares internationales Diagnosesystem (...), durch das sich die Pflege im Zentrum des Gesundheitswesens findet“ (Behrens 2003).
Klassifikation
Die gesamte Klassifikation ist als PDF-Datei im Internet unter www.dimdi.de/ frei zugänglich. Die ICF ist eine Klassifikation für verschiedene Disziplinen und Anwendungsbereiche.
Ziele
Die Ziele sind u. a.:
-
die Bereitstellung einer „wissenschaftlichen Grundlage für das Verstehen und das Studium des Gesundheitszustands und der mit der Gesundheit zusammenhängenden Zustände, der Ergebnisse und der Determinanten“
-
die Konzeption einer „gemeinsamen Sprache für die Beschreibung des Gesundheitszustands [...]“
-
die Ermöglichung von „Datenvergleichen zwischen Ländern, Disziplinen im Gesundheitswesen“ (DIMDI 2005)
Die ICF ist universell einsetzbar und nicht nur, wie vielfach angenommen, auf Menschen mit Behinderungen und deren Rehabilitation begrenzt. Interessant für die Pflege ist die ICF aus ihrer am Gesundheitsbegriff ansetzenden Konzeption und der Integration des „Medizinischen Modells“ mit dem „Sozialen Modell“, um eine möglichst umfassende Sicht aus verschiedenen Perspektiven auf Gesundheit zu erreichen (DIMDI 2016).
Merke
Im Gegensatz zu den „traditionellen“ Klassifikationssystemen NANDA, NIC, NOC und ICNP basiert die ICF stärker auf einer an Ressourcen und Fähigkeiten orientierten Sichtweise, was mit einer modernen Auffassung von Pflege gut vereinbar ist. Außerdem sind ethische Reflexionen in den Ausführungen zur ICF enthalten, da den Autoren bewusst ist, dass jegliche Art von Diagnostik und Klassifikation auch mit ethisch-moralischen Problemen behaftet ist. Doch dazu mehr im nächsten Abschnitt.
4.6.3 Mögliche Probleme und Kritik der Pflegediagnosen
4.6.3.1 Gefahren und Grenzen der Fachterminologie
„Wer hätte das gedacht? Die Hauptstadt unseres Landes [...] wird von einem Kranken regiert. Einmal im Jahr finden in mehreren Städten Großdemonstrationen kranker Menschen statt. Auf unseren Fernsehkanälen moderieren Kranke politische Talkrunden, Comedy-Sendungen und Kochshows“ (Wißmann u. Gronemeyer 2008). Dieses Zitat ist auf den ersten Blick verwirrend. Doch bei genauerem Lesen wird vielleicht deutlich, um was es geht. Die Personen, auf die hier angespielt wird, waren bzw. sind sehr präsent im deutschen Fernsehen. Es geht um Klaus Wowereit, Anne Will, Hape Kerkeling, Alfred Biolek. Und was verbindet alle diese Personen? Sie sind bekennende Schwule bzw. Lesben. Die erwähnten Großdemonstrationen kranker Menschen sind die Christopher Street Days (CSD), die alljährlich in großen Städten zum Protest gegen Ausgrenzung und Stigmatisierung von Schwulen, Lesben, Transgendern, Bisexuellen und Asexuellen stattfinden.
Und was hat das mit Diagnosen und Klassifikationen zu tun? Bis zum Jahr 1992 galt Homosexualität als Störung, gelistet im ICD-9 (dem Vorläufer des jetzt gültigen ICD-10, dem Diagnose- und Klassifikationssystem der Medizin) als psychiatrische Erkrankung. Durch die Streichung von Homosexualität aus dem ICD-Katalog wurden Millionen von Menschen weltweit nicht mehr als krank angesehen. Seitdem gilt Homosexualität (zumindest in aufgeklärten und offenen Gesellschaften) als eine Variante der sexuellen Orientierung.
Was kann man daraus lernen? Zumindest so viel: Was als Krankheit gilt, ist von historischen, kulturellen und gesellschaftlichen Einflüssen und Überzeugungen geprägt. Krankheit ist keine objektive Größe, sie ist ein soziales Konstrukt und somit veränderbar (Schramme 2012).
Gemeinsamer Bezugspunkt der Diagnose- und Klassifikationssysteme ist die Entwicklung einer mehr oder weniger klaren und eindeutigen Fachterminologie. Die Funktion von Fachsprache ist die Verständigung zwischen Menschen in einem fachlich begrenzten Kommunikationsbereich (hier die Pflege) auch über Länder-, Kultur- und Sprachgrenzen hinweg. Nach Zielke-Nadkarnie (1997) sind die folgenden Kennzeichen typisch für eine Fachsprache der Pflege:
-
Sie ist zweckhaft und sachbezogen.
-
Sie legt Bedeutungen fest und reduziert die Informationen auf das (vermeintlich) Wesentliche.
-
Sie standardisiert und ist wenig anschaulich.
Mit diesen Kennzeichen sind aber auch schon einige gravierende Probleme von Fachsprache benannt. Durch die Einführung fest definierter Begriffe wird eine Sichtweise besonders hervorgehoben, d. h., aus der großen Menge an möglichen Eigenschaften eines Gegenstandes werden einige als wesentlich ausgezeichnet. So werden möglichst beobachtbare und messbare Dimensionen erfasst und der Gegenstand auf diese reduziert (Hülsken-Giesler 2008).
4.6.3.2 Schaffung von Sprachhierarchien
Durch die Benutzung einer ganz spezifischen Sprache werden auch Sprachhierarchien geschaffen. So schafft Fachsprache einen Schutz, hinter dem man sich verstecken kann (vor unliebsamen Fragen der Patienten und Angehörigen, aber auch vor Fragen anderer Berufsgruppen). Sprache wird so zu einem Geheimcode für Experten und zum Instrument der Abgrenzung und des Ausschlusses (Zielke-Nadkarnie 1997, Böhme 1993). Damit kommt den Anwendern von Fachsprache eine erhebliche Macht zu.
Merke
Pflegende müssen sich darüber im Klaren sein, dass eine Fachsprache eine Definitionsmacht über Patienten und Bewohner bedeutet, und das wiederum erzeugt soziale Kontrolle und Stigmatisierung. Diese Gefahr ist umso größer, je mehr die Beziehung zwischen Patient und Pflegekraft eine ungleiche ist.
4.6.3.3 Normierung und Standardisierung
Die persönliche Erfahrung, z. B. des Trauerns oder des eigenen Körpergefühls, die wesentlich durch kulturelle und soziale Einflüsse bestimmt werden, wird durch die Fachsprache banalisiert und verfremdet. Die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten werden auf einige wenige beschränkt.
Fallbeispiel Besonders eindringlich beschrieben hat dies die Pflegewissenschaftlerin Annemarie Kesselring in einem viel beachteten Artikel (Kesselring 1999). Anhand eines Textauszugs einer jungen, an Brustkrebs erkrankten Frau zeigt Kesselring auf, wie problematisch die Anwendung von Pflegediagnosen (in diesem Fall der NANDA) sein kann. Zunächst wird die persönliche Schilderung der Patientin über ihre Situation dargestellt.
Fallbeispiel
„Was heißt es, in einem Körper zu leben, der sich ständig verändert? Es ist schrecklich, erschreckend und verwirrend. Es lässt Gefühle von Hilflosigkeit entstehen und bewirkt eine sklavenhafte Aufmerksamkeit dem Körper gegenüber. Es verursacht eine unnatürliche Überwachsamkeit gegenüber jeder und allen Sinnesempfindungen, welche in der körperlichen Landschaft auftauchen. Man wird eine Gefangene von jeder wahrnehmbaren Veränderung im Körper, jedem Husten, jeder Empfindensveränderung. Man verliert sein Gefühl von Stabilität und Voraussagbarkeit, aber auch das Gefühl von Körperkontrolle (...) Die Trauer über den Verlust dieser Voraussagbarkeit kompliziert den Anpassungsprozeß (sic.) an einen instabilen Körper. Die Zeit wird kürzer und ist durch Intervalle zwischen den Symptomen gekennzeichnet“ (Rosenblum 1988, zit. n. Kesselring 1999).
Kesselring analysiert diese persönliche Darstellung, die so oder in ähnlicher Form auch in einem Aufnahmegespräch stattfinden könnte, mit den Diagnosen der NANDA. Daraus folgen dann u. a. folgende Diagnosen:
-
„Körperbild, gestört“
-
„Trauern, nicht angemessen; Trauern, vorzeitig“ (Kesselring 1999)
Was ist die Norm?
Diese Diagnosen sind in leicht veränderter Form auch in den jetzt gültigen NANDA-I-Pflegediagnosen zu finden. Es fällt auf, dass beide Phänomene als Störung und bzw. Abweichung beschrieben sind. Also muss es eine Art Norm für ein wie auch immer definiertes ungestörtes Körperbild und eine Norm für angemessenes Trauern geben. Doch wer bestimmt diese Norm? Gibt es überhaupt allgemeingültige Maße für Lebensbereiche, die sich dieser Normalisierung doch weitgehend entziehen (Sarasin 2001, Friesacher 1998)? Die NANDA-Pflegediagnose „Körperbildstörung“ wird von Schrems (2003) zu Recht als Sichtweise dargestellt, die von einem äußerst mechanistischen Körpermodell ausgeht.
Die amerikanische Pflegewissenschaftlerin Penny Powers (1999) hat die negativen Auswirkungen von NANDA-Pflegediagnosen analysiert. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass Pflegediagnosen Zustände sozialer Asymmetrie reproduzieren und unterstützen, und zwar zwischen den Pflegenden und den Patienten, zwischen den Pflegenden untereinander und auch zwischen Pflegenden und den anderen Mitgliedern des therapeutischen Teams. Durch Diagnosen wird das Verhalten von Patienten und Pflegenden normiert. Der durch die (pflegewissenschaftliche) Forschung definierte Durchschnitt wird zum Standard erhoben. Abweichungen von diesem Standard sollen durch entsprechende Maßnahmen korrigiert werden, um der Norm (eine angemessene Trauer? ein ungestörtes Körperbild?) näher zu kommen ( ▶ Abb. 4.33).
Pflegediagnosen.
Abb. 4.33 Sie normieren und standardisieren. Damit unterstützen sie die soziale Asymmetrie zwischen Patient und Pflegenden, aber auch unter den Pflegenden selbst.
(Foto: A. Fischer, Thieme)

Eine Fallstudie
Ein sehr eindringliches Beispiel für die Auswirkungen von Diagnosen und Klassifikationen liefert der Arzt Rosenhan (1998) in einer viel zitierten Untersuchung.
Fallbeispiel
Rosenhan schleuste 8 Scheinpatienten in die Klinik ein, die alle mit der Diagnose „Schizophrenie“ aufgenommen wurden und sich in der Klinik ganz „normal“ verhielten. Keiner dieser Patienten wurde als Scheinpatient entlarvt, alle wurden mit der Diagnose Schizophrenie (einer mit der Diagnose Schizophrenie in Remission) entlassen (nach David L. Rosenhan 1998).
Fazit Als Fazit ein längeres Zitat aus Rosenhans Untersuchung: „Eine psychiatrische Klassifizierung erzeugt ihre eigene Wirklichkeit und damit ihre eigenen Wirkungen. Sobald der Eindruck entstanden ist, daß [sic.] der Patient schizophren ist, geht die Erwartung dahin, daß [sic.] er weiterhin schizophren bleiben wird. Wenn genügend Zeit verstrichen ist, ohne daß [sic.] er etwas Verschrobenes getan hat, glaubt man, er sei in Remission und könne entlassen werden. Aber die Klassifizierung haftet über die Entlassung hinaus, mit der uneingestandenen Erwartung, daß [sic.] er sich wieder wie ein Schizophrener benehmen werde. Solche Klassifizierungen, von psychiatrischen Fachleuten ausgeteilt, beeinflussen den Patienten ebenso wie seine Verwandten und Freunde, und es ist nicht verwunderlich, dass die Diagnose auf sie alle wie eine Prophezeiung wirkt, die sich selbst erfüllt. Schließlich akzeptiert der Patient selbst die Diagnose, mit all ihren zusätzlichen Bedeutungen und Erwartungen und verhält sich entsprechend. Sobald er dies tut, hat auch er sich an diese Konstruktion einer zwischenmenschlichen ‚Wirklichkeit‘ angepasst“ (Rosenhan 1998).
Praxistipp
Die Untersuchung von Rosenhan ist in dem Buch von Paul Watzlawick (1998) „Die erfundene Wirklichkeit“ nachzulesen.
4.6.4 „Verstehende“ Diagnostik
Die Kritik an den traditionellen Pflegediagnosesystemen hat in den USA zu teilweise heftigen Debatten geführt und in der Folge für einige Jahre zum Zusammenschluss einer Gruppe von Pflegewissenschaftlern und Praktikern (Nurses Opposed to the Advancement of Nursing Diagnosis, NOAND), die gegen die NANDA-Diagnosen viele (z. T. gut nachvollziehbare) Argumente in die Diskussion eingebracht haben (Kollak u. Huber 1996, Zanotti u. Chiffi 2014). Auch in Deutschland wird die Debatte um Pflegediagnosen kontrovers geführt (Hülsken-Giesler 2008, Friesacher 2007, 2000, 1998, Stemmer 2006, Kean 1999, Darmann 1998).
4.6.4.1 Alternative Konzepte
Auf der Suche nach Alternativen kann die Pflege an verschiedene Bezugsdisziplinen anknüpfen, in denen ebenfalls Diagnose- und Klassifikationssysteme eine erhebliche und oftmals auch nicht unproblematische Rolle spielen. So gibt es alternative Ansätze zu den „klassischen“ Konzepten auch in der Medizin (Fuchs 2015 und 2015a, Schramme 2012 u. 2000) und in der Behindertenpädagogik (Jantzen 1996). Die intensive Analyse des individuellen Falles (Persönlichkeit, Lebensgeschichte) rückt dabei ins Zentrum des Interesses und hat zu Ansätzen einer alternativen, verstehenden Diagnostik geführt.
Individuelle Fallanalyse So überträgt Decker (2001) den Ansatz von Jantzen auf die Pflege von Menschen mit Demenz. Dabei werden die Symptome nicht, wie in der klassischen Diagnostik, von außen als defizitär und pathologisch betrachtet und die Betroffenen somit stigmatisiert und etikettiert. Herausforderndes Verhalten wird als Möglichkeit gesehen, unter den Bedingungen von Isolation Sinn zu realisieren und ist somit als Kompetenz zu verstehen. Die isolierenden Bedingungen sollen durch eine subjektorientierte Pflege kompensiert werden, dazu bedarf es einer „Rekonstruktion der zugrunde liegenden Entwicklungslogik“, die im Prozess der verstehenden Diagnostik zu leisten ist (Decker 2001, Jantzen 1996, Remmers 2006).
Perspektive des Gegenübers Ein verstehender Zugang zum anderen und eine am individuellen „Fall“ orientierte Vorgehensweise haben in der Sozialwissenschaft eine lange Tradition (Schütze 1993).
Für eine fallorientierte Diagnostik kann die Pflege auf die sozialwissenschaftliche Methode der Fallanalyse zurückgreifen. Dabei ist es für eine fallanalytische Vorgehensweise wesentlich, die Perspektive des Gegenübers (Patient, Bewohner) einzunehmen. Die Orientierung an der Verlaufskurve und dem Erleben des Betroffenen ist dabei besonders bei Menschen mit chronischen und lang dauernden Beeinträchtigungen ein wesentliches Element. Dabei stehen nicht die Krankheiten oder Einschränkungen im Vordergrund, sondern die Personen mit ihrem Erleben, ihren Bewältigungsstrategien und die je individuelle Alltagsnormalität. Wie wichtig eine verstehende Diagnostik ist, wird besonders bei Menschen mit Demenz hervorgehoben (Halek 2014, Hardenacke, Bartholomeyczik u. Halek 2011).
Für umfassendere Darstellungen sei auf Friesacher (1999), Just (2003) und Schrems (2008) verwiesen.
Merke
Voraussetzung zur Umsetzung alternativer Konzepte ist eine Veränderung der Rahmenbedingungen. Solange die Begriffe der Pflege in informationstechnologisch nutzbarer, d. h. in standardisierter und formalisierter, Form vorliegen sollen wie bei NANDA, ICNP und NIC/NOC, ist eine am subjektiven Erleben des Patienten orientierte Sprache nicht in die Organisation eines Krankenhauses oder Altenpflegeheims integrierbar (Hülsken-Giesler 2008, Kersting 2008).
4.6.5 Zusammenfassende Schlussbetrachtung
Pflegediagnosen und entsprechende Klassifikationssysteme sind Entwicklungen in der Pflege, die nicht von den Veränderungen im Gesundheitswesen zu trennen sind. Der Nachweis der Leistungen, die Legitimation pflegerischen Handelns und die Vereinheitlichung der Sprache zur computergestützten Dokumentation sind Forderungen, denen sich die Pflege stellen muss. Ob die „traditionellen“ Ansätze von NANDA, NIC/NOC und ICNP der richtige Weg zur Professionalisierung sind oder eher zusätzliche Probleme aufwerfen, wird die Zukunft zeigen. Auch ob es gelingen kann, alternative Formen und weniger defizitorientierte, starre und normierende Modelle der Diagnostik zu etablieren.
Merke
Pflegediagnosen sind in den Bereichen relativ unproblematisch, wo wir es mit physiologischen Phänomenen zu tun haben, z. B. bei einer veränderten Mundschleimhaut. Bei umfassenderen Zuständen, die ▶ soziokulturell und psychosozial geprägt sind, scheinen Pflegediagnosen eher zu schaden und eine sehr eingeschränkte Perspektive zu vermitteln.
So lautet auch das Fazit von Kesselring in ihrem Aufsatz: „Pflegediagnosen sind ein technisches Hilfsmittel für die computergestützte Dokumentation von Aktivitäten, die von Pflegepersonen durchgeführt werden, nichts mehr und nichts weniger“ (1999). Als abschließende Sorge formuliert sie: „Ist es möglich, dass wir, vor lauter Anstrengungen, einen babylonischen Pflegesprachturm zu bauen, autistisch werden und nicht merken, dass uns dabei die menschliche Sprache und das ihr zugehörige Bildungswissen abhanden kommt?“ (Kesselring 1999). Diese Aussagen haben auch im 21. Jahrhundert noch ihre Gültigkeit.
4.7 Assessmentinstrumente in der Pflege
Assessmentinstrumente unterstützen Pflegende bei Entscheidungen im Verlauf des gesamten Pflegeprozesses. Sie können an unterschiedlichen Punkten in diesem Prozess greifen, immer dann, wenn diagnostische Maßnahmen erforderlich sind. Alle Instrumente haben das Ziel, Gesundheitsindikatoren, Fähigkeiten, Verhaltensweisen von Menschen mit Pflegebedarf systematisch festzuhalten und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. zum Thema „Pflegebedarf einschätzen. Pflegerisches Assessment“, Bartholomeyczik 2008).
4.7.1 Was sind Assessmentinstrumente?
Definition
Assessment (engl.) heißt übersetzt Einschätzung, Beurteilung, Abwägung. Zu einer Einschätzung oder Beurteilung gehören immer zwei Aspekte:
-
die Informations- oder Datensammlung
-
die Interpretation dieser Daten
Das bedeutet also, dass nicht nur beschrieben wird, dass an einer bestimmten Stelle eines Patienten die Haut gerötet ist und bei einem Druck mit einem Finger die Rötung persistiert, sondern auch, was das bedeutet. In diesem Fall kann dies ein Dekubitus im Stadium 1 sein. Die Abwägung erfolgt danach im Hinblick auf die Intervention.
Ein Assessment kann mit oder ohne ein spezielles Instrument erfolgen.
Definition
Ein Assessmentinstrument ist ein standardisiertes Hilfsmittel (Instrument), mit dem das Assessment durchgeführt werden kann. Standardisiert heißt, dass es in den dafür vorgesehenen Fällen immer in der gleichen Art und Weise angewandt wird. Das bedeutet auch, dass es genaue Verfahrensweisen gibt, wie das Instrument anzuwenden ist.
4.7.1.1 Screening
Unter dem Begriff Assessmentinstrumente finden sich nicht nur ausführliche Instrumente, sondern auch sehr einfache, kurze Instrumente, für die noch ein anderer Begriff verwendet wird, nämlich „Screening“.
Definition
Ein Screening ist ein Instrument, das relativ einfach und oberflächlich eine Wahrscheinlichkeit von Risiken oder Schäden erfasst.
Fallbeispiel
Ein einfaches Screening zur Erfassung des Risikos einer Mangelernährung kann aus 3 Items (Fragen) bestehen:
-
unzureichende Nahrungsaufnahme
-
ungeplanter Gewichtsverlust
-
erhöhter Bedarf durch akute Krankheit
Wird eines dieser Items als vorhanden festgestellt, muss genauer untersucht werden, ob es sich tatsächlich um eine Mangelernährung handelt, und in diesem Fall, woran das liegt.
Screenings erfordern also bei einem positiven Befund ein weitergehendes vertieftes Assessment.
4.7.2 Wozu sind Assessmentinstrumente nützlich?
Allgemein müssen Assessmentinstrumente in der Pflege dazu beitragen, pflegerelevante Phänomene strukturiert und eindeutig zu erfassen. Sie sind immer Teil der Pflegediagnostik. Daher ist ihr Ziel, zur Erstellung pflegerischer Diagnosen beizutragen und letztlich zu der Beschreibung der Gesamtsituation eines Patienten zu gelangen. Wenn hier der Begriff Pflegediagnose genutzt wird, dann bezieht er sich nicht auf ein bestimmtes System (z. B. NANDA-Diagnosen), sondern bezeichnet nur die Zusammenführung von Informationen, die als Grundlage für die Entscheidung für pflegerische Maßnahmen dienen.
Bei der Frage nach dem Nutzen muss gefragt werden, ob Pflegende auch ohne vorgegebene Formulierungen, also ohne ein Instrument feststellen können, ob z. B. eine Dekubitusgefahr vorliegt oder ein Patient Schmerzen hat. Qualifizierte und erfahrene Pflegende können die Situation von Patienten auch ohne Anwendung eines Assessmentinstruments oft sehr gut einschätzen.
4.7.2.1 Vorteile der Assessmentinstrumente
Dennoch sind gute Assessmentinstrumente aus mehreren Gründen zu empfehlen:
-
Sie können die Pflegediagnostik allgemein verbessern. Ein standardisiertes Instrument weist auf die Phänomene hin, die zu beachten sind; es kann so etwas wie eine Landkarte sein. Bei der pflegerischen Diagnostik geht es allerdings um die Gesundheit und Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen. Irrfahrten in diesem Sinne sind Pflegefehler und absolut zu vermeiden. Alle Instrumente sollen die Nutzer auf bestimmte Inhalte stoßen, die es zu beachten, zu beobachten, zu erfragen oder auf andere Art zu erfassen gilt. Sie dienen also auch als Gedächtnisstütze. Das kann allerdings nur bei entsprechenden fachlichen Kenntnissen funktionieren.
-
Etwas standardisiert zu erfassen heißt immer auch – im Gegensatz zu nicht standardisierten Verfahren –, dass die Informationen durch die immer gleiche Art des Verfahrens und der Dokumentation vergleichbar sind. Dadurch können Verläufe einzelner Patienten leicht aufgezeigt werden. Sinnvoll ist z. B., einen Zustand bei Beginn der Krankenhausbehandlung mit dem bei der Entlassung zu vergleichen.
-
Wegen ihrer Standardisierung ist es leicht möglich, die Instrumente in Softwaresysteme zu integrieren. Insbesondere kann ein gutes Softwaresystem bereits erhobene Informationen für Instrumente zusammenführen. So kann Doppeldokumentation vermieden und die Dokumentation allgemein erleichtert werden.
-
Schließlich ermöglicht die verstärkte Nutzung standardisierter Instrumente und deren Integration in Datensysteme Auswertungen auf ganz anderen Ebenen, denn damit sind nicht nur die individuellen Daten, sondern auch Gruppen vergleichbar. Neben der Möglichkeit, diese Daten als Qualitätsindikatoren zu nutzen, können sie auch als Grundlage für Studien dienen, z. B. für epidemiologische Fragestellungen oder eine Pflegeberichterstattung (dip 2003, Bartholomeyczik et al. 2010), zur Begründung von Pflegeaufwand oder auch für Untersuchungen zur Effektivität von pflegerischer Versorgung, wenn der Entlassungszustand in einem standardisierten Assessment festgehalten wird (Aiken et al. 2014).
Merke
Entscheidend ist jedoch bei der Nutzung aller Assessmentinstrumente, dass die Pflegende den diagnostischen Prozess beherrscht, dass sie weiß, was sie beobachten, fragen oder nachlesen muss, dass sie sorgfältig und überlegt dabei vorgeht. Denn von den Ergebnissen dieses Prozesses hängt das weitere Vorgehen ab.
4.7.3 Welche Arten von Instrumenten gibt es?
Assessmentinstrumente können unterschieden werden nach
-
dem Inhalt, den sie erfassen, und
-
ihrer Struktur.
4.7.3.1 Inhalte
Pflegerelevante Phänomene Zum Schwierigsten dürfte gehören, die gesamte Breite pflegerelevanter Phänomene in einem Instrument abzubilden. Hierzu zählt z. B. das ePA-AC (ergebnisorientierte PflegeAssessment AcuteCare, Hunstein 2009), das für die Nutzung im Krankenhaus erarbeitet wurde und inzwischen für andere Bereiche ebenfalls erhältlich ist. Die ganze Breite erfasst auch das RAI (Resident Assessment Instrument, Grebe et al. 2015), das für die Altenpflege entwickelt wurde. Ebenfalls für die Altenpflege nutzbar ist das Neue Begutachtungsassessment (NBA), das für die Beurteilung von Pflegegraden im Rahmen der Pflegeversicherung ab 2017 genutzt wird. Auch ohne die Berechnungen zur Pflegegradbemessung kann damit die individuelle Pflegebedürftigkeit erfasst werden (GKV-Spitzenverband 2011). Weitere Instrumente sind beschrieben in Bartholomeyczik et al. 2009 und Reuschenbach et al. 2011.
Instrumente für einzelne Pflegephänomene wie z. B. Schmerz, akute Verwirrtheit oder Fatigue sind dagegen einfacher und überschaubarer.
Risiken Die am längsten und häufigsten genutzten Assessmentinstrumente in der Pflege erfassen Risiken für negative Krankheitsfolgen, z. B. das Risiko für einen Dekubitus, für einen Sturz.
Pflegebedarf Häufig werden Instrumente auch genutzt, um den Pflegebedarf einzuschätzen und aufgrund der Ergebnisse z. B. eine Personalplanung durchführen zu können. Hier steht also nicht die individuelle Pflegeplanung im Vordergrund, sondern das Management. Meist wird dabei auch nicht vom pflegerelevanten Zustand eines Menschen ausgegangen, sondern von pflegerischen Leistungen wie z. B. bei der PPR (Pflegepersonalregelung) oder dem LEP (Leistungserfassung in der Pflege).
Fremdeinschätzung Es gibt Pflegephänomene, die nur der Betroffene selbst erfahren und wiedergeben kann, wie z.B. Schmerz oder Lebensqualität. Dennoch müssen derartige Phänomene auch bei Menschen festgestellt werden, die sich nicht entsprechend ausdrücken können, wie dies bei Kindern oder Menschen mit kognitiven Einschränkungen häufig der Fall ist. Hierfür wurden Instrumente entwickelt, die gezielte Beobachtungen unterstützen, um mit einer Fremdeinschätzung eine zuverlässige Pflegediagnostik betreiben zu können (vgl. Kapitel zu Schmerzeinschätzung).
4.7.3.2 Struktur
Checklisten
Assessmentinstrumente entsprechen manchmal einfachen Checklisten. Man erhält am Ende eine Übersicht, aus der hervorgeht, ob ein Themenbereich oder ein Phänomen vorhanden ist oder nicht. Checklisten erlauben oft keine individuelle Beurteilung der Situation; weiterführende Untersuchungen und Befragungen müssen durchgeführt werden, um Informationen zur Ableitung individueller Maßnahmen zu bekommen.
Fallbeispiel
Um z. B. Anzeichen für eine drohende oder bestehende Mangelernährung zu erfassen, kann für ein Screening eine einfache Checkliste genutzt werden ( ▶ Abb. 4.34).
Auch wenn die Checkliste einfach erscheint, setzt sie umfangreiche diagnostische Kenntnisse voraus. Und sie erfordert bei Vorliegen eines Anzeichens eine genauere Ursachensuche, um festzulegen, welche Maßnahmen erforderlich sind.
Checkliste Mangelernährung.
Abb. 4.34
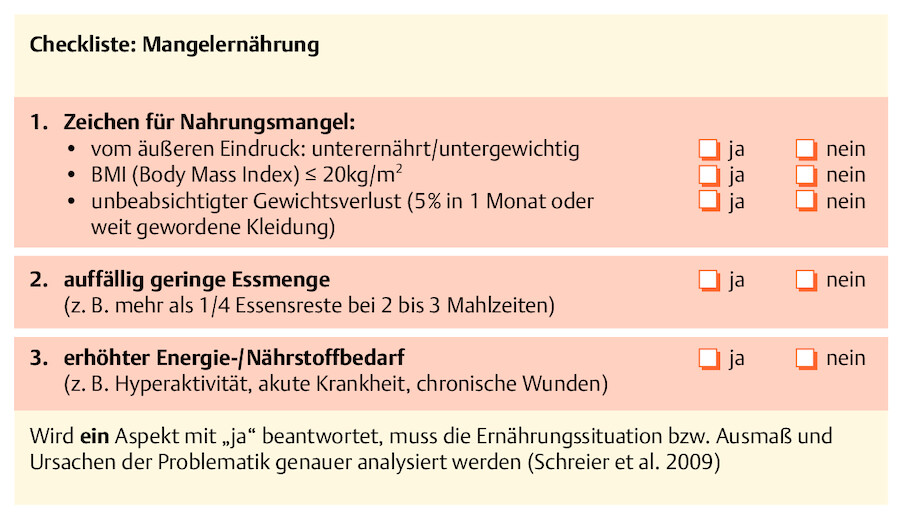
Algorithmen
Eine weitere Methode bei der Suche nach vorhandenen Gesundheitsproblemen ist die systematische Untersuchung anhand logisch aufeinander aufbauender Algorithmen. Dabei führt jeder einzelne Schritt bei einem entsprechenden Ergebnis zu einer vorgegebenen Maßnahme oder zu einem weiteren Untersuchungsschritt.
Ratingskalen
Eine weitere Erfassungsmethode ist, die Intensität eines einzelnen Gesundheitsproblems oder eines Risikos festzustellen.
Ratingskalen enthalten Abstufungen, die unterschiedlich vielfältig sein können. Gerne werden vierstufige Skalen genutzt, oft auch dreistufige. Ihre Vorteile liegen in der guten Verständlichkeit und im geringen Zeitaufwand.
Confusion Rating Scale Als Beispiel sei hier die „Confusion Rating Scale“ zur Erfassung von akuter Verwirrtheit (Williams 1979) aufgezeigt ( ▶ Tab. 4.7 ). In diesem Beobachtungsinstrument werden 4 Verhaltenskategorien unterschieden und gestuft. Die Schwierigkeit dieser Skala liegt darin, die genaue Definition der Items zu kennen, z.B. was ist inadäquate Kommunikation? Inadäquates Verhalten?
|
nicht aufgetreten (0) |
in leichter Form (1) |
in ausgeprägter Form (2) |
|
|
Desorientierung |
|||
|
inadäquate Kommunikation |
|||
|
inadäquates Verhalten |
|||
|
Illusion/Halluzination |
Smiley-Analogskala Die Gesichterskala ist ein Beispiel für eine gerne bei Kindern oder bei kognitiv eingeschränkten erwachsenen Menschen eingesetzte Skala zur Erfassung der Intensität von Schmerzen ( ▶ Abb. 4.35). Mit der entsprechenden Frage verbunden können die Gesichter auch für andere Phänomene genutzt werden.
Smiley-Analogskala.
Abb. 4.35 Sie dient der Schmerzselbsteinschätzung bei Kindern und kognitiv eingeschränkten Erwachsenen (Abb. nach: Hoehl M, Kullick P. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Thieme; 2012).
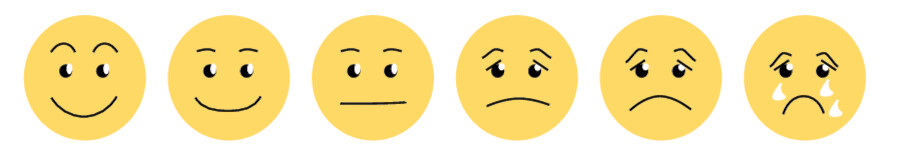
Visuelle Analogskala (VAS) Bei der VAS markiert der Patient seine Schmerzstärke auf einer 10 cm langen Linie ( ▶ Abb. 4.36).
Visuelle Analogskala.
Abb. 4.36
(Foto: K. Oborny, Thieme)

Auch die VAS kann verbunden mit einer anderen Frage für andere Inhalte genutzt werden, wie dies z. B. zur Messung der Fatigue gemacht wird (Glaus 2001).
Mehrdimensionale Skalen Bei der Schmerzeinschätzung werden auch mehrdimensionale Skalen eingesetzt. Ein Beispiel ist die CHEOPS (Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale), wobei verschiedene Verhaltensaspekte mit Punkten bewertet und zu einem Gesamtwert addiert werden (Lyon 2003). Je nach Ausprägung der 6 Items „Weinen“, „Gesichtsausdruck“, „verbale Mitteilung“, „Oberkörperhaltung“, „Anfassen, Berühren des Wundbereichs“ und die „Beinposition“ werden Punktwerte von 0 bis 3 vergeben. Liegt der errechnete Summenscore bei 4 und höher, wird dies als ein Anzeichen für Schmerzen interpretiert.
Merke
Die gewählten Beispiele können auch beliebig mit anderen Inhalten gefüllt werden. Wichtig ist jedoch, dass bei allen Assessmentinstrumenten die Inhalte, die Gesundheitsprobleme, Bewältigungsmöglichkeiten und Ressourcen in ihrer Form und Ausprägung so formuliert sein sollten, dass sich daraus Interventionen ableiten lassen.
4.7.4 Was sind gute Assessmentinstrumente?
Die Frage, welches Instrument das beste ist, lässt sich nicht ganz einfach beantworten. Es gibt Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, bevor ein Instrument mit viel Aufwand in die Praxis eingeführt wird. Niemand würde auf die Idee kommen, ein selbst gebasteltes Blutzuckergerät einfach auf die Station mitzubringen und damit alle Patienten zu untersuchen. Mit selbst gebastelten Assessmentinstrumenten passiert es leider häufig, obwohl sie genauso dazu da sind, (Pflege-)Diagnostik zu betreiben und ihre Ergebnisse Folgen für die Patienten haben. Deshalb sollten sie auch sorgfältig ausgesucht und bewertet werden.
4.7.4.1 Gütekriterien
Wichtige Gütekriterien für Instrumente können hier nur in Kürze angesprochen werden. Sie stammen in erster Linie aus der Forschung, wurden ursprünglich v. a. für psychologische Instrumente entwickelt und sollen für jede Art von Instrument gelten.
Allen voran sind 2 wichtige Kriterien zu nennen:
-
Reliabilität
-
Validität
Für alle Formen der Gütekriterien gibt es bestimmte Berechnungsverfahren.
Reliabilität
Definition
Die Reliabilität (Zuverlässigkeit, Genauigkeit) gibt Auskunft über die Fähigkeit eines Instruments, zuverlässige Ergebnisse zu produzieren, unabhängig von äußeren Kriterien wie Anwenderin oder Tageszeitpunkt.
Reliabilität sagt noch nichts darüber aus, ob die Inhalte des Instruments richtig sind, sondern sie ist ein Maß für die technische Genauigkeit des Instrumentes. Eine schlechte Reliabilität ist wie ein Metermaß aus Gummi: Wird die Länge eines Tisches mit einem Gummiband gemessen, wird das Gummiband jedes Mal eine andere Länge anzeigen. Wird sie dagegen mit einem Metermaß aus Metall gemessen, wird es jedes Mal das gleiche Ergebnis anzeigen, auch wenn verschiedene Personen messen.
Beobachterübereinstimmung Wenn zwei Pflegende, die die gleiche Qualifikation und die gleichen Kenntnisse über das Instrument haben, bei demselben Patienten zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen, taugt das Instrument nicht: Dies ist eine schlechte Beobachterübereinstimmung oder Interraterreliabilität.
Test-Wiederholungsreliabilität Die Ernährungssituation ist ein Kennzeichen, das sich nicht sehr schnell verändert, sie sollte innerhalb eines Tages kaum schwanken. Wenn dennoch dasselbe Instrument zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Ergebnisse erbringt, ist das Instrument schlecht: Die Test-Wiederholungsreliabilität oder Stabilität ist ungenügend.
Interne Konsistenz Eine völlig andere Art der Reliabilität betrifft nur jene Instrumente, die mit mehreren Items ein und denselben Sachverhalt erfassen wollen, z. B. Agitiertheit mit dem CMAI (Radzey 2009). Alle dort enthaltenen Items sollen das Gleiche messen, nämlich das Zielphänomen (Agitiertheit). Dies bezeichnet die interne Konsistenz.
Validität
Definition
Die Validität (Gültigkeit) gibt an, ob das Instrument wirklich das misst, was es zu messen vorgibt. Werden mit einer Schmerzskala wirklich Schmerzen gemessen oder eher Angst? Erfasst ein Ernährungsassessment den Ernährungszustand einer Person oder nur den Körperbau und das Speisenangebot der Einrichtung?
Validität ist weitaus schwieriger zu prüfen und zu interpretieren als die Reliabilität. Grundsätzlich gilt aber auch, dass ein Instrument nicht ausreichend valide sein kann, wenn es keine ausreichende Reliabilität aufweist.
Inhaltsvalidität Bei der Inhaltsvalidität, der einfachsten Form mit der schwächsten Aussage, werden Experten zu einem bestimmten Thema befragt, ob das zu prüfende Instrument die wesentlichen Aspekte erfasst.
Kriteriumsvalidität Bei der Prüfung der Kriteriumsvalidität wird das Ergebnis der Einschätzung mit einem sicheren Kriterium verglichen. So könnten bestimmte Blutwerte als ein externes Kriterium für ein Instrument zur Erfassung von Mangelernährung fungieren. Voraussetzung ist aber, dass das Kriterium oder der Vergleichstest selbst mit Sicherheit valide ist (Goldstandard). Und genau das ist ein großes Problem, nicht nur in der Pflegeforschung, denn ein Goldstandard ist selten zu finden.
Konstruktvalidität Mit der Konstruktvalidität soll die Frage beantwortet werden, ob das Instrument den theoretisch definierten Inhalt (Konstrukt) wirklich misst.
Praktikabilität
Neben Reliabilität und Validität sollte ein Instrument auch praktikabel sein. Auch ein „perfektes“ Instrument im Sinne von Validität und Reliabilität setzt sich in der Praxis nur dann durch, wenn nicht zu viel Zeit für die Anwendung benötigt wird, wenn Informationen erfasst werden, die auch in der täglichen Routine zu bekommen sind und zur Entscheidung über weiterführende Maßnahmen verhelfen ( ▶ Abb. 4.37).
Assessmentinstrumente müssen praktikabel, zeitsparend und leicht umsetzbar sein.
Abb. 4.37
(Foto: K. Oborny, Thieme)

4.7.5 Wo liegen die Gefahren bei der Nutzung?
Grenzen und Gefahren bei der Nutzung von Assessmentinstrumenten sind:
-
Ein Assessmentinstrument zu nutzen, um es dann säuberlich abzuheften und nie mehr anzusehen, ist überflüssig.
-
Ebenso überflüssig ist es, ein Assessmentinstrument als Ersatz für fachliche Expertise zu betrachten. Viele Menschen glauben, Instrumente könnten ohne Reflexion eingesetzt werden. So soll es vorgekommen sein, dass ein offensichtlich schmerzgeplagter Patient sich zu seinen Kommunikationsfähigkeiten, seinen Atemproblemen und anderen Selbstpflegefähigkeiten äußern musste, bevor er das zentrale Problem Schmerz ansprechen durfte, nur weil die vorliegende Checkliste diese Reihenfolge vorgab. Wenn ein standardisiertes Instrument also dazu verführt, das Denken und das Hineindenken in den Patienten zu vernachlässigen, dann ist dies ein Missbrauch. Hermeneutische Kompetenz in dem Sinne, den „Fall“ auch aus der Sicht des „Falles“ rekonstruieren zu können, ohne dabei die professionelle Sicht aufzugeben, ist neben den Kenntnissen der wissenschaftlichen Grundlagen Voraussetzung für eine gute Pflegediagnostik (Schrems 2008, ▶ Abb. 4.38).
-
Die Nutzung von Assessmentinstrumenten verlangt eine spezifische Expertise. Neben der Tatsache, dass der Nutzer mit dem Instrument umgehen können und wissen muss, wie die Informationen fachgerecht gesammelt werden, muss er beurteilen können, ob das Instrument in der speziellen Situation überhaupt angebracht ist. Instrumente können sehr sinnvoll und hilfreich sein, wenn ihre Form nicht mit dem Inhalt verwechselt wird, d. h., wenn sie als Hilfsmittel verwendet werden, das von qualifizierten Pflegenden zur Unterstützung ihrer Arbeit genutzt wird.
-
Einzelne Assessmentinstrumente, die an ein vorhandenes Dokumentationssystem angehängt werden, ohne zu überprüfen, ob die benötigten Informationen bereits durch andere Teile des Dokumentationssystems erfasst werden, sind ebenfalls nicht zielführend. Das führt zu Doppeldokumentation mit all den damit verbundenen Frustrationen. Standardisierte Assessmentinstrumente müssen in das gesamte Dokumentationssystem integriert sein.
Pflegediagnostik erfordert Fallverstehen.
Abb. 4.38
(Foto: A. Fischer, Thieme)

4.7.6 Für welches Instrument sollte man sich entscheiden?
Für die Entscheidung, welches Instrument man nimmt, muss vorher geklärt sein, was man damit machen möchte:
-
Was ist das Ziel des Instruments (Pflegebedarfserfassung, Risikoeinschätzung usw.)?
-
Für welchen Pflegebereich wird das Instrument benötigt (Krankenhaus, häusliche Pflege, Altenheim usw.)?
-
Für welche Patienten-, Bewohnergruppe (alt oder jung, Geriatrie oder Pädiatrie, bestimmte Erkrankungen, bestimmte Pflegediagnosen usw.)?
Die gefundenen Instrumente werden dann nach folgenden Fragen verglichen:
-
Mit welchem Ziel wurde das Instrument entwickelt? Die Norton-Skala wurde z. B. zur Einschätzung eines Dekubitusrisikos für geriatrische Patienten entwickelt, wird aber mittlerweile für andere Patientengruppen angewandt. Das ist generell nicht verwerflich, die Skala sollte dann aber auch für diese neue Zielgruppe auf ihre Gütekriterien untersucht sein.
-
Aus welcher Disziplin kommt das Instrument? Lässt dies die Fokussierung auf Erfordernisse für die Pflege erwarten?
-
Wann wurde das Instrument entwickelt? Bei alten Instrumenten können neue wichtige Erkenntnisse dazugekommen sein, die noch nicht berücksichtigt wurden.
Weiter ist wichtig zu wissen:
-
Wer füllt das Instrument aus? Ist es für die Selbsteinschätzung geeignet (Patient füllt es selbst aus). Oder wird es von einer außenstehenden Person eingesetzt (Fremdeinschätzung)? Muss diese Person dann den Patienten gut kennen?
-
Ist das Instrument klar formuliert und unkompliziert in der Sprache für die Anwender?
-
Wie umfangreich ist das Instrument? Ein kurzes Instrument wird eher akzeptiert, büßt aber immer an Informationsqualität ein.
-
Sind Schulungen notwendig? Generell muss die Anwendung geschult werden, denn es gibt fast immer Meinungsverschiedenheiten, was das Verstehen und Bewerten von Instrumentinhalten betrifft. Dennoch muss gefragt werden, wie umfangreich die Schulungen sein sollen und was sie kosten.
-
Wie kommt man an die für das Instrument benötigten Informationen? Lassen sich alle beim Patienten erfragen, ist längere Beobachtung erforderlich? Müssen andere Therapeuten, Angehörige, Kollegen konsultiert werden? Wie wird das Assessmentinstrument ausgewertet? Zahlreiche Instrumente haben als Ergebnis einen Summenwert, andere gar nichts. Wie werden die Daten interpretiert? Gibt es dazu verbindliche Richtlinien und Referenzwerte? In selteneren Fällen muss man sich die Auswertungsinformationen kaufen oder gar die gesamten Daten zur Auswertung verschicken. Das kostet Zeit und Geld. Lohnt es sich?
4.8 Case Management
Definition
Case Management ist – vereinfacht formuliert – ein Instrument zur einzelfallbezogenen Steuerung der Versorgung von Menschen mit komplexen sozialen und gesundheitlichen Problemlagen.
Versorgungsangebote unterschiedlicher Form und Intensität, die von mehreren Leistungsanbietern (z. B. Pflege, Medizin, Physiotherapie, Sozialarbeit) aus einem oder mehreren Sektoren (ambulant, teilstationär oder stationär) erbracht werden, sollen zu einem gemeinsamen Paket geschnürt und nahtlos miteinander verschränkt werden (Versorgungsintegration). Zudem sollen durch Case Management anhaltende und langfristig angelegte Versorgungsstrategien entwickelt werden (Versorgungskontinuität), wobei sich die Leistungsanbieter untereinander und mit den Nutzern auf gemeinsame Ziele und Ergebnisse für die Versorgung verständigen (Ergebnisorientierung).
4.8.1 Anforderungswandel
Notwendig wird der Einsatz von Case Management zum einen, weil sich die Anforderungen aufseiten der Nutzer von Gesundheitsversorgung verändert haben. Hinzuweisen ist auf die wachsende Zahl älterer Menschen und die Zunahme chronischer Gesundheitsbeeinträchtigungen mit langfristigen Verläufen sowie komplexen physischen, psychischen und sozialen Belastungsprofilen.
Zur Beantwortung dessen sind anhaltende Unterstützungsstrategien und ineinandergreifende Hilfeangebote unterschiedlicher Berufsgruppen erforderlich. Weil sich die unterschiedlichen Helfer aber zumeist einseitig auf akute und kurzfristig heilbare Gesundheitsprobleme und medizinische Interventionen konzentrieren, werden sie den veränderten Anforderungen aufseiten der Nutzer kaum gerecht ( ▶ Abb. 4.39).
Veränderte Anforderungen.
Abb. 4.39 Herr F. wohnt mit seiner Frau in einer kleinen Etagenwohnung am Stadtrand.
(Foto: K. Oborny, Thieme)

4.8.2 Struktur- und Funktionsdefizite
Auch die Struktur und die Funktionsweise moderner Gesundheitssysteme erweisen sich als hinderlich für eine bedarfsgerechte Versorgung. Für die Nutzer sind sie oft nur schwer zu durchschauen und nicht immer wissen sie, an wen sie sich mit ihren Problemen wenden können. Die unterschiedlichen Hilfsangebote liegen vielfach wie die Teile eines durcheinandergewirbelten Puzzles nebeneinander und lassen sich oft nur mit viel Wissen, Fantasie und Kreativität zu einem kontinuierlichen und integrierten Versorgungspaket zusammenfügen.
Doch nicht nur für die Nutzer ist das Versorgungssystem inzwischen völlig unübersichtlich geworden. Auch die professionellen Helfer (Ärzte, Pflegende, Sozialarbeiter) können bei der Suche nach Unterstützung nur selten die notwendige Orientierung bieten.
Fallbeispiel
Als Paul Meier mit der Case Managerin in Kontakt kam, war er 78 Jahre alt und aufgrund akuter Verwirrtheit kaum ansprechbar. Zwei Tage zuvor war er wegen Verdacht auf akute Pneumonie über die Notaufnahme ins örtliche Kreiskrankenhaus aufgenommen worden. In der Krankengeschichte finden sich u. a. Hinweise auf die vor Jahren erfolgte Implantation eines Herzschrittmachers, eine chronisch-obstruktive Lungenerkrankung sowie eine leichte bis mittlere Demenz.
Seine Frau leidet an Osteoporose und Nierenproblemen, dennoch bewältigt sie die anfallenden Aufgaben bei der Pflege ihres Mannes und der Versorgung des gemeinsamen Haushalts weitgehend eigenständig. Der gemeinsame Sohn lebt an einem anderen Ort und kann seine Eltern nur gelegentlich besuchen.
Im letzten Jahr wurde Paul Meier insgesamt 9-mal ins Krankenhaus aufgenommen, in 5 Fällen ungeplant über die Notaufnahme. Die Demenz nahm in diesem Zeitraum immer mehr zu und die Situationen, in denen er zu Hause hilflos umherirrte, häuften sich. An einem besonders schlimmen Wochenende musste Frau Meier einen Notarzt zu Hilfe rufen. Dieser kannte den Patienten nicht und veranlasste eine erneute Noteinweisung ins Krankenhaus.
Dort plädierte der behandelnde Arzt nachdrücklich für eine Heimeinweisung. Neben dem labilen Gesundheitszustand und der Pflegebedürftigkeit war hierfür auch die sich verschlechternde Situation der Ehefrau von Herrn Meier ausschlaggebend. Lange würde sie die Pflege von Herrn Meier nicht mehr allein übernehmen können. Zudem drängten die Kostenträger auf eine dauerhafte und kostengünstige Lösung. Das Paar sprach sich jedoch vehement gegen eine Heimeinweisung aus. Neben der damit verbundenen Trennung fürchteten sie auch die hohen mit dem Heimaufenthalt verbundenen Kosten.
Die in dieser Situation hinzugezogene Case Managerin verfolgte das Ziel, kostenintensive Noteinweisungen in Zukunft zu vermeiden, die Zusammenarbeit mit den ambulanten Einrichtungen reibungsloser zu gestalten und v. a. die individuelle Versorgung des Paares zu verbessern und über die Sektoren hinweg ergebnisorientiert zu gestalten.
4.8.3 Ziele von Case Management
Case Management dient dazu, ausgewählte Nutzer mit besonders komplexen Problemlagen über eine längere Zeitspanne oder auch den gesamten Krankheitsverlauf hinweg zu begleiten, die arbeitsteilig erbrachte Versorgung untereinander abzustimmen und Hilfsangebote aus unterschiedlichen Sektoren und Organisationen miteinander zu verzahnen.
Ferner zielt Case Management darauf ab ( ▶ Abb. 4.40)
Individuelles pflegerisches Case Management.
Abb. 4.40 Aufgaben und Ziele (nach Mahn u. Spross 1996).
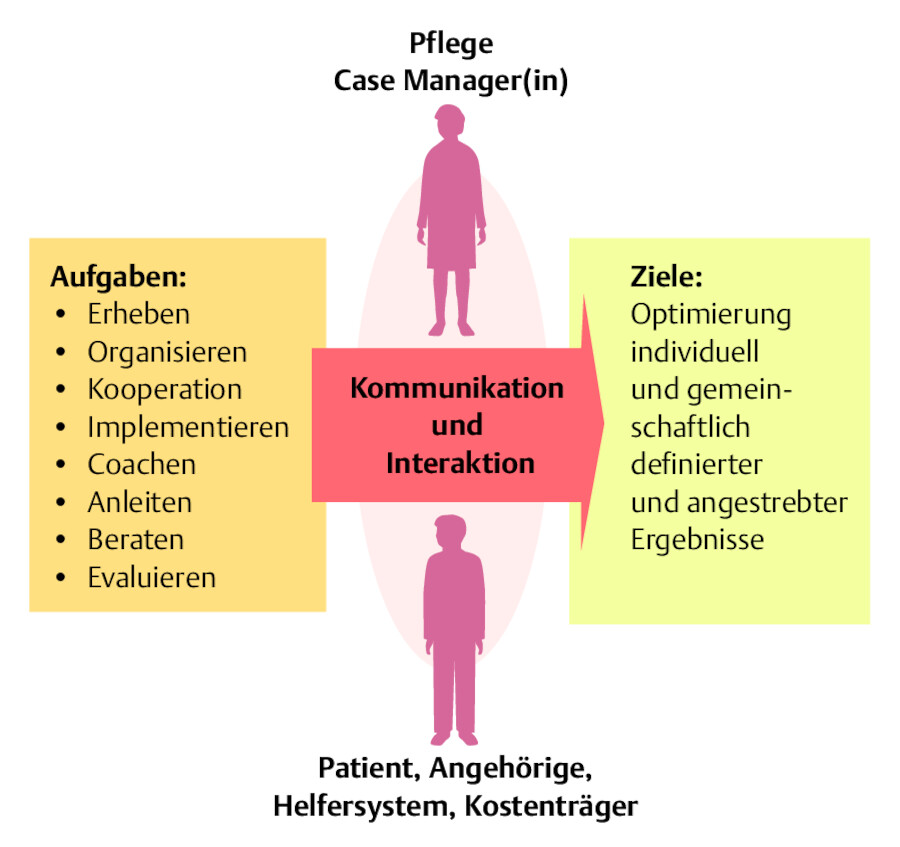
-
den Nutzern ein höheres Maß an sozialer Zuwendung, Information und Beratung anzubieten und sie als Partner in der Versorgungsgestaltung einzubinden,
-
die vielfältigen Übergänge und Krisen im Krankheitsverlauf durch hinreichend kontinuierliche Versorgungsangebote zu begleiten und zu beantworten,
-
mit den professionellen Helfern langfristige, auf Kontinuität und Verlässlichkeit angelegte Versorgungsstrategien zu entwickeln,
-
den Zugang zu Versorgungsangeboten zur richtigen Zeit, auf dem richtigen Niveau und im richtigen Umfang zu erleichtern,
-
die Ein- und Ausgliederung von Patienten in Versorgungszusammenhänge (z. B. in das Krankenhaus) durch geeignete Verfahren reibungslos zu gestalten,
-
vorhandene Ressourcen besser zu nutzen und die Wirksamkeit (Effektivität) und Wirtschaftlichkeit (Effizienz) gesundheitsrelevanter Leistungen zu erhöhen.
4.8.4 Konzeptionelle Aspekte
Konzeptionell kann unterschieden werden zwischen
-
gemeindebasiertem Case Management und
-
krankenhausbasiertem Case Management.
4.8.4.1 Gemeindebasiertes Case Management
Beim gemeindebasierten Case Management sind die Case Manager in einem ambulanten Dienst, bei einer Behörde oder einer Krankenversicherung angesiedelt und begleiten die Nutzer auch während ihrer zumeist kurzen Krankenhausaufenthalte.
4.8.4.2 Krankenhausbasiertes Case Management
Beim krankenhausbasierten Case Management wird das Case Management von Krankenhäusern und Gesundheitszentren angeboten. Aufgaben der ▶ Pflegeüberleitung und Funktionen des Sozialdienstes werden dabei oftmals mit dem Case Management verknüpft.
Wichtig ist aber, dass die Verantwortung der Case Manager nicht an der Krankenhauspforte endet, sondern vielmehr weit in den ambulanten Bereich und den Alltag der Nutzer hineinreicht. Hierfür müssen sie zwangsläufig die Grenzen von Professionen, Organisationen und Sektoren überschreiten und ihren Verantwortungs- und Handlungsbereich erweitern.
Von anderen, derzeit viel diskutierten Steuerungsinstrumenten – z. B. Care Management, Disease Management, Pathway Management, Inanspruchnahme-Management – unterscheidet sich Case Management v. a. dadurch, dass es sich lediglich auf wenige ausgewählte Nutzer mit besonders komplexen Problemlagen und ihr soziales Umfeld konzentriert.
Kernfunktionen und Rollen
Case Manager übernehmen 3 unterschiedliche Kernfunktionen und Rollen, die im Alltag miteinander kombiniert und in unterschiedlicher Weise gewichtet werden:
-
anwaltschaftliche Funktion („Advocate“)
-
vermittelnde Funktion („Broker“)
-
selektierende Funktion („Gate Keeper“)
Anwaltschaftliche Funktion
In der anwaltschaftlichen Funktion („Advocate“) stellen sie sich konsequent an die Seite des Nutzers und bemühen sich um eine bedarfs- und bedürfnisgerechte Ausrichtung vorhandener Dienstleistungen. Sie achten auf die Qualität der Leistungen und einen ungehinderten Zugang. Gelegentlich setzen sie sich auch für die Schaffung notwendiger neuer Angebote ein.
Vermittelnde Funktion
In der vermittelnden Funktion („Broker“) versuchen Case Manager für den Nutzer optimale Versorgungsangebote ausfindig zu machen. Dabei greifen sie auf ihre Kenntnisse über die Angebote des Gesundheitsmarktes zurück. Sie sind neutrale Vermittler zwischen den Interessen von Nutzern und Anbietern sozialer und gesundheitsrelevanter Dienstleistungen.
Selektierende Funktion
In der selektierenden Funktion („Gate Keeper“) kontrollieren Case Manager den Zugang des Nutzers zu vorhandenen Ressourcen sowie seinen Anspruch auf Leistungen. Sie beantragen die notwendigen Mittel für die Versorgung bei den Kostenträgern und übernehmen Verantwortung für eine ausgaben- und ergebnisorientierte Steuerung des gesamten Versorgungsprozesses.
Während die anwaltschaftliche Seite von Case Management besonders bei sozial- oder gesundheitlich benachteiligten Personengruppen wie z. B. Migranten oder psychisch Kranken gefragt ist, wird die selektierende Seite häufig im stationären Sektor bei der Versorgung von kostenintensiven Nutzern (z. B. Schlaganfallpatienten) oder auch in der primären Gesundheitsversorgung nachgefragt. Die vermittelnde Funktion ist letztlich in allen Case-Management-Konzepten enthalten, sie wird aber z. B. in Koordinationsstellen oder auch Pflegestützpunkten besonders betont.
4.8.5 Methodische Aspekte
4.8.5.1 Case-Management-Regelkreislauf
Beim Case Management wird methodisch auf ein Phasenmodell von einzelnen, logisch aufeinander aufbauenden Arbeitsschritten zurückgegriffen, das dem Pflegeprozess nicht unähnlich ist. Der sogenannte Case-Management-Regelkreislauf ( ▶ Abb. 4.41) besteht aus folgenden Schritten:
Case-Management-Regelkreislauf.
Abb. 4.41
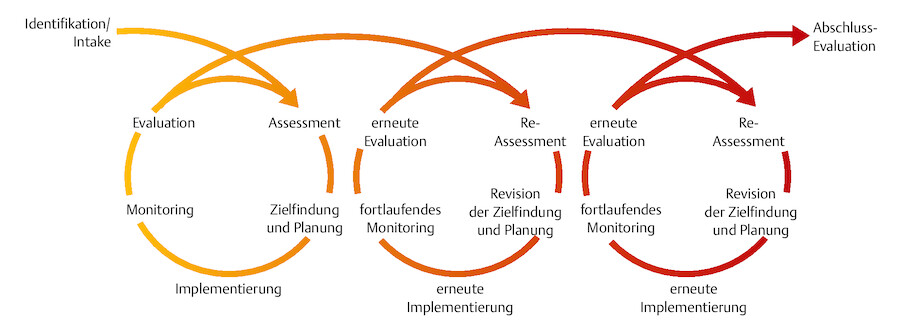
-
Identifikation/Intake: aktives Auffinden von denjenigen Nutzern, die von Case Management in besonderer Weise profitieren können
-
Assessment: systematische Erhebung und Analyse individueller Versorgungsbedürfnisse und objektiv feststellbarer Problem- und Bedarfslagen
-
Zielfindung und Planung: Vereinbarung von kurz-, mittel- und langfristigen Versorgungszielen und Entwicklung eines entsprechenden Versorgungsplans
-
Implementierung: Umsetzung des Versorgungsplans durch aktive Verbindung der einzelnen Komponenten
-
Monitoring: kontinuierliche Überprüfung der Zielerreichung, der Qualität und der Effizienz der erbrachten Leistungen
-
Evaluation: abschließende Auswertung der erbrachten Leistungen bzw. der durchgeführten Koordination nach zuvor vereinbarten Kriterien
Der Unterschied zum Pflegeprozess besteht v. a. darin, dass beim Case-Management-Regelkreislauf eine professions- und organisationsübergreifende Perspektive angelegt wird. Zudem wird er lediglich bei ausgewählten Patienten angewendet.
Anforderungen
Case Manager benötigen ausgeprägte soziale und kommunikative Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick und spezielle methodische Kompetenzen (z. B. für die Durchführung von Assessmentverfahren, Zielfindungs- und Planungsprozessen oder die Evaluation). Wer am ehesten als Case Manager geeignet ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Prinzipiell können Angehörige aller Gesundheits- und Sozialberufe Case-Management-Funktionen übernehmen: Die Pflege engagiert sich in diesem Bereich genauso wie die Sozialarbeit oder – wenngleich in deutlich geringerem Maße – auch die Medizin.
International wird mindestens ein Bachelorabschluss als Voraussetzung für die Übernahme dieser anspruchsvollen Aufgaben angesehen. Hierzulande gelten derzeit aufgrund anderer Ausbildungsstrukturen – insbesondere in der Pflege – niedrigere Qualifizierungsstandards. Um dennoch eine hohe Qualität der Arbeit gewährleisten zu können, hat die Deutsche Gesellschaft für Care und Case Management spezielle Fort- und Weiterbildungsangebote entwickelt und ein Zertifizierungsverfahren für künftige Case Manager eingeführt (http://www.dgcc.de).
Effekte von Case Management
Richtig angewendet, verspricht Case Management Ergebnisse auf unterschiedlichen Ebenen:
-
Patientenebene: Auf der Patientenebene können durch den Einsatz von Case Management Krisen vermieden, ein erhöhtes subjektives Wohlbefinden, verbessertes Gesundheitsverhalten und Selbstmanagement sowie ein höheres Maß an Zufriedenheit mit der Versorgung erreicht werden.
-
Systemebene: Auf der Systemebene trägt Case Management zur Vermeidung von Über-, Unter- und Fehlversorgung bei, hilft, unnötige Ausgaben zu verhindern und die Qualität, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu sichern.
-
Mitarbeiterebene: Auf der Mitarbeiterebene können Reibungsverluste durch den Einsatz von Case Management abgebaut, die Kommunikation untereinander verbessert, die Transparenz des Versorgungsgeschehens erhöht und die Arbeitszufriedenheit insgesamt gesteigert werden.
Fallbeispiel
Nachdem Paul Meier in das Case-Management-Programm aufgenommen wurde (Identifikation/Intake), leitete die Case Managerin zunächst ein ausführliches Assessment ein, um die Problem- und Bedarfslagen sowie die Ressourcen und Möglichkeiten von Paul Meier und seinem sozialen Umfeld zu erheben. In einem aufwendigen Aushandlungsprozess mit allen betroffenen Parteien wurde festgelegt, dass die Eheleute in ihrem Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Eigenständigkeit unterstützt werden sollen. Zugleich sollte Krisensituationen, unnötigen Krankenhausaufenthalten oder einer Überlastung der Hauptpflegeperson präventiv begegnet werden.
Basierend auf diesem Ziel entwickelte die Case Managerin einen von allen Beteiligten akzeptierten Versorgungsplan (Zielfindung und Planung). Bei dessen Erstellung bemühte sie sich darum, die zur Verfügung stehenden Ressourcen maximal auszunutzen und sich auf mögliche Komplikationen (z. B. Ausfall der Hauptpflegeperson, Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Paul Meier) vorausschauend vorzubereiten.
Innerhalb eines Jahres wurde u. a. ein informelles Hilfe- und Unterstützungsnetz etabliert, das die Ehefrau von Herrn Meier als Hauptpflegeperson gelegentlich entlasten konnte. Zudem wurden Sozialleistungen beantragt, um dem Paar punktuell professionelle Unterstützung gewähren zu können (Implementierung). Das Ehepaar wurde im Umgang mit den medizinischen Therapien, den erforderlichen Pflegemaßnahmen und der Verwendung eines Hausnotrufsystems geschult und angeleitet. Quantität und Qualität der erbrachten Leistungen wurden überwacht und die Leistungserbringer im Bedarfsfall angepasst. Wöchentliche Telefonkontakte stellten im ersten Monat nach der Entlassung von Paul Meier die Verbindung zwischen der stationären und der häuslichen Versorgung sicher, zudem wurden im weiteren Verlauf punktuell Hausbesuche durchgeführt (Monitoring).
Der gesamte zeitliche Aufwand für das Case Management betrug in diesem Fall insgesamt 82 Stunden im Verlauf der ersten 12 Betreuungsmonate. Darin eingeschlossen waren die persönlichen Kontakte und Telefonate zu Beginn des Prozesses, die Follow-up-Gespräche mit Paul und Paula, die beiden Hausbesuche sowie die Beratung mit den direkten Leistungserbringern (Medizinern, Pflegenden, Sozialarbeitern usw.) und die Dokumentation des Fallverlaufs.
Nach 12 Monaten Betreuungszeit konnte als Ergebnis des Case-Management-Prozesses festgehalten werden (Evaluation):
-
Paul und Paula Meier konnten in ihrer häuslichen Umgebung verbleiben, eine Heimeinweisung und Trennung des Paares wurden erfolgreich vermieden ( ▶ Abb. 4.42).
-
Die kostenintensiven und planungsaufwendigen Notfalleinweisungen blieben durch die frühzeitige Intervention der Case Managerin aus.
-
Die kontinuierliche häusliche Versorgung durch ehrenamtliche und professionelle Helfer wurde von beiden akzeptiert und war ohne unverhältnismäßigen Aufwand finanzierbar.
-
Eine Verschlechterung der Demenz von Paul Meier wurde innerhalb dieses Zeitraums nicht beobachtet und die Selbstpflegefähigkeiten des Paares wurden stabilisiert.
-
Paula konnte nach einem kurzfristigen Krankenhausaufenthalt wieder genesen und als Hauptpflegeperson erhalten werden.
Der zuständige Hausarzt unterstützte den Case-Management-Prozess und zeigte sich mit der Versorgungsqualität zufrieden.
Trennung vermeiden.
Abb. 4.42 Wie in dem hier beschriebenen Fallbeispiel können durch erfolgreiches Case Management Heimeinweisungen und damit verbundene Trennungen pflegebedürftiger Paare vermieden werden.
(Foto: Robert Kneschke/adobe.stock.com)

4.9 Rechtliche Rahmenbedingungen der Pflege
Die Pflege von kranken und alten Menschen hat zum Ziel, bei der Heilung, Erkennung und Verhütung von Krankheiten mitzuwirken sowie älteren Menschen dabei zu helfen, ihre körperliche, geistige und seelische Gesundheit zu fördern, zu erhalten und wiederzuerlangen.
Die Erfüllung dieser Aufgaben muss innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen erfolgen. Für Pflegende ist es wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu kennen, denn „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht!“
4.9.1 Grundrechtliche und berufsrechtliche Vorgaben
Im Rahmen seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz hat der Bund von seiner Möglichkeit gemäß Artikel 74 I Nr. 19 GG Gebrauch gemacht und das Krankenpflegegesetz (2004) und das Altenpflegegesetz (2003) erlassen.
4.9.1.1 Vorgaben durch das Grundgesetz
Menschenwürde
Merke
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ (Art. 1 I GG)
Träger der Menschenwürde ist bereits die befruchtete Eizelle, sodass mit ihr nicht nach Belieben verfahren werden kann. Die gesetzlichen Grenzen im Umgang mit diesen Embryos ergeben sich aus den Embryonenschutzgesetz.
Die Menschenwürde endet auch nicht mit dem Tod des Menschen. Sie dauert darüber hinaus an, was zur Folge hat, dass auch die Schweigepflicht nicht mit dem Tode des Patienten endet. Auch der frische Leichnam genießt als solcher noch Menschenwürde, sodass eine pietätvolle Beisetzung unter Achtung der Menschenwürde verpflichtend ist.
Der Krankenhausträger ist dazu verpflichtet, die Menschenwürde seiner Patienten zu achten. Hierzu gehören u.a. die Information zu geplanten Behandlungen und die Integration in den Behandlungsprozess. Eine Behandlung darf nur nach Absprache mit dem Patienten oder ggf. mit dessen gesetzlichem Vertreter erfolgen.
Freiheit der Person
Merke
„Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.“ (Art. 2 I GG)
In Art. 2 I GG und in der Beachtung der Menschenwürde liegt das Selbstbestimmungsrecht des Patienten begründet. Dieser allein ist es, der darüber entscheidet, ob er behandelt wird, in welchem Umfang er behandelt wird und ob eine medizinische Behandlung fortgeführt oder eingestellt wird. Es kommt ganz allein auf den Willen des Patienten an, soweit dieser in der Lage ist, die Entscheidung in ihrer vollen Tragweite zu verstehen. ▶ Abb. 4.43 zeigt die Inhalte des Grundrechtes auf Freiheit der Person.
Inhalt des Grundrechtes auf Freiheit der Person (nach Hell 2013).
Abb. 4.43
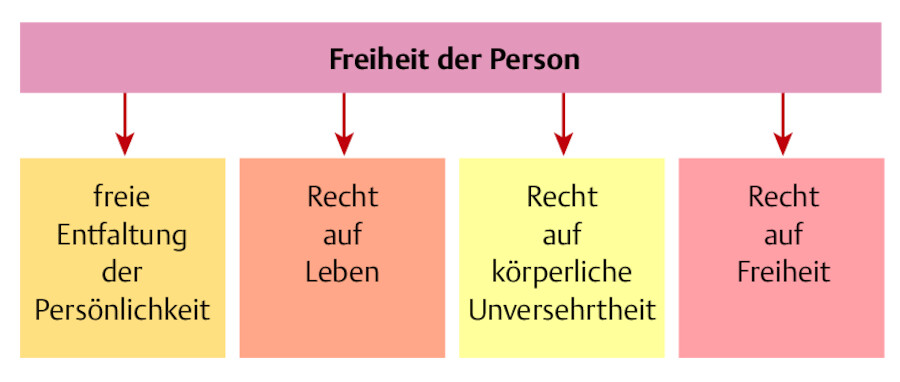
Glaubens- und Gewissensfreiheit
Merke
„Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.“ (Art. 4 I GG)
Verweigert ein Patient aus religiösen Gründen bestimmte Maßnahmen im Krankenhaus, ist dies zu respektieren. So darf z.B. keine Bluttransfusion durchgeführt werden, wenn der Patient dies im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ablehnt.
4.9.1.2 Krankenpflegegesetz und Prüfungsverordnung
Mit dem „Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege“ (KrPflG) vom 16. 07. 2003 wurden die Berufsbezeichnungen „Gesundheits- und Krankenpflegerin“ bzw. „Gesundheits- und Krankenpfleger“ sowie „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“ und „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“ eingeführt.
§ 2 KrPflG Das Gesetz regelt die Voraussetzungen, unter denen diese Berufsbezeichnungen geführt werden dürfen. Dies ist der Fall, wenn die gesetzliche Ausbildungszeit abgeleistet und die staatliche Prüfung bestanden wurde, kein Verhalten vorliegt, aus dem sich die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt, und in gesundheitlicher Hinsicht die Eignung zur Ausübung des Berufs gegeben ist. Liegen diese 3 Voraussetzungen vor, ist die Erlaubnis zur Führung der oben erwähnten Berufsbezeichnung zu erteilen; unter bestimmten Voraussetzungen kann diese Erlaubnis auch zurückgenommen bzw. widerrufen werden (§ 2 I, II KrPflG).
§ 3 KrPflG Im § 3 KrPflG ist das Ausbildungsziel dahin gehend festgelegt, dass die Ausbildung „entsprechend dem allgemein anerkannten Stand pflegewissenschaftlicher, medizinischer und weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse fachliche, personale, soziale und methodische Kompetenzen zu verantwortlichen Mitwirkung insbesondere bei der Heilung, Erkennung und Verhütung von Krankheiten vermitteln soll“. Darüber hinaus werden konkrete Aufgaben beschrieben, deren eigenverantwortliche Ausführung Ziel der Ausbildung ist (§ 3 II KrPflG).
§ 4 bis § 6 KrPflG Das Gesetz regelt darüber hinaus die Dauer und Struktur der Ausbildung (§ 4), die Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung (§ 5) und die Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen (§ 6).
§ 9 bis § 18 KrPflG Im Abschnitt 3 des KrPflG (§ 9 bis § 18) werden arbeitsrechtliche Belange geregelt, wie Abschluss des Ausbildungsvertrages, Rechte und Pflichten des Schülers, Ausbildungsvergütung, Probezeit, Ende des Ausbildungsverhältnisses und dessen Kündigung.
Ausblick Zum Redaktionsschluss dieses Buches im Frühsommer 2017 zeichnet sich folgende Kompromisslinie ab: Demnach wird es eine zweijährige generalistische Grundausbildung geben. Im 3. Jahr können die Auszubildenden zwischen einem Abschluss als generalistische Pflegefachkraft oder einem Abschluss in den bisherigen Berufen „Altenpflege" oder „Gesundheits- und Kinderkrankenpflege" wählen.
4.9.2 Pflegerelevante Rechtsgebiete
Alle Mitarbeiter in einem Krankenhaus, aber auch die Patienten und Besucher stehen in verschiedenen Rechtsbeziehungen zueinander. Die Rechtsgebiete des Zivilrechts, des Strafrechts und des Arbeitsrechts sind für alle Pflegenden bindend.
4.9.2.1 Rechtsbeziehungen im Krankenhaus
Sämtliche im Krankenhaus anzutreffenden Personen (Patienten, Ärzte, Pflegende, Besucher) und das Krankenhaus selbst stehen in rechtlichen Verhältnissen zueinander, seien es vertragliche Beziehungen oder auch nur Rechtsbeziehungen kraft Gesetzes.
Rechtsbeziehungen zwischen Patienten und Krankenhaus Bei der Aufnahme des Patienten in ein Krankenhaus schließt dieser zunächst einen Krankenhausaufnahmevertrag. Wird ein Patient als Notfall in eine Klinik gebracht und ist nicht ansprechbar, kommt zunächst kein Vertrag zustande. Die Aufnahme der Krankenbehandlung erfolgt unter dem Gesichtspunkt der „Geschäftsführung ohne Auftrag“ (§ 677 BGB). Ist der Patient geschäftsfähig und wieder weitgehend stabil, wird nachträglich ein Vertrag unterzeichnet.
Rechtsbeziehungen zwischen Patienten und Pflegenden Befindet sich der Patient im Krankenhaus, so kommt dort zwischen ihm und den Pflegepersonen keine vertragliche Beziehung zustande. Die Pflegenden leisten ihre Arbeit aufgrund des mit dem Krankenhaus geschlossenen Arbeitsvertrags und sind insoweit als Erfüllungsgehilfen und Verrichtungsgehilfen tätig. Deswegen haben sie auch keinen Honoraranspruch gegenüber dem Patienten, sondern nur einen Lohnanspruch gegenüber ihrem Arbeitgeber, dem Krankenhaus.
Rechtsbeziehungen des Besuchers mit dem Krankenhaus und seinen Mitarbeitern Besucher oder sonstige Außenstehende, die sich in ein Krankenhaus begeben und sich dort aufhalten, haben keinerlei vertragliche Beziehung mit dem Krankenhaus und dessen Mitarbeitern. Dennoch stehen sie insofern in Rechtsbeziehungen mit dem Krankenhaus und den dort Beschäftigten, als es neben den Schuldverhältnissen aus Verträgen auch gesetzliche Schuldverhältnisse gibt, wie z. B. unerlaubter Handlung (§§ 823 ff. BGB), Gefährdungshaftung und Geschäftsführung ohne Auftrag.
4.9.2.2 Haftungsrecht
Erleidet ein Patient im Krankenhaus einen Schaden, muss geklärt werden, ob er einen Schadensersatzanspruch geltend machen kann oder nicht.
Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs
Schaden Die Haftungsfrage stellt sich dort nicht, wo zwar Fehlverhalten vorliegt (z. B. fehlerhafte Dokumentation), aber dieses Fehlverhalten zu keinem konkreten Schaden geführt hat. Schaden in diesem Sinn ist dabei jede Einbuße, die jemand infolge eines bestimmten Ereignisses an seinen Rechtsgütern wie Gesundheit, Ehre oder Eigentum erleidet. Dabei kann eine erhebliche psychische Beeinträchtigung auch als Gesundheitsschaden gewertet werden.
Vorsatz und Fahrlässigkeit
Schaden Der Schaden muss schuldhaft verursacht worden sein. Als Verschuldensformen kommen hier Vorsatz und Fahrlässigkeit in Betracht.
Vorsatz Vorsätzlich handelt ein Mensch dann, wenn er die genauen Umstände seines Handelns kennt und die Herbeiführung des eingetretenen Erfolges auch will.
Fahrlässigkeit Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Abweichend vom Strafrecht gilt im Zivilrecht kein individueller, sondern ein auf die allgemeinen Verkehrsbedürfnisse ausgerichteter objektiver Sorgfaltsmaßstab. Im Rechtsverkehr muss jeder grundsätzlich darauf vertrauen dürfen, dass der andere die für die Erfüllung seiner Pflichten erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt. Der Schädiger kann sich daher nicht auf fehlende Fachkenntnisse, Verstandeskräfte, Geschicklichkeit oder Körperkraft berufen. Die „im Verkehr erforderliche Sorgfalt“ wird dann verletzt, wenn in einer ganz konkreten Situation das erforderliche Maß an Umsicht und Sorgfalt, das nach dem Urteil besonnener und gewissenhafter Angehöriger des in Betracht kommenden Verkehrskreises nicht beachtet wurde.
Fallbeispiel
Frau Maier ist 76 Jahre alt und liegt in der Notaufnahme. Beim Einkaufen wurde es ihr plötzlich „schwarz vor Augen“, erzählt sie Gesundheits- und Krankenpfleger Jens Schmidt, „und dann bin ich erst wieder im Krankenwagen aufgewacht.“
Jens Schmidt misst bei Frau Maier die Vitalzeichen, der Blutdruck ist niedrig und Frau Maier ist sehr blass. Nach der Messung verlässt er den Raum, um das weitere Vorgehen mit dem behandelnden Arzt abzusprechen.
Frau Maier sieht, dass heute viel in der Notaufnahme zu tun ist. Sie möchte die Pflegenden nicht noch mehr belasten und steht deshalb allein auf, als sie zur Toilette muss. Doch dann wird ihr wieder schwindelig und sie sinkt zu Boden.
Jens Schmidt betritt wenige Minuten später erneut das Zimmer von Frau Maier; sie ist ansprechbar, hat sich jedoch beim Sturz das Bein gebrochen und hat starke Schmerzen.
Wer haftet hier und wieso?
Gesundheits- und Krankenpfleger Jens muss haften. Er hätte Frau Maier darauf hinweisen müssen, dass sie nicht ohne Begleitung aufstehen darf. Durch das Unterlassen hat er seine Sorgfaltspflicht verletzt.
4.9.2.3 Dokumentation in der Pflege
Der Arzt und das Pflegepersonal sind zur Dokumentation ihrer Tätigkeiten verpflichtet. Diese Pflicht ergibt sich zum einen aus dem Krankenhausaufnahmevertrag, aber auch aufgrund einer tatsächlichen Übernahme und Durchführung der Behandlung sowie kraft Gesetzes, § 630f BGB. Für die Pflegenden kann sich zusätzlich die Pflicht zur Dokumentation aus dem Arbeitsvertrag bzw. aus der zulässigen arbeitsrechtlichen Weisung ergeben.
Dokumentationszweck
Sicherung der Therapie Im Wesentlichen dient die Dokumentation der Therapiesicherung. Es ist sicherzustellen, dass alle an der Pflege beteiligten Personen auf Grundlage der Dokumentation die Pflege und Therapie des Patienten durchführen und fortsetzen können.
Beweissicherung und Rechenschaftspflicht Darüber hinaus dient die Dokumentation aber auch der Beweissicherung und der Rechenschaftspflicht gegenüber der Krankenkasse. Die Durchführung von Maßnahmen, die sich aus der Dokumentation ergeben, können durch diese nachgewiesen werden.
Absicherung der ausführenden Person Nicht zuletzt dient die Dokumentation auch der Absicherung für selbst durchgeführte Maßnahmen oder gegenüber einer fremden Anordnung. Jede Pflegeperson kann dadurch kontrollieren, ob sie eine bestimmte Maßnahme bereits durchgeführt hat oder nicht. Erfolgt die Durchführung einer Maßnahme auf ausdrückliche Anordnung eines Arztes, soll sie durch diesen abgezeichnet werden.
Information des Patienten Übrig bleibt noch als Dokumentationszweck die Information des Patienten. Er hat das Recht, seine Akte vollständig einzusehen.
Inhalt und Umfang
Die Dokumentation ist so zu führen, dass die Behandlung und Pflege von jeder nicht eingeweihten Fachperson nachvollzogen und weitergeführt werden können. Verwenden Sie bei der Dokumentation gängige Fachbegriffe und Abkürzungen, die alle Fachpersonen nutzen und verstehen.
Im Wesentlichen zu dokumentieren sind ( ▶ Abb. 4.44):
Inhalte der Dokumentation (nach Hell 2013).
Abb. 4.44
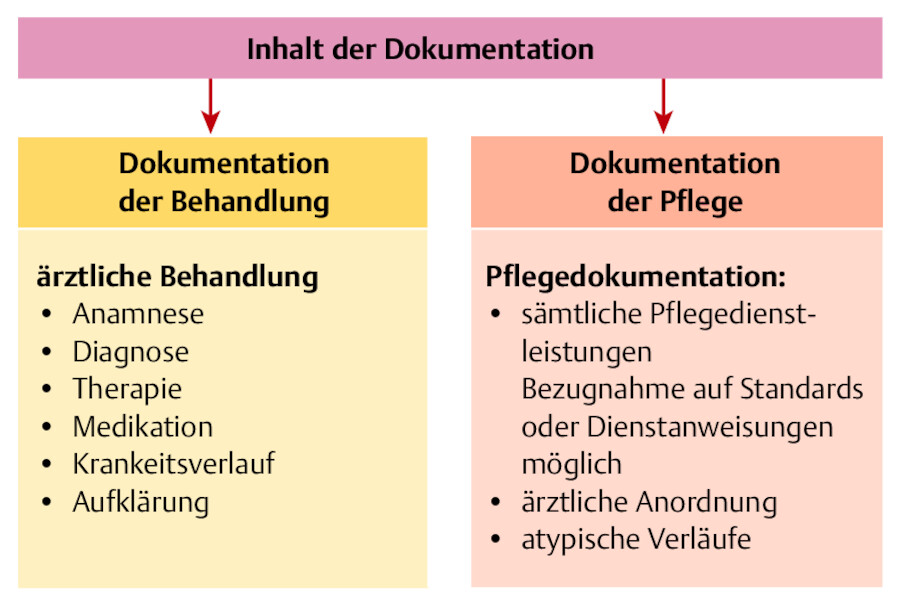
-
Anamnese
-
Diagnose
-
Therapie
-
Krankheitsverlauf
-
getroffene Maßnahmen und deren Wirkungen (geplante, angeordnete und durchgeführte Maßnahmen und Tätigkeiten) sowie deren Zeitpunkt (Datum, Uhrzeit, Kürzel)
-
Inhalt und Name der Person, die diese Maßnahme durchgeführt hat
-
Pflegevorfälle (z. B. Patientenverweigerungen)
-
sämtliche Auffälligkeiten, die Bedeutung für die Behandlung und Pflege haben
Verantwortlicher
In erster Linie muss die Person dokumentieren, die die Maßnahme durchgeführt hat. Diese ist dann auch zu bezeichnen bzw. mit einem Namenskürzel zu kennzeichnen. Allerdings kann die Dokumentation auch im zulässigen Rahmen delegiert werden.
Abänderungen Abänderungen der Dokumentation dürfen nur in engem Rahmen durchgeführt werden. Unproblematisch ist dies, wenn nur offensichtliche Schreibfehler oder vergleichbare Unwichtigkeiten korrigiert werden. Eine Abänderung der Dokumentation ist nicht mehr zulässig, wenn jemand Daten verändert, die nicht von ihm selbst verfasst wurden, oder jemand die von ihm selbst aufgenommenen Daten verändert, nachdem die vorliegenden Unterlagen bereits Grundlage einer weiteren Krankenbehandlung geworden sind. Dies ist eine Straftat. Man spricht in so einem Fall von Urkundenfälschung.
Zeitpunkt der Dokumentation
Die Dokumentation sollte zeitnah, also in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der durchgeführten Maßnahme, erfolgen. Dies bedeutet nicht, dass dies sofort geschehen muss, aber sie sollte ohne schuldhaftes Zögern erledigt werden, allein schon um sicherzustellen, dass keine wesentlichen Details vergessen werden.
Dokumentationsmängel
Eine fehlerhafte Dokumentation stellt einen Sorgfaltspflichtverstoß dar. Kommt es zu einem Schaden am Patienten und beruht dieser auf der fehlerhaften Dokumentation, ergeben sich Haftungsansprüche.
Darüber hinaus führt eine nicht ordnungsgemäße Dokumentation zu Beweiserleichterungen bis hin zur Beweislastumkehr.
4.9.2.4 Delegieren von Aufgaben
Ist eine Person zur Durchführung einer bestimmten Maßnahme gesetzlich oder vertraglich verpflichtet, kann sie unter bestimmten Voraussetzungen Tätigkeitsbereiche oder Einzelaufgaben an andere Personen mit entsprechender Qualifikation übertragen (Delegation).
Übertragung ärztlicher Aufgaben
Im Krankenhaus kommt insbesondere die Übertragung von ärztlichen Aufgaben auf das Pflegepersonal in Betracht. Eine solche Delegation ist jedoch nur dann zulässig, wenn die Person, an die eine Aufgabe delegiert wird, fachlich qualifiziert ist, d. h. über ausreichendes Wissen und hinlängliche Erfahrung verfügt. Hiervon muss sich diejenige Person überzeugen, die für die Durchführung der Aufgabe verantwortlich ist und diese delegiert ( ▶ Abb. 4.45).
Durchführungsverantwortung.
Abb. 4.45 Übernimmt eine Pflegende ärztliche Tätigkeiten, muss sie selbst prüfen, ob sie über das notwendige Wissen und die Fertigkeiten verfügt, um die Maßnahme korrekt durchzuführen. Der Arzt übernimmt hingegen die Anordnungsverantwortung.
(Foto: K. Oborny, Thieme)

Verabreichung von Injektionen Für die Verabreichung einer ärztlich angeordneten Injektion gilt Folgendes: Grundsätzlich kann nicht gesagt werden, welche Arten von Injektionen (subkutan, intramuskulär, intravenös) das Pflegepersonal durchführen darf oder nicht. Entscheidend sind immer der Wissenstand und die praktischen Fertigkeiten der jeweiligen Pflegekraft.
Verantwortungsbereiche der Delegation
Im Rahmen der Delegation unterscheidet man 3 Verantwortungsbereiche.
Anordnungsverantwortung Die Anordnungsverantwortung trifft die Person, die delegiert, dies heißt i. d. R. den Arzt. Er stellt die Diagnose und trifft die entsprechenden Anordnungen. Dabei muss er auch die richtige Person auswählen, auf die er die Durchführung dieser Maßnahme überträgt, d.h., er muss sich davon überzeugen, dass diese Person über die erforderlichen Fachkenntnisse und Fähigkeiten verfügt. Kommt es hier zu einem Fehler, fällt dieser eindeutig und ausschließlich in den Verantwortungsbereich des Arztes.
Übernahmeverantwortung Die Übernahmeverantwortung trifft die Person, auf die die Durchführung der Aufgabe übertragen wird. Die Pflegeperson muss daher eigenständig prüfen, ob sie die Durchführung dieser Maßnahme aufgrund ihrer persönlichen Qualifikation verantworten kann. Liegen Umstände vor, die dies nicht ermöglichen – und mögen es auch nur Umstände sein, die nur zu diesem konkreten Zeitpunkt vorliegen –, so ist die Pflegeperson verpflichtet, diese Umstände dem Arzt mitzuteilen. Dies geht so weit, dass im konkreten Fall die Übernahme einer bestimmten Maßnahme nicht nur verweigert werden kann, sondern verweigert werden muss.
Durchführungsverantwortung Die Durchführungsverantwortung trifft ausschließlich die Person, die die angeordnete Maßnahme durchführt. Das bedeutet, dass die Pflegeperson bei der Durchführung einer Injektion eigenständig und selbstverantwortlich alle Maßnahmen zu treffen hat, die zur Ausführung einer Injektion zählen. Auch die anschließende Überwachung und Beobachtung des Patienten auf mögliche Nebenwirkungen gehören dazu.
4.9.2.5 Betreuungsrecht
Kann eine volljährige Person aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht mehr vollständig besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht für sie einen Betreuer (§ 1896 BGB).
Voraussetzungen einer Betreuung
Beim Betroffenen muss eine psychische Krankheit oder eine körperlich, geistige oder seelische Behinderung vorliegen. Diese muss durch ein ärztliches Gutachten nachgewiesen werden. Die Erkrankung oder Behinderung muss die Ursache dafür sein, dass der Betroffene seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen kann.
Die Einwilligung des Betroffenen ist nur dann erforderlich, wenn er seinen Willen frei bestimmen kann. Sind seine Willensbildung und Steuerungsfähigkeit krankheitsbedingt beeinträchtigt, kommt es nicht auf sein Einverständnis an. In diesem Fall muss auch gegen seinen Willen eine Betreuung angeordnet werden.
Der Anordnung einer Betreuung bedarf es auch dann nicht, wenn für den Betroffenen anderweitig Hilfe zur Verfügung steht. Anderweitige Hilfe ist z. B. möglich, wenn es in ausreichendem Umfang private Hilfen gibt oder der Betroffene noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte (d.h. im Zustand der Geschäftsfähigkeit) durch eine Vorsorgevollmacht einen Bevollmächtigten bestellt hat. Dieser ist je nach Inhalt der Vollmacht berechtigt, für den Betroffenen zu handeln. Insoweit bedarf es keiner Betreuung.
Umfang der Betreuung
Der Umfang der Betreuung hängt davon ab, für welche Lebensbereiche eine Betreuung erforderlich ist. Nur für diesen Bereich darf ein Betreuer bestellt werden. Der Betreuungsumfang ist in den Betreuerausweis aufzunehmen. Dabei kommen insbesondere folgende Aufgabenkreise in Betracht:
-
Aufenthaltsbestimmung
-
Vermögensverwaltung
-
Gesundheitsfürsorge
Es können aber auch nur einzelne Maßnahmen (z. B. Einwilligung in eine Operation) als Aufgabenkreis bezeichnet werden.
Person des Betreuers
Fachliche und persönliche Eignung Zum Betreuer darf nur eine Person bestellt werden, die geeignet ist, die Angelegenheiten des Betreuten in dem bestimmten Aufgabenkreis tatsächlich zu besorgen und ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen.
Diese fachliche und persönliche Eignung muss auch dann vorliegen, wenn der Betroffene selbst eine bestimmte Person vorschlägt, die zum Betreuer bestellt werden soll. Dieser Wunsch des Betreuten ist zu respektieren. Dem ist jedoch nur dann zu entsprechen, wenn es seinem Wohl nicht zuwiderläuft. Schlägt hingegen der Betroffene vor, eine bestimmte Person nicht zu bestellen, so soll hierauf Rücksicht genommen werden.
Betreuungsverfügung Gleiches gilt, wenn der Betroffene in einer sog. Betreuungsverfügung bereits vor Beginn des Betreuungsverfahrens Angaben gemacht hat.
Wohl des Betreuten
Der Betreuer hat dafür zu sorgen, dass die Angelegenheiten des Betreuten insoweit erledigt werden, als dieser hierzu nicht mehr in der Lage ist. Das Wohl des Betreuten ist dabei entscheidender Maßstab für das Verhalten des Betreuers. So bestimmt das Gesetz ausdrücklich, dass der Betreuer den Wünschen des Betreuten zu entsprechen hat, soweit dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft und dem Betreuer zuzumuten ist (§ 1901 III S. 1 BGB).
Persönliche Betreuung und Besprechungspflicht Dem Wohl des Betroffenen kann nur entsprochen werden, wenn der Betreuer den persönlichen Kontakt und das persönliche Gespräch zum Betreuten sucht (persönliche Betreuung). Denn nur durch das so geschaffene Vertrauensverhältnis lassen sich Wohl und Wünsche des Betreuten ermitteln.
Betreuungsverfahren
Zuständig für das Betreuungsverfahren ist das Betreuungsgericht bei dem Amtsgericht des Ortes, in dem der Betroffene seinen gewöhnlichen Aufenthalt, d. h. Wohnsitz hat.
Vor der Bestellung eines Betreuers ist der Betroffene anzuhören. Er soll vom Betreuungsrichter in seiner üblichen Umgebung aufgesucht werden. Dies kann bei ihm zu Hause oder z.B. im Seniorenheim sein.
Anschließend ist ein Gutachten eines Sachverständigen einzuholen, ob die Notwendigkeit einer Betreuung besteht. Das Gutachten soll Auskunft über den Gesundheitszustand des Betroffenen geben und die Frage beantworten, in welchem Umfang er einer Betreuung bedarf (Aufgabenkreis).
Heilbehandlung von Betreuten
Besteht bei einer Untersuchung, Heilbehandlung oder einem ärztlichen Eingriff Lebensgefahr für die betreute Person, muss das Betreuungsgericht (§ 1904 I BGB) zusätzlich zur Einwilligung des Betreuers den Eingriff genehmigen. ▶ Dies gilt auch dann, wenn eine sog. Vorsorgevollmacht vorliegt.
Lebensgefährliche medizinische Maßnahmen sollen daher nur dann durchgeführt werden, wenn unter Abwägung aller Umstände diese dem Wohle des Betroffenen und unter Berücksichtigung seiner geäußerten Wünsche gerechtfertigt ist. Eine gerichtliche Genehmigung ist aber nicht erforderlich, wenn zwischen Arzt und Betreuer Einvernehmen darüber besteht, dass die Maßnahme dem Willen des Patienten entspricht.
Unterbringung des Betreuten
Merke
Die Unterbringung des Betreuten ist eine freiheitsentziehende Maßnahme.
Eine Unterbringung darf nur durch den Betreuer angeordnet werden, wenn und solange diese zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, weil
-
entweder die Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen/seelischen Behinderung sich selbst tötet oder erheblich gesundheitlich schädigt (Selbstgefährdung), oder
-
eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff beim Betroffenen notwendig ist, die ohne Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt werden kann, und der Betreute die Notwendigkeit der Unterbringung aufgrund seines Geisteszustandes nicht erkennt.
Auch die Unterbringung ist nur mit Genehmigung durch das Betreuungsgericht zulässig ( ▶ Abb. 4.46). In Eilfällen kann diese Genehmigung nachträglich eingeholt werden.
Unterbringung.
Abb. 4.46 Voraussetzungen für die Unterbringung eines Betreuten (nach Stolz et al. 2008).
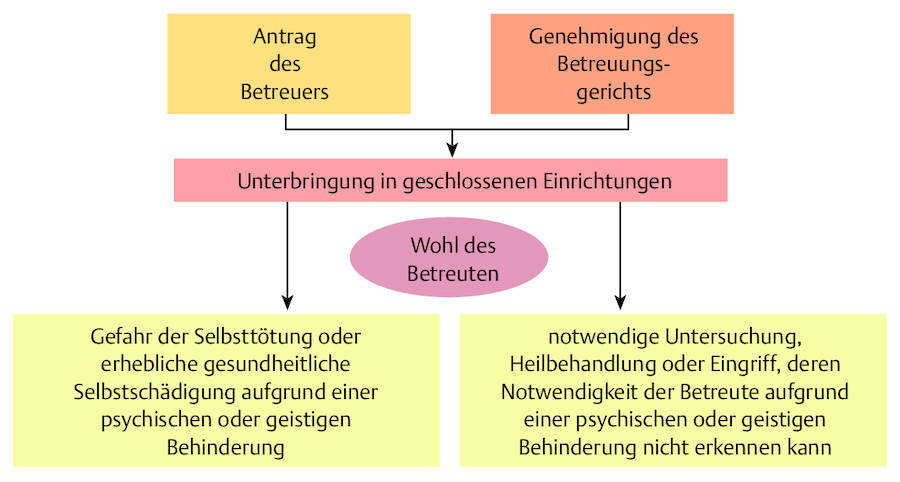
Fixierung des Betreuten
Dies bedeutet zunächst, dass sie der Einwilligung des Betreuten oder bei seiner Einwilligungsunfähigkeit der Einwilligung des Betreuers bedarf.
Erfolgt die Fixierung aufgrund der Einwilligung durch den Betreuer über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig, ist die Genehmigung des Betreuungsgerichts erforderlich. Eine längere oder regelmäßig durchgeführte Fixierung ist jedoch nur möglich, wenn die Voraussetzungen einer Unterbringung vorliegen. Das heißt, es muss entweder eine Selbstgefährdung bestehen oder die Fixierung notwendig sein, um eine Untersuchung, Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff zu ermöglichen, der ohne Fixierung nicht durchgeführt werden könnte und der Betreute aufgrund seiner psychischen Krankheit oder geistigen Behinderung die Notwendigkeit der Fixierung nicht erkennt.
4.9.2.6 Unterbringung
Merke
Patienten dürfen nicht gegen ihren Willen behandelt werden. Insbesondere können sie nicht zwangsweise in ein Krankenhaus gebracht werden.
Es gibt jedoch Fälle, in denen dies zum Schutz der Öffentlichkeit oder zum Wohle eines Menschen erforderlich ist.
Privatrechtliche Unterbringung Geht es nur um den Schutz des Patienten, ist eine zwangsweise Verbringung des Patienten in ein Krankenhaus nur unter den Voraussetzungen der privatrechtlichen Unterbringung, d. h. mit Einwilligung eines Betreuers und Genehmigung durch ein Betreuungsgericht zulässig.
Öffentlich-rechtliche Unterbringung Darüber hinaus ist die Verwahrung eines Menschen in einem Krankenhaus gegen seinen Willen nur möglich, wenn dieser psychisch krank oder infolge von Geistesschwäche oder Sucht psychisch gestört ist und eine erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder Selbstgefährdung droht (öffentlich-rechtliche Unterbringung).
4.9.2.7 Das Testament im Krankenhaus
Fallbeispiel
Die 75-jährige Gertrud Maier ist Patientin der gerontologischen Abteilung im Krankenhaus. Sie merkt, dass ihr Leben zu Ende geht. In den Abendstunden bittet sie Gesundheits- und Krankenpfleger Fabian Schäfer, ihr ein Testament aufzusetzen, wobei sie ihm ihren Letzten Willen erklärt. Wie muss sich Fabian Schäfer richtig verhalten?
Nach dem Tod eines Menschen gehen seine Rechte und Pflichten auf die Rechtsnachfolger, d. h. seine Erben über. Diese Erben kann der Erblasser zu seinen Lebzeiten selbst bestimmen (testamentarische Erbfolge). Ist dies nicht der Fall, bestimmt das Gesetz, wer Erbe wird (gesetzliche Erbfolge).
Testamentarische Erbfolge Ist der Erblasser mit der gesetzlichen Erbfolge nicht einverstanden, kann er diese ändern und mit seinem Letzten Willen kundtun. Er ist allerdings an bestimmte Formen gebunden.
Testierfähigkeit Voraussetzung ist zunächst, dass die Testierfähigkeit vorliegt. Sie ist gegeben ab Vollendung des 16. Lebensjahres und setzt voraus, dass jemand im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte die Bedeutung einer Willenserklärung und damit seiner Testamentserrichtung einsieht.
Eigenhändiges Testament
Die bekannteste Testamentsform ist das „eigenhändige Testament“. Voraussetzung ist die Volljährigkeit des Verfassers.
Das Testament muss handschriftlich verfasst und unterschrieben sein ( ▶ Abb. 4.47). Dieses Formerfordernis – Handschrift und Unterschrift – kann nicht ersetzt werden. Ist ein Patient nicht mehr in der Lage, mit seiner eigenen Hand ein Schriftstück zu verfassen, kann er kein eigenhändiges Testament erstellen.
Testament.
Abb. 4.47 Beispiel für ein eigenhändiges Testament (nach Sappke-Heuser 2007).
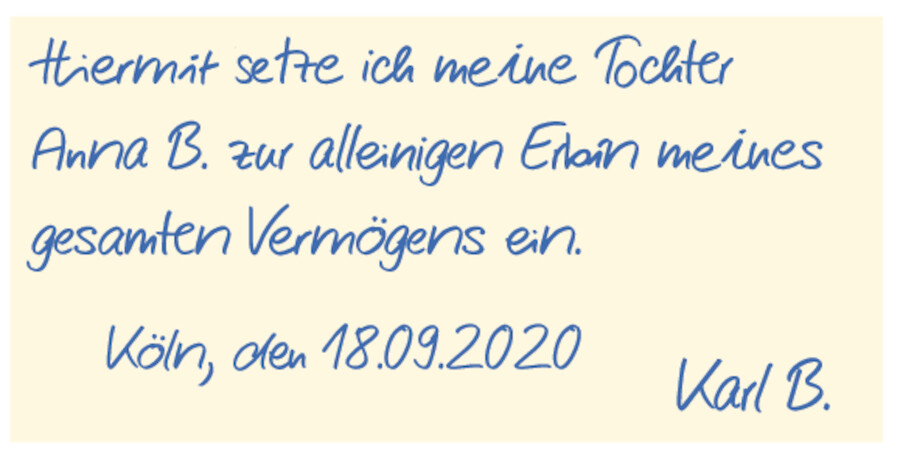
Notarielles Testament
Diese Form des Testaments kann bereits ab dem 16. Lebensjahr gewählt werden. Erforderlich ist, dass der Erblasser seinen Letzten Willen gegenüber dem Notar erklärt und dieser eine Niederschrift darüber verfasst. An diese Form des Testaments sind alle diejenigen gebunden, die – aus welchen Gründen auch immer – ihren Willen nicht handschriftlich festlegen können.
3-Zeugen-Testament
Voraussetzung Voraussetzung ist, dass derjenige, der das Testament errichten will, sich in einer nahen Todesgefahr befindet und ein notarielles Testament aus Zeitgründen nicht mehr möglich ist. Zumindest muss die konkrete Befürchtung bestehen, dass er bald in einen Zustand der fortdauernden Testierunfähigkeit gerät.
Mündliche Erklärung vor 3 Zeugen Ist er darüber hinaus testierfähig, kann er sein Testament durch mündliche Erklärung vor 3 Zeugen errichten. Diese Zeugen müssen während des gesamten Errichtungsvorgangs anwesend sein. Zeuge kann jedoch nicht sein
-
der Ehegatte des Erblassers,
-
mit ihm in gerader Linie Verwandte sowie
-
Personen, die als Erben in Betracht kommen.
Niederschrift Zu Lebzeiten des Erblassers muss über die mündliche Erklärung eine Niederschrift gefertigt werden. Daraufhin ist die Niederschrift dem Erblasser vorzulesen und muss von ihm genehmigt und im Falle seiner Schreibfähigkeit unterschrieben werden. Kann er nicht mehr unterschreiben, ist dies ebenfalls in der Niederschrift festzustellen. Es genügt dann für die Genehmigung z. B. ein Kopfnicken.
Merke
Wenn der Erblasser nach 3 Monaten noch lebt, wird das 3-Zeugen-Testament unwirksam. Hierüber ist der Patient aufzuklären!
Fallbeispiel
Im Ausgangsfall hat Gesundheits- und Krankenpfleger Fabian Schäfer der Patientin Gertrud Maier zu erklären, dass sie jetzt allenfalls ein eigenhändiges Testament anfertigen kann. Er kann ihr zu diesem Zweck die Schreibunterlagen bringen, jedoch nicht selbst das Testament verfassen.
Ein 3-Zeugen-Testament wäre nicht zulässig, solange sich Frau Maier nicht in Todesgefahr befindet. Befindet sie sich nicht in Todesgefahr und kann andererseits aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr schreiben, muss er Frau Maier darüber aufklären, dass nur ein notarielles Testament in Betracht kommt. Auf ihren Wunsch hin ist ein Notar zu verständigen.
4.9.3 Straftaten im Bereich der Krankenpflege
Das Strafrecht beschäftigt sich mit menschlichen Handlungen, die der Gesetzgeber unter Strafe stellt, da sie unerwünscht sind und zu Verletzungen von wichtigen Gemeinschaftswerten führen. Eine Straftat setzt daher immer voraus, dass zum Zeitpunkt ihrer Begehung ein Gesetz besteht, das die konkrete Handlung unter Strafe stellt.
4.9.3.1 Aufbau und Voraussetzungen einer strafbaren Handlung
Objektiver Tatbestand Damit der Straftäter weiß, welche konkrete Handlung bestraft wird, muss zum Zeitpunkt seiner Tat die verbotene Handlung im Gesetz konkret umschrieben sein. Diese Umschreibung bezeichnet man als den objektiven Tatbestand mit seinen objektiven Tatbestandsmerkmalen.
Subjektiver Tatbestand Ein Täter kann nur bestraft werden, wenn er sich bewusst gegen das Recht stellt. Dies bedeutet, dass er die objektiven Tatbestandsmerkmale kennt und sie auch erfüllen will (subjektiver Tatbestand) ( ▶ Abb. 4.48).
Untergliederung des Straftatbestandes (nach Hell 2013).
Abb. 4.48
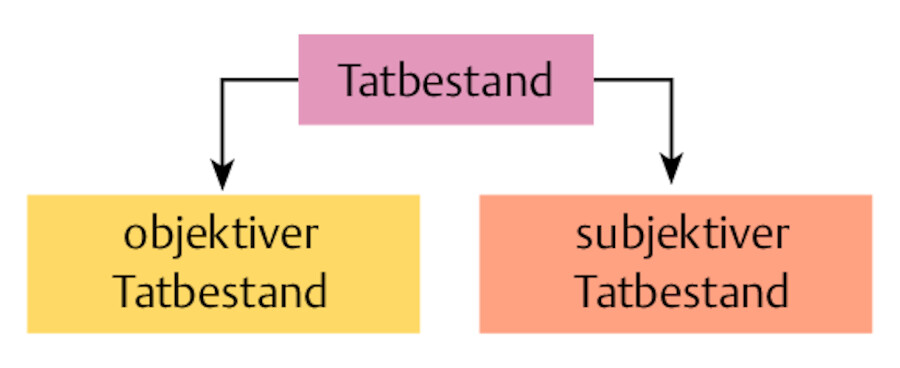
Vorsatz und Fahrlässigkeit Wer weiß, was er tut und dies auch tun will, handelt ▶ vorsätzlich.
In bestimmten Fällen, die das Gesetz genau benennt, genügt zur Strafbarkeit jedoch auch schon fahrlässiges Handeln. ▶ Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die Rechtsverletzung zwar ungewollt ist, sie jedoch vorhersehbar ist und bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte vermieden werden können.
Rechtswidrigkeit Das Handeln des Täters muss rechtswidrig sein. Es gibt Umstände, die ein an sich strafbares Verhalten rechtfertigen. Als Rechtfertigungsgründe kommen in Betracht:
-
Notwehr
-
Notstand
-
Erziehungsrecht
-
Einwilligung des Opfers in bestimmten Fällen
Darüber hinaus gibt es noch Rechtfertigungsgründe, die speziell gesetzlich geregelt sind.
Schuldhaftigkeit Letztlich ist für die Strafbarkeit noch Voraussetzung, dass der Täter schuldhaft gehandelt hat. Ohne Schuld handelt ein Täter, der schuldunfähig ist, d. h., wenn er bei Begehung der Tat wegen einer seelischen Störung oder Ähnlichem unfähig ist, dass Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Schuldunfähig sind auch Menschen, die bei Begehung der Tat noch nicht 14 Jahre alt sind.
Recht im Fokus
Einwilligung als Rechtfertigungsgrund
Jede ärztliche und pflegerische Maßnahme, soweit sie die körperliche Integrität des Patienten verletzt, erfüllt den Tatbestand der Körperverletzung. Bei der Frage, ob dieser Eingriff auch rechtswidrig ist, was die zwingende Folge hätte, dass eine strafbare Tat vorliegt, kommt in erster Linie als Rechtfertigungsgrund die Einwilligung des Patienten in Betracht.
Einwilligungsfähigkeit und Vertretung
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Patient selbst in den medizinischen Eingriff einwilligt. Dies setzt jedoch voraus, dass er einwilligungsfähig ist, d. h., dass er die Aufklärung versteht und die Bedeutung und Reichweite seiner Einwilligung erkennt.
Fehlt es an dieser Einwilligungsfähigkeit, ist die Einwilligung seines Vertreters oder in bestimmten Ausnahmefällen eine mutmaßliche Einwilligung erforderlich. Bei Kindern bis zum Alter von ca. 14 Jahren kann man generell von Einwilligungsunfähigkeit ausgehen. In diesem Fall sind die Erziehungsberechtigten (i. d. R. die Eltern, ausnahmsweise Pfleger oder Vormund) als gesetzliche Vertreter diejenigen, die einwilligen müssen. Bei Patienten im Alter zwischen ca. 14 und 18 Jahren kommt es entscheidend darauf an, ob sie die Bedeutung des Eingriffs, seine Folgen und die damit zusammenhängende Reichweite ihrer Einwilligung erkennen.
Menschen über 18 Jahre sind grundsätzlich einwilligungsfähig. Bestehen diesbezüglich Bedenken aufgrund eines geistigen Zustandes, demzufolge der Patient die Bedeutung der Maßnahme und Reichweite seiner Einwilligung nicht abschätzen kann, muss sein Vertreter einwilligen. Vertreter sind keinesfalls nahe Angehörige oder der Ehepartner. Als Vertreter kommt nur ein Betreuer als vom Betreuungsgericht bestellter gesetzlicher Vertreter in Betracht oder eine Person mit entsprechender Vollmacht (Vorsorgevollmacht). Nur diese Menschen sind rechtlich befugt, für den einwilligungsunfähigen volljährigen Patienten zu entscheiden.
Form der Einwilligung
Die Einwilligung, die jederzeit und in jeder Form widerrufbar ist, kann schriftlich, mündlich oder auch durch eine eindeutige Gestik erklärt werden (ausdrückliche Einwilligung).
Liegt keine ausdrückliche Einwilligung vor, kann und darf in Notfällen, wenn das Einholen einer ausdrücklichen Einwilligung aus zeitlichen Gründen unmöglich ist, von einer mutmaßlichen Einwilligung ausgegangen werden. Diese liegt vor, wenn vermutet werden darf, dass der Patient, würde er sämtliche Umstände kennen, in die durchzuführende Maßnahme einwilligen würde.
Zeitpunkt der Einwilligung
Die Einwilligung ist selbstverständlich vor der betreffenden Maßnahme einzuholen. Sie muss im Zeitpunkt der Maßnahme vorliegen und kann nicht nachträglich beschafft werden.
Aufklärung
Der Patient kann nur wirksam in die Verletzung seines eigenen Körpers einwilligen, wenn er weiß, worum es geht. Dies bedeutet, dass einer Einwilligung eine umfassende Aufklärung vorausgehen muss. Mit ihr soll der Patient über den Eingriff bzw. die Maßnahme und deren Folgen informiert werden. Auch die mit dem Eingriff verbundenen Risiken sind ihm zu erklären, sodass er sich frei entscheiden kann, ob er diese in Kauf nimmt bzw. ob er gewillt ist, die Folgen des Eingriffs zu tragen oder ob er lieber ohne den Eingriff weiterleben will. Die Entscheidung trifft allein der einwilligungsfähige Patient. Muss bei Einwilligungsunfähigkeit der gesetzliche Vertreter einwilligen, so ist dieser aufzuklären.
4.9.3.2 Körperverletzung (§ 223 StGB)
Definition
Vorsätzliche Körperverletzung: Der objektive Tatbestand einer vorsätzlichen Körperverletzung besteht darin, dass eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit beschädigt wurde. Schutzgut ist damit die körperliche, aber auch psychische Integrität eines lebenden Menschen.
Fallbeispiel
Gesundheits- und Krankenpflegerin Franziska Böger betritt das Patientenzimmer, um Herrn Löffler eine Spritze zur Thromboseprophylaxe zu verabreichen. Sie bittet Herrn Löffler, den Bauch frei zu machen, und erklärt ihm, was sie vorhat und warum die Injektion wichtig ist. Herr Löffler folgt der Anweisung von Frau Böger, schlägt die Bettdecke zurück und macht seinen Bauch frei. Frau Böger verabreicht ihm die Injektion. Hat sie sich strafbar gemacht?
Rechtslage im Fallbeispiel
Im Fallbeispiel ist der objektive Tatbestand der Körperverletzung erfüllt. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin muss, um die Injektion zu verabreichen, mit der Kanüle in die Haut stechen. Damit schädigt sie einen Teil des Gewebes. Es liegt zwar eine an sich harmlose, aber doch tatbestandserfüllende Schädigung der Gesundheit vor. Die Pflegende handelt vorsätzlich, da sie weiß, was sie tut ( ▶ Abb. 4.49).
Körperverletzung.
Abb. 4.49 Mit der subkutanen Injektion hat die Pflegende den objektiven Tatbestand der Körperverletzung erfüllt. Jedoch liegt die Einwilligung der Patientin vor.
(Foto: K. Oborny, Thieme)

Es liegt jedoch der Rechtfertigungsgrund der Einwilligung vor. Die Pflegende hat in kurzen, aber zutreffenden Worten den Patienten aufgeklärt. Dieser hat alles verstanden und durch eine eindeutige Geste (Zurückschlagen der Bettdecke und Freimachen des Oberköpers) zum Ausdruck gebracht, dass er mit der Maßnahme einverstanden ist.
4.9.3.3 Totschlag, Mord (§§ 212, 211 StGB)
Definition
Mord: Ein Mord liegt vor, wenn der Täter aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.
Fallbeispiel
Gesundheits- und Krankenpfleger Fabian Schäfer arbeitet in der Onkologie und betreut seit Wochen einen schwerkranken Patienten. Als er dessen Leid nicht länger ertragen kann, verabreicht der Pflegende dem Patienten im Schlaf eine tödliche Dosis Insulin. Kurz darauf stirbt der Patient. Hat sich Fabian strafbar gemacht?
Tatbestandsmerkmale
Der objektive Tatbestand des Totschlags beinhaltet die 2 folgenden Tatbestandsmerkmale der Tötung eines anderen Menschen.
-
Ein „anderer“ Mensch liegt nicht vor, wenn sich der Täter selbst tötet. Deswegen sind der Suizid bzw. der versuchte Suizid und dementsprechend auch die Beihilfe zum Suizid straflos. Töten kann man nur einen Menschen, solange er lebt. Das Leben in diesem Zusammenhang beginnt mit der Geburt und endet mit dem Hirntod.
-
Wird das Leben des Menschen zwischen dem Beginn und dem Ende vorzeitig (warum und wodurch auch immer) beendet, liegt eine Tötung vor. Es kommt hier nicht darauf an, wie lange der Mensch evtl. noch ohne diese Tötungshandlung gelebt hätte. Allein entscheidend ist, dass dieses Leben durch einen Eingriff von außen durch den Täter verkürzt wurde.
Rechtslage im Fallbeispiel
Im Fallbeispiel hat Gesundheits- und Krankenpfleger Fabian Schäfer den Tatbestand des Todschlags verwirklicht. Durch das Verabreichen einer tödlichen Dosis Insulin hat er vorzeitig das Leben des Patienten beendet. Er handelte zudem vorsätzlich. Ein Rechtfertigungsgrund lag nicht vor. Auch wenn der Patient mit dieser Tötungshandlung einverstanden gewesen wäre, ja sogar dann, wenn er diese Tötung verlangt hätte, hätte sich der Pflegende strafbar gemacht.
Fabian Schäfer hat sich auch des Mordes schuldig gemacht. Er hat heimtückisch gehandelt. Heimtücke liegt immer dann vor, wenn das Opfer arglos und damit wehrlos ist. Der Patient hat nicht mit einem Übergriff des Pflegenden gerechnet. Er hat im Schlaf die tödliche Injektion erhalten.
4.9.3.4 Schwangerschaftsabbruch (§ 218 StGB)
Definition
Schwangerschaftsabbruch: Eine Schwangerschaft im strafrechtlichen Sinn beginnt mit der Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter. Sie endet mit der Geburt des Kindes, d. h., wenn der Fetus die Gebärmutter verlässt. Von einem Schwangerschaftsabbruch spricht man dann, wenn durch einen Eingriff auf die Schwangere oder auf den Embryo bzw. Fetus dieser abstirbt.
Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs
Der Gesetzgeber hat 3 Fallkonstellationen vorgesehen, bei deren Vorliegen der Abbruch der Schwangerschaft gerechtfertigt ist (medizinische und kriminologische Indikation) bzw. trotz bestehender Rechtswidrigkeit nicht bestraft wird (sog. Fristenlösung mit Beratungspflicht):
-
Medizinische Indikation: Die medizinische Indikation setzt voraus, dass der Abbruch zur Abwendung von Gefahr für Leib und Leben der Schwangeren erforderlich ist.
-
Kriminologische Indikation: Die kriminologische Indikation setzt voraus, dass die Schwangerschaft durch eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung entstanden ist (z. B. Vergewaltigung). Hier darf jedoch der Eingriff nur innerhalb von 12 Wochen nach der Empfängnis, d. h. nach der Befruchtung durchgeführt werden.
-
Fristenlösung: Die sog. Fristenlösung setzt voraus, dass sich die Schwangere einer Beratung durch eine staatlich anerkannte Beratungsstelle (z. B. staatliche Gesundheitsämter, pro familia) unterzieht und frühestens 3 Tage später der Abbruch vorgenommen wird. Dieser muss aber noch innerhalb der Frist von 12 Wochen seit der Empfängnis, d. h. der Befruchtung, erfolgen.
4.9.3.5 Schweigepflichtverletzung (§ 203 StGB)
Fallbeispiel
Gesundheits- und Krankenpflegerin Silke Lindner hat Nachtschicht, als Frau Berger mit starken Unterleibsschmerzen in der Notaufnahme eintrifft. Ihr Mann musste zu Hause bei den Kindern bleiben, sagt die Patientin.
Als der Ehemann von Frau Berger am nächsten Tag ins Krankenhaus kommt, trifft er auf Silke Lindner. Auf die Frage, wie es seiner Frau geht und was passiert ist, teilt ihm die Gesundheits- und Krankenpflegerin wahrheitsgemäß mit, seine Frau sei „über den Berg“, man habe sie notfallmäßig versorgt. Bei ihr bestand eine Eileiterschwangerschaft, die operativ beseitigt wurde. Der Ehemann der Patientin ist über die Nachricht schockiert, zumal er mit seiner Frau seit Monaten keinen Geschlechtsverkehr mehr hatte. Hat sich die Pflegende strafbar gemacht?
Schweigepflichtige Personen
Zum Kreis der schweigepflichtigen Personen gehören u. a. der Arzt und Angehörige eines anderen Heilberufes (wie Gesundheits- und Krankenpfleger), die für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordern. Die Schweigepflicht erstreckt sich darüber hinaus auf die berufsmäßig tätigen Beschäftigten und die Personen, die bei den Schweigepflichtigen zur Vorbereitung auf ihren Beruf tätig sind (z. B. Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege).
Geheimnisse
Schützenswert sind Geheimnisse, die dem Schweigepflichtigen anvertraut wurden. Geheimnisse sind Tatsachen, die nur einem beschränkten Personenkreis bekannt sind und an deren Geheimhaltung derjenige, den sie betreffen, ein von seinem Standpunkt aus sachlich begründetes Interesse hat.
Im Krankenhaus kommen hier alle möglichen Tatsachen in Betracht und nicht nur solche, die mit der Krankheit im Zusammenhang stehen ( ▶ Abb. 4.50). Anvertraut ist ein Geheimnis, wenn es dem Schweigepflichtigen in seiner Eigenschaft als Angehörigem dieser Berufsgruppe mündlich, schriftlich oder auf sonstige Art und Weise mitgeteilt wurde.
Schweigepflicht.
Abb. 4.50 Anvertraute Geheimnisse unterliegen der Schweigepflicht.
(Foto: A. Fischer, Thieme)

Dies bedeutet, dass die Mitteilung des Geheimnisses nicht auf die Arbeitszeit beschränkt ist und sich auch auf solche Informationen bezieht, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit des Schweigepflichtigen stehen.
„Drittgeheimnisse“ Auch die sog. „Drittgeheimnisse“ fallen unter die Schweigepflicht. Hierbei handelt es sich um Tatsachen, die dem Schweigepflichtigen bekannt geworden sind, während er seinen Beruf ausgeübt hat und er Informationen erhalten hat, die sich wiederum auf andere Personen beziehen (bei einer Untersuchung eines Patienten werden z. B. Erkenntnisse über dessen Eltern erlangt).
Offenbaren der Geheimnisse Offenbart ist ein Geheimnis, wenn die geheime Tatsache als solche und die Person, die diese Tatsache betrifft, in irgendeiner Weise einem anderen zur Kenntnis gelangt sind. Hier kommt die mündliche Mitteilung genauso in Betracht wie eine schriftliche, aber auch jede andere Art und Weise, die es letztlich dem Dritten ermöglicht, von dem Geheimnis Kenntnis zu erlangen. Der andere kann dabei auch eine Person sein, die ihrerseits der Schweigepflicht unterliegt.
Anonyme Mitteilungen, d. h. das Bekanntmachen einer geheimen Tatsache ohne die Identität der Person preiszugeben, auf die sich diese Tatsache bezieht, stellt kein Offenbaren dar.
Entbindung von der Schweigepflicht
Als Rechtfertigungsgrund kommt in erster Linie die Einwilligung des Betroffenen (Entbindung von der Schweigepflicht) in Betracht. Liegt keine ausdrückliche Einwilligung vor, kann unter bestimmten Umständen auf eine mutmaßliche Einwilligung zurückgegriffen werden.
Wahrung eigener Interessen Auch zur „Wahrung eigener Interessen“ kann ein Schweigepflichtiger ein Geheimnis offenbaren, wenn und soweit es erforderlich ist, um von sich selbst die Gefahr einer unbegründeten strafrechtlichen Verfolgung abzuwenden oder eigene zivilrechtliche Ansprüche durchzusetzen (z. B. im Haftungsprozess).
Rechtslage im Fallbeispiel
Im obigen Fallbeispiel stellt die Gesundheits- und Krankenpflegerin eine schweigepflichtige Person dar. Sie erfährt die „geheime Tatsache“, dass bei Frau Berger eine Eileiterschwangerschaft festgestellt wurde. Sie erfährt aber auch, dass sie „nunmehr über den Berg ist“. Beide Tatsachen wurden ihr als Gesundheits- und Krankenpflegerin anvertraut. Durch die Mitteilung dieser Tatsachen an den Ehemann von Frau Berger hat sie diese Tatsachen offenbart.
Rechtfertigungsgrund Als Rechtfertigungsgrund käme hier allenfalls eine mutmaßliche Einwilligung in Betracht. Dazu muss die Pflegende die Vermutung anstellen, ob Frau Berger damit einverstanden wäre, wenn ihr Ehemann erfahren würde, dass sie „über den Berg ist“ und dass eine Eileiterschwangerschaft festgestellt wurde. Bei der ersten Tatsache wird man diese Vermutung bejahen können; bei der zweiten Tatsache mit Sicherheit nicht, da diese einen Rückschluss auf einen außerehelichen Geschlechtsverkehr zulässt. Es muss Frau Berger selbst überlassen werden, ihrem Ehemann die Diagnose mitzuteilen oder auch nicht.
4.9.3.6 Freiheitsberaubung (§ 239 StGB)
Definition
Freiheitsberaubung: Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise das Gebrauchs der persönlichen Freiheit beraubt, macht sich strafbar. Der Straftatbestand Freiheitsberaubung schützt die potenzielle persönliche Fortbewegungsfreiheit, d. h. die Freiheit, sich von einem Ort zu einem anderen Ort zu bewegen.
Fallbeispiel
Die Pflegekraft Stephanie Schmitz betritt das Zimmer von Frau Manz. Frau Manz ist an Demenz erkrankt und bereits mehrfach beim Versuch, allein zur Toilette zu gehen, gestürzt. Auch heute liegt sie hilflos auf dem Boden, die Pflegende hilft ihr auf und begleitet sie zurück ins Bett.
Um einem erneuten Sturz vorzubeugen, bringt Stephanie Schmitz an beiden Seiten des Bettes ein Bettgitter an, das es Frau Manz unmöglich macht, das Bett in Zukunft selbstständig zu verlassen. Macht sich Stephanie Schmitz strafbar?
Fixierung eines Patienten
Das „Fixieren“ eines Patienten ist dann Freiheitsberaubung, wenn sich der Patient entgegen seinem Willen nicht mehr fortbewegen kann. Dies kann auf mechanische Weise geschehen, indem er z. B. in einem Zimmer eingesperrt, medikamentös ruhiggestellt oder mit Gurten an das Bett gebunden wird (Fuß-, Körper- oder Handgurte). Auch durch massive psychische Einwirkungen kann einem Patienten die Fortbewegungsfreiheit genommen werden.
Anbringen eines Bettgitters Beim Anbringen eines Bettgitters am Patientenbett liegt immer dann eine Fixierung und damit eine Freiheitsberaubung vor, wenn es dem Patienten durch das Gitter unmöglich ist, das Bett zu verlassen. Solange er durch die Art des Gitters zwischen den Stäben hindurchkann oder aufgrund seiner persönlichen Verfassung über das Gitter steigen kann, liegt keine Freiheitsberaubung vor.
Rechtfertigungsgrund Als Rechtfertigungsgrund kommt die Einwilligung des Patienten bzw. seines Vertreters infrage.
Ist der Patient nicht mehr einwilligungsfähig, kommt im Notfall eine mutmaßliche Einwilligung in Betracht. Die Einwilligung des Betreuers bedarf der Genehmigung durch das Betreuungsgericht, wenn die Fixierung über einen längeren Zeitraum andauert oder regelmäßig wiederkehrend ist.
Rechtslage im Fallbeispiel
Im Beispielsfall führt Stephanie Schmitz durch das Hochziehen des Bettgitters eine Fixierung durch, da es Frau Manz aufgrund ihres körperlichen Zustands nicht möglich ist, das Gitter zu überwinden und das Bett zu verlassen. Diese Fixierung ist strafbar, wenn sie nicht gerechtfertigt ist.
In Betracht kommt hier allenfalls die Einwilligung von Frau Manz in Form der mutmaßlichen Einwilligung. Da eine akute Gefährdung (erneuter Sturz) von Frau Manz besteht, kann Frau Schmitz bis zur Einwilligung des Betreuers die Vermutung anstellen, dass Frau Manz mit den Bettgittern einverstanden wäre, wenn sie verstehen würde, wieso diese nötig sind.
Frau Schmitz muss nun sofort veranlassen, dass die Einwilligung des Betreuers eingeholt wird. Darüber hinaus muss sie – da Fixierung in den ärztlichen Aufgabenkreis fällt – den zuständigen Arzt verständigen.
4.9.3.7 Unterlassene Hilfeleistung (§ 323 c StGB)
Definition
Unterlassene Hilfeleistung: Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten ist, macht sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar.
Unglücksfälle sind plötzlich eintretende Ereignisse, die erhebliche Gefahren für Menschen oder Sachen hervorrufen oder hervorzurufen drohen. Dies kann ein Verkehrsunfall sein oder plötzlich eintretende Krankheitszustände oder Schmerzen bei Menschen, die eine sofortige Behandlung erforderlich machen. Auch ein Suizidversuch ist als Unglücksfall anzusehen, sodass die erforderliche zumutbare Hilfe durchzuführen ist.
Fallbeispiel
Die Pflegekraft Sabine Cornelius arbeitet in einem allgemeinen Krankenhaus. Eines Nachmittags betritt sie das Patientenzimmer und merkt, wie der dort befindliche Patient am Fenster steht, dieses öffnet und hinausspringen will. Das Patientenzimmer befindet sich im 6. Stock. Der Patient würde den Sprung nicht überleben. Die Pflegende kennt den Patienten nicht näher und fragt sich, ob sie eingreifen darf oder sogar muss oder ob der Wille des Patienten zu respektieren ist. Macht sie sich strafbar, wenn sie den Patienten springen lässt?
Im Fallbeispiel macht sich die Pflegekraft strafbar, wenn sie den Patienten ohne Weiteres springen lässt, zumal sie in diesem Moment nicht mit Sicherheit sagen kann, ob dessen Entschluss, sich zu töten, aufgrund einer freien, unbeeinflussten Entscheidung erfolgt ist. Als zumutbare Hilfeleistung wäre sicherlich anzusehen, dass sie zunächst rein körperlich versucht, den Patienten am Sprung zu hindern. Unzumutbar wäre es dagegen, wenn sie sich so an ihn klammert, dass die Gefahr besteht, dass der Patient sie bei einem Sprung aus dem Fenster mit in die Tiefe reißen könnte.
4.9.3.8 Aussetzung (§ 221 StGB)
Fallbeispiel
Gesundheits- und Krankenpflegerin Claudia Meißner hat Nachtdienst auf der Intensivstation. Sie hat 4 Patienten zu überwachen. Aufgrund eines personellen Engpasses ist sie derzeit allein auf der Station. Da die Nacht ruhig verläuft, entschließt sie sich, kurz zu schlafen, wobei sie jedoch auf der Station bleibt. Hat sich Claudia Meißner strafbar gemacht?
Der Tatbestand der Aussetzung sieht 2 Tatbestandsalternativen vor ( ▶ Abb. 4.51).
Tatbestandsvoraussetzungen der Aussetzung (nach Hell 2013).
Abb. 4.51
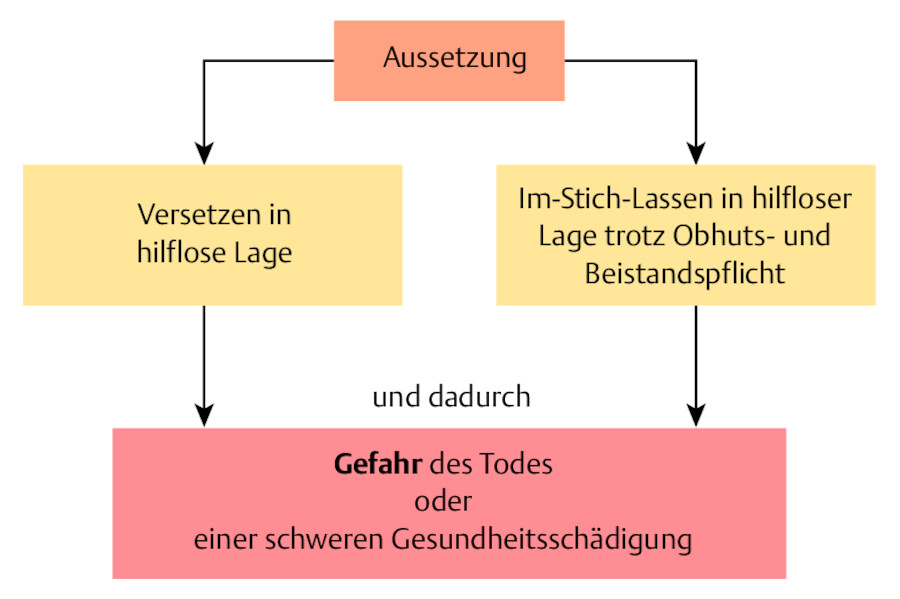
-
Versetzen in eine hilflose Lage: Zum einen macht sich der Täter strafbar, der einen Menschen, der wegen jugendlichen Alters, Gebrechlichkeit oder Krankheit hilflos ist, aussetzt. Durch das Aussetzen wird der schutzbedürftige Mensch aus bisher sicherer Lage in eine hilflose Lage versetzt. Er verändert damit seinen Aufenthaltsort. Durch diesen Ortswechsel muss das Opfer einer Lebensgefahr oder zumindest einer erheblichen Gesundheitsgefahr ausgesetzt sein. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn ein Taxifahrer einen erheblich betrunkenen Fahrgast auf freier Strecke aus dem Taxi wirft oder wenn Eltern ihr Baby aus der gesicherten Umgebung des Kinderzimmers in den Wald verbringen und dort seinem Schicksal überlassen.
-
Im-Stich-Lassen in einer hilflosen Lage: In der 2. Tatbestandsvariante macht sich der Täter strafbar, wenn er eine wegen jugendlichen Alters, Gebrechlichkeit oder Krankheit hilflose Person, die unter seiner Obhut steht, oder er für ihre Unterbringung, Fortschaffung oder Aufnahme zu sorgen hat, in hilfloser Lage verlässt und damit eine Lebensgefahr oder erhebliche Gefahr für die Gesundheit des Opfers entsteht. Hier bleibt das Opfer am Ort, aber der Täter verlässt die schutzbedürftige Person. Voraussetzung hier ist jedoch eine Obhutspflicht des Täters.
Im Krankenhaus kommt letztere Tatbestandsvariante dort zum Tragen, wo Patienten aufgrund ihrer Krankheit hilflos und dadurch einer Lebensgefahr ausgesetzt sind. Dies dürfte auf einer Intensivstation der Fall sein. Der Tatbestand ist bereits erfüllt, wenn der Patient durch das Verlassen in Lebensgefahr gerät. Er braucht keinen Schaden zu erleiden.
Rechtslage im Fallbeispiel
Im Fallbeispiel macht sich Claudia Meißner durch ihr Schlafen strafbar. Hieran ändert auch der Umstand nichts, dass sie Glück hat und die Nacht weiterhin ruhig bleibt. In dem Moment, in dem sie einschläft, kann sie nicht mehr zeitnah auf die Warnsignale der medizinischen Apparate reagieren. Dies kann zu einer akuten Notfallsituation führen.
4.9.4 Spezielle Gesetze im Pflegebereich
Neben dem Zivilrecht (insbesondere Haftungsrecht) und dem Strafrecht gibt es eine Vielzahl von speziellen Gesetzen, die in der pflegerischen Berufspraxis Geltung finden. Eine Auswahl der Gesetze wird nachfolgend kurz skizziert, da es wichtig ist, rechtliche Besonderheiten im Pflegealltag in ihren Grundzügen zu kennen.
4.9.4.1 Arzneimittelgesetz
Dieses Gesetz enthält Vorschriften über die Qualität, die Zulassung und Prüfung der Arzneimittel, über eine ausreichende Information des Verbrauchers sowie einen Anspruch auf Schadenersatz bei Schäden durch Arzneimittel. Es wird insbesondere der Begriff des Arzneimittels definiert.
4.9.4.2 Betäubungsmittelgesetz
Es gibt 3 Anlagen zum Betäubungsmittelgesetz, in denen Stoffe aufgeführt sind, die wegen ihrer Wirkungsweise eine Abhängigkeit hervorrufen können. Die in diesen Anlagen enthaltenen Stoffe sind kraft Gesetzes Betäubungsmittel.
Das Gesetz regelt den Umgang mit diesen Stoffen und stellt den illegalen Umgang mit Betäubungsmitteln unter Strafe.
Betäubungsmittelverschreibungsverordnung Bei der Verschreibung ist insbesondere die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung zu beachten. Danach dürfen ▶ Betäubungsmittel nur von Ärzten, Zahnärzten oder Tierärzten verschrieben werden, wobei hierzu ein Betäubungsmittelrezept ( ▶ Abb. 4.52) auszustellen ist. Dieses folgt einem bestimmten Aufbau und es sind auch ganz bestimmte Angaben notwendig.
Kennzeichnung.
Abb. 4.52 Betäubungsmittelrezepte sind mit einer fortlaufenden Nummer gekennzeichnet.
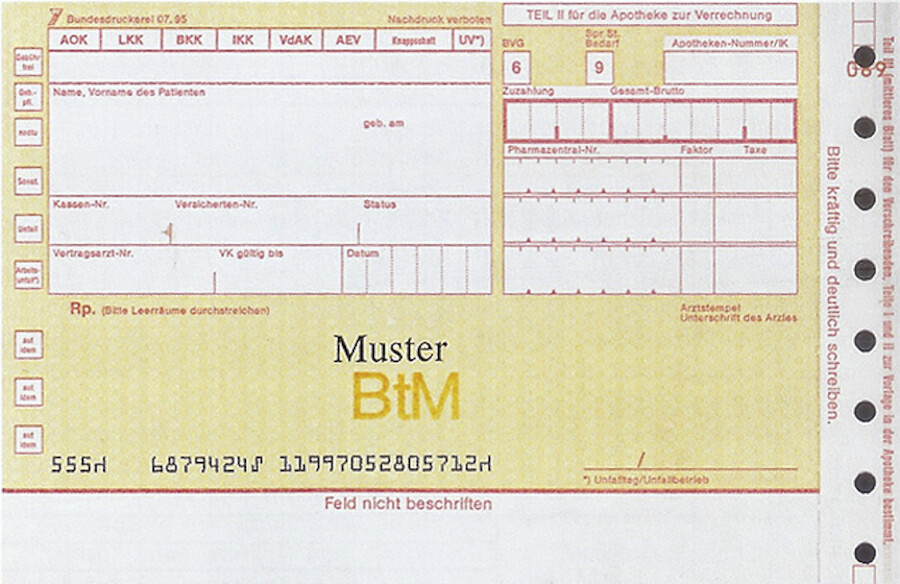
Aufbewahrung von Betäubungsmitteln Gerade im Krankenhaus ist die korrekte Aufbewahrung von Betäubungsmitteln wichtig. Zugang und Abgang von Betäubungsmitteln müssen genau dokumentiert werden. Hierzu sind die vorgesehenen Formblätter oder das Betäubungsmittelbuch zu verwenden. Die Aufbewahrung der Betäubungsmittel muss getrennt von den übrigen Arzneimitteln erfolgen. Eine unbefugte Entnahme muss verhindert werden.
4.9.4.3 Bestattungsgesetz
Die in den einzelnen Bundesländern unterschiedlichen Bestattungsgesetze enthalten
-
den Bestattungszwang (Erdbestattung, Feuerbestattung, Seebestattung),
-
die Leichenschau und
-
Regelungen über den Bestattungszeitpunkt.
Bei der Leichenschau geht es darum, zunächst den Tod als solchen festzustellen, dann Aussagen darüber zu treffen, ob ein natürlicher oder nicht natürlicher Tod vorliegt. Davon ist dann auch die weitere Vorgehensweise (z. B. Information der Polizei) abhängig. Bei der Regelung über den Bestattungszeitpunkt wird der Zeitraum festgelegt, innerhalb dessen eine Leiche zu bestatten ist.
4.9.4.4 Infektionsschutzgesetz
Der Zweck dieses Gesetzes ist es, Leben und Gesundheit des Einzelnen sowie der Gemeinschaft vor den Gefahren durch Infektionskrankheiten zu schützen. Neben der Heilung sollen v. a. die Entstehung dieser Krankheiten und deren Ausbreitung durch Prävention verhindert werden.
Meldepflicht Um diese Zwecke des Gesetzes zu erfüllen, sieht das Gesetz ein fein abgestuftes Meldewesen vor. Die zuständigen Behörden können ihrer Aufgabe nur dann entsprechen, wenn sie möglichst frühzeitig Kenntnis über das Vorliegen übertragbarer Krankheiten haben. Dementsprechend müssen bestimmte Krankheiten (meldepflichtige Krankheiten) den zuständigen Behörden gemeldet werden.
Bei diesen Meldungen von Krankheiten und Krankheitserregern ist zu unterscheiden zwischen
-
der namentlichen und
-
der nicht namentlichen Mitteilung.
Bei der namentlichen Meldung werden Krankheit, Krankheitserreger und der Name der Person genannt. Müssen Schutzmaßnahmen getroffen werden, benötigt das Gesundheitsamt weitere Informationen.
4.9.4.5 Medizinproduktegesetz
Medizinprodukte unterscheiden sich von Arzneimitteln dadurch, dass sie auf vorwiegend physikalischem Weg zum Einsatz kommen. Sie werden in 4 Risikoklassen eingeteilt (Klasse I = niedriges Risiko, II a, II b, III). Es handelt sich insbesondere um Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Stoffe und Software, die zur Anwendung für den Menschen bestimmt sind.
Zweck Der Zweck des Gesetzes liegt darin, die Sicherheit dieser Medizinprodukte zu gewährleisten. Dabei sollen die Medizinprodukte selbst medizinisch und technisch unbedenklich sein, geeignet sein zur Erfüllung des medizinischen Zwecks, den es nach Angaben des Herstellers haben soll, und Patienten, Anwender und Dritte schützen.
Weitere Gesetze Neben dem Gesetz über Medizinprodukte gibt es mehrere Verordnungen, die beim Umgang mit Medizinprodukten zu beachten sind. Hierzu gehören z. B.
-
die Medizinprodukte-Betreiberverordnung,
-
die Medizinprodukte-Verordnung,
-
die Verordnung über Vertriebswege für Medizinprodukte,
-
die Verordnung über die Verschreibungspflicht von Medizinprodukten oder
-
die Verordnung über die Erfassung, Bewertung und Abwehr von Risiken bei Medizinprodukten.
4.9.4.6 Strahlenschutz
Der Umgang mit Röntgenstrahlen und anderen ionisierenden Strahlen ist in der Röntgenverordnung und Strahlenschutzverordnung geregelt.
Röntgenverordnung Die Röntgenverordnung sieht dabei besondere Bestimmungen vor, die die Röntgenanlage als solche betreffen (Genehmigungs- oder Anzeigenpflicht), aber auch Personen und deren Aufgaben benennen, die für den Umgang dieser Schutzvorschriften besondere Verantwortung treffen (z. B. der Strahlenschutzverantwortliche, Strahlenschutzbeauftragte).
Nach der Intensität der Strahlung unterscheiden sich bestimmte räumliche Bereiche, wie:
-
Kontrollbereich
-
Überwachungsbereich
-
Röntgenraum
-
Bestrahlungsraum
Strahlenschutzverordnung Um den besonderen Gefahren im medizinischen Bereich, die v. a. in der Nuklearmedizin oder in der Strahlentherapie von radioaktiven Stoffen ausgehen, zu begegnen, sieht die Strahlenschutzverordnung bestimmte Schutzmaßnahmen vor. So dürfen sich u. a. Personen unter 18 Jahren sowie schwangere Frauen nicht im Kontrollbereich aufhalten. Schwangere oder stillende Frauen dürfen nicht mit offenen radioaktiven Stoffen umgehen.
4.9.4.7 Transplantationsgesetz
Das Transplantationsgesetz regelt die gesetzlichen Voraussetzungen, die für die Zulässigkeit einer Organtransplantation beachtet werden müssen.
Organentnahme beim toten Spender Die Organentnahme beim toten Spender ist zulässig, wenn dessen Tod festgestellt ist, die Entnahme durch einen Arzt durchgeführt wird und der Spender eingewilligt hat.
Eine Einwilligung des Spenders kann z. B. in einem Organspendeausweis festgehalten werden. Liegt keine Erklärung des Spenders vor, kommt es auf die Zustimmung des nächsten Angehörigen in bestimmt festgelegter Reihenfolge an (zunächst Ehegatte, eingetragener Lebenspartner, volljährige Kinder, Eltern des Spenders, volljährige Geschwister, Großeltern).
Organentnahme beim lebenden Spender Die Organentnahme beim lebenden Spender ist nur zulässig, wenn der Spender volljährig ist, hierzu bei vorliegender Einwilligungsfähigkeit eingewilligt hat, entsprechend aufgeklärt wurde und als Spender auch geeignet ist ( ▶ Abb. 4.53).
Voraussetzungen einer Organentnahme.
Abb. 4.53
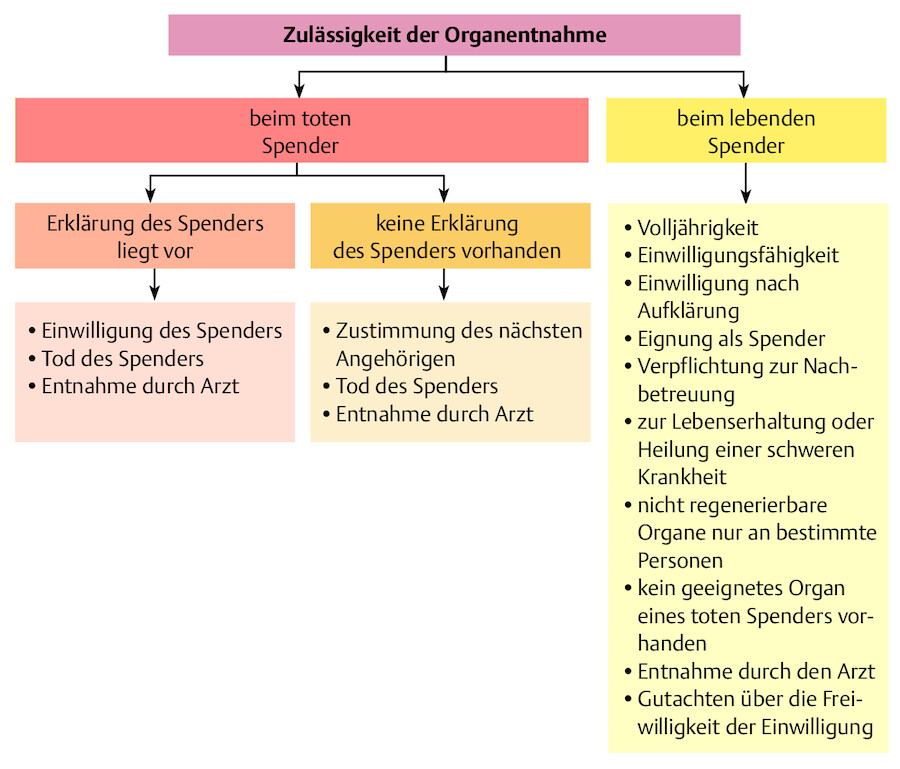
Transplantation Die Übertragung, d. h. die Implantation von bestimmten Organen wie Herz, Niere, Leber, Lunge, Darm und Bauchspeicheldrüse dürfen nur in Transplantationszentren durchgeführt werden. Stammen diese Organe von einem toten Spender, bedürfen sie der Vermittlung durch die Vermittlungs- und Koordinierungsstelle Eurotransplant (ET). Stammen diese Organe von lebenden Spendern, dürfen sie nur auf Verwandte des ersten und zweiten Grades, auf Ehegatten, Verlobte oder andere nahestehende Personen übertragen werden.
4.10 Lern- und Leseservice
4.10.1 Literatur
4.10.1.1 Pflegeprozess, Pflegesysteme, wirtschaftliche Aspekte, Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung
[234] Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. Hrsg. Profis aus Medizin und Pflege berichten. Aus Fehlern lernen (2008). Im Internet: http://www.aps-ev.de/wp-content/uploads/2016/10/Aus_Fehlern_lernen_0.pdf; Stand: 26.10.2016
[235] Balmberger T, Hohls J. Grundsätze der Krankenhausfinanzierung. In: Arbeitsrecht und Kirche. AuK 2014. Im Internet: http://www.bab-gmbh.de/files/bab/content/PDF/5_AuK3_14.pdf; Stand: 26.10.2016
[236] Bundesministerium für Gesundheit, Hrsg. Projekt „Praktische Anwendung des Strukturmodells. Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation in der ambulanten und stationären Langzeitpflege“. Abschlussbericht (April 2014). Im Internet: https://www.patientenbeauftragter.de/2-uncategorised/32-downloads-zum-neuen-strukturmodell-version-1-0.pdf; Stand: 27.10.2016
[237] Debatin JF, Ekkernkamp A, Schulte B, Tecklenburg A, Hrsg. Krankenhausmanagement. 2. Aufl. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2013
[238] Deutscher Pflegerat. Im Internet: www.deutscher-pflegerat.de; Stand: 31.10.2016
[239] Dimdi. Im Internet: https://www.dimdi.de/static/de/klassi/index.htm; Stand: 14.12.2016
[240] DIN EN ISO 9001: 2008
[241] DIN EN ISO 9001: 2015
[242] Ein-step.de; Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten. Im Internet: https://www.ein-step.de/fileadmin/content/documents/Schaubild_Strukturmodell_stationaer.pdf; Stand: 25.10.2016
[243] Esser S, Tutton E. Primary Nursing – Grundlagen und Anwendungen eines patientenorientierten Pflegesystems. Bern: Hans Huber; 2000
[244] Fehling P. Der Pflegeprozess und die Entbürokratisierung. Die Schwester/der Pfleger 2015; 29.08.2015
[245] Fiechter V, Meier M. Pflegeplanung. Basel: Recom; 1988
[246] Fiedler C, Devrient H, Schrödter M. DRGs und Pflege, nicht Taten, sondern Daten zählen. Die Dokumentation pflegerelevanter Nebendiagnosen in den Pflegeberichten. Die Schwester/der Pfleger 2005; 3: 208–211
[247] Gemeinsamer Bundesausschuss, Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser vom 17.04.2014. Im Internet: https://www.g-ba.de/downloads/62–492–865/KQM-RL_2014–01–23.pdf; Stand: 26.10.2016
[248] Georg J, Frowein M, Hrsg. Pflegelexikon. 2 Aufl. Bern: Hans Huber; 2001
[249] Grünewald M. Der Krankenpflegeprozess. Bildungszentrum für Kompetenzentwicklung im Gesundheitswesen. Düsseldorf: Universitätsklinikum Düsseldorf; 2004
[250] Haubrock M, Schär W. Betriebswirtschaft und Management im Krankenhaus. Bern: Hans Huber; 2002
[251] Haubrock M, Schär W. Hrsg. Betriebswirtschaft und Management in der Gesundheitswirtschaft. 5. Aufl. Bern: Hans Huber; 2009
[252] Hokenbecker E, Sanders B, Schuldt E, Verlass B. Entwicklung eines „Clinical Pathway in der Urologie am Beispiel eines Patienten mit Prostata-Karzinom unter besonderer Berücksichtigung eines Case Management-Verfahrens und der Anleitung von Schülern sowie neuer Mitarbeiter“ an der St. Barbara-Klinik Hamm-Hessen. Münster: Fachhochschule Münster; 2004
[253] Hokenbecker-Belke E. Ausgebrannt. Ein Ratgeber für Mitarbeiter und Führungskräfte zur Burnout-Prävention in personenzentrierten Dienstleistungsberufen. Münster: LIT; 2006
[254] Jung-Heintz H, Lieser A. Pflegeprozess. Eine Methode geplanter und strukturierter Pflege. In: Kellnhauser E et al. Hrsg. Thiemes Pflege, 10. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2004: 56–76
[255] MDK, MDS: Ergänzende Erläuterungen für Qualitätsprüfungen in Pflegeeinrichtungen nach den Qualitätsprüfungs-Richtlinien – QPR bei Umsetzung des Strukturmodells zur Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation; Stand: 14.06.2016, Version 3.1
[256] MDS, Hrsg. Grundsatzstellungnahme Pflegeprozess und Dokumentation. Handlungsempfehlungen zur Professionalisierung und Qualitätssicherung in der Pflege. Essen: MDS; 2005; Im Internet: http://www.mdk.de/media/pdf/P42Pflegeprozess.pdf; Stand: 26.10.2016
[257] Pflegekomplexmaßnahmen-Scores für Erwachsene (PKMS-E), Kinder und Jugendliche (PKMS-J) und Kleinkinder (PKMS-K) zum OPS 2016. Im Internet: http://www.recom.eu/files/recom/40-wissen/pkms2016/pkms-2016-dimdi-offizielle-fassung.pdf; Stand: 25.10.2016
[258] Pflegeassistenz. Lehrbuch für die Gesundheits- und Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2016
[259] Schewior-Popp S, Sitzmann F, Ullrich L, Hrsg. Thiemes Pflege. 12. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2012
[260] Schieron M. Pflegesysteme – Versuch einer Begriffsbestimmung 2003; 03: 2–4; Stand: 01.02.2008
[261] Schippers AD. Angewandte Pflegeforschung. Primary Nursing. PrInterNet 2007; 08/06
[262] Schlutig HJ et al. Bezugspflege. Berlin: Springer; 1993
[263] Schmidt S. Das QM-Handbuch. Heidelberg: Springer; 2005
[264] Seyfarth-Metzger I, Vogel S, Krabbe-Berndt A. Qualitätsmanagement: Neue Herausforderungen an das Qualitätsmanagement: Wirtschaftlichkeit und Patientensicherheit. das Krankenhaus 2005; 9: 75–764
[265] TÜV Akademie. DIN EN ISO 9000–9004. Qualitätsmanagementsysteme. Berlin: TÜV, Deutsches Institut für Normung e.V.; 2008
[266] TÜV Akademie. Modul 5. QM Tools. München: TÜV SÜD AG; 2008
[267] TÜV Akademie. Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen (ISO 9001:2015); deutsche und englische Fassung EN ISO 9001:2015
[268] Welz-Spiegel C. Systemumstellung in Gesundheitseinrichtungen auf die DIN EN 15224. Stuttgart: Kohlhammer; 2014
4.10.1.2 Pflegediagnosen
[269] Behrens J. Die ICF, die ICIDH-2 und die Diagnostik in der Pflege: Chancen und Risiken aus pflegewissenschaftlicher Sicht. In: Sennenwald Etzel B, Hrsg. Pflegediagnostik und Pflegeklassifikationssysteme. Entwicklung und Anwendung. Stuttgart: Kohlhammer; 2003: 99–110
[270] Benner P. Stufen zur Pflegekompetenz. From Novice to Expert. 2. Aufl. Bern: Huber; 2012 (Originalausgabe von 1984)
[271] Böhle F, Brater M, Maurus A. Pflegearbeit als situatives Handeln. In: Pflege 1997; 10: 18–22
[272] Böhme G. Wissenschaftssprachen und die Verwissenschaftlichung der Erfahrung. In: Ders. Am Ende des Baconschen Zeitalters. Studien zur Wissenschaftsentwicklung. Frankfurt/M: Suhrkamp; 1993: 92–113
[273] Brater M. Was sind „Kompetenzen“ und wieso können sie für Pflegende wichtig sein? Pflege & Gesellschaft 2016, 21. Jg., H. 3: 197–213
[274] Bulechek, GM, Butcher HK, Dochtermann J M, Wagner CM. Nursing Interventions Classification (NIC), 6th ed. St. Louis, Missouri: elsevier mosby; 2013
[275] Cassier-Woidasky AK. Pflegequalität durch Professionsentwicklung. Eine qualitative Studie zum Zusammenhang von professioneller Identität, Pflegequalität und Patientenorientierung. Frankfurt/M.: Mabuse; 2007
[276] Clark J, Lang N. Nursing’s next advance: An international classification for nursing practice. International nursing review 1992; 39 (4): 109–112
[277] Darmann I. Anforderungen an die Definition pflegerischer Begriffe aus pflegewissenschaftlicher Sicht. Pflege 1998; 11: 11–14
[278] Decker G. Rehistorisierung – Der kompetente Blick der Pflegenden auf die Kompetenzen des kranken Menschen. In: Kriesel P, Krüger H, Piechotta G, Remmers H, Taubert J, Hrsg. Pflege lehren – Pflege managen. Eine Bilanzierung innovativer Ansätze. Frankfurt/M.: Mabuse; 2001: 119–128
[279] Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI, Hrsg.). ICF (2014). Im Internet: http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/; Stand: 14.12.2016
[280] Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI, Hrsg.). Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. WHO Genf: WHO; 2005. Im Internet: https://www.dimdi.de; Stand: 14.12.2016.
[281] Darmann I. Anforderungen an die Definition pflegerischer Begriffe aus pflegewissenschaftlicher Sicht. Pflege 1998; 11: 11–14
[282] Friesacher H. Theorie und Praxis pflegerischen Handelns. Begründung und Entwurf einer kritischen Theorie der Pflegewissenschaft. Osnabrück: Universitätsverlag Osnabrück bei v & r unipress; 2008
[283] Friesacher H. Segen oder Fluch für die Pflege? Pflegediagnosen und Pflegeklassifikationssysteme. In: Teil 1: Padua 2007; 4: 43–47, Teil 2: Padua 2007; 5: 48–55
[284] Friesacher H. Notwendigkeit, Chancen oder Risiko: Einsatz von Pflegediagnosen im Krankenhaus. In: Norddeutsches Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege, Hrsg. Pflegediagnosen – eine Chance, Pflegeprobleme klar zu definieren und zu beschreiben, oder nur ein umstrittener aktueller Trend? Dokumentation einer Tagung. Hamburg; 2000: 31–39
[285] Friesacher H. Verstehende, phänomenologisch-biographische Diagnostik. Eine Alternative zu „traditionellen“ Klassifikations- und Diagnosesystemen in der Pflege? Mabuse 1999; 120: 54–60
[286] Friesacher H. Pflegediagnosen und International Classification for Nursing Practice (ICNP). Eine Analyse von Klassifikationssystemen in der Pflege. Mabuse 1998; 112: 33–37
[287] Fuchs T. Subjektivität und Intersubjektivität. Zur Grundlage psychiatrischer und psychotherapeutischer Diagnostik. KONTEXT 2015; 46 Jg., H. 1: 27–41
[288] Fuchs T. Wege aus dem Ego-Tunnel. Zur gegenwärtigen Bedeutung der Phänomenologie. Deutsche Zeitschrift für Philosophie 2015a; 63. Jg., H.5: 801–823
[289] Halek M. Herausforderndes Verhalten von Menschen mit Demenz einordnen. Die Verstehende Diagnostik. Vortrag auf dem Altenpflege Kongress am 09.04.2014
[290] Hardenacke D, Bartholomeyczik S., Halek M. Einführung und Evaluation der „Verstehenden Diagnostik“ am Beispiel des Leuchtturmprojektes InDemA. Pflege & Gesellschaft 2011, 16. Jg., H. 2: 101–115
[291] Hülsken-Giesler M. Der Zugang zum Anderen. Zur theoretischen Rekonstruktion von Professionalisierungsstrategien pflegerischen Handelns im Spannungsfeld von Mimesis und Maschinenlogik. Osnabrück: Universitätsverlag Osnabrück bei v & r unipress; 2008
[292] Jantzen W. Diagnostik, Dialog und Rehistorisierung: Methodologische Bemerkungen zum Zusammenhang von Erklären und Verstehen im diagnostischen Prozeß. In: Jantzen W, Lanwer-Koppelin W, Hrsg. Diagnostik als Rehistorisierung. Methodologie und Praxis einer verstehenden Diagnostik am Beispiel schwer behinderter Menschen. Berlin: Edition Marhold; 1996: 9–31
[293] Just A. Phänomenologische Ansätze in der Pflegediagnostik. In: Sennenwald Etzel B, Hrsg. Pflegediagnostik und Pflegeklassifikationssysteme. Entwicklung und Anwendung. Stuttgart: Kohlhammer; 2003: 27–39
[294] Kean S. Pflegediagnosen: Fragen und Kontroversen. Pflege 1999; 12: 209–215
[295] Kersting K. Editorial: „Kluge Konzepte“ zur Verbesserung der Situation in der Pflege oder zur Perspektive einer kritischen Pflegewissenschaft. Pflege 2008; 21: 3–5
[296] Kesselring A. Psychosoziale Pflegediagnostik: Eine interpretativ-phänomenologische Perpektive. Pflege 1999; 12: 223–228
[297] Kollak I, Huber A. Pflegediagnose kontrovers. Heilberufe 1996; 4: 19–21
[298] König P. Status Quo ICNP. Die Internationale Klassifikation für die Pflegepraxis. Vortrag auf der Tagung „Aufgeräumte Pflege?“ am 05.09.2014 in Wien.
[299] König P. Die Internationale Klassifikation für die Pflegepraxis (ICNP). 2005. Im Internet: http://icnp.info/; Stand: 14.12.2016
[300] Moorhead, S, Johnson M et al. Nursing Outcomes Classification (NOC). Measurement of Health Outcomes. 5th. ed. St. Louis, Missouri, Elsevier mosby; 2013
[301] Mortensen RA. Pflegediagnosen. Entwicklung und Anwendung. Artikel-Sammlung. Schriftenreihe zum Managementhandbuch Krankenhaus. Bd. 10. Heidelberg: v. Decker; 1998
[302] Müller-Staub M. Nursing Diagnostics – Advanced Nursing Process. Vortrag auf dem Europäischen Pflegesymposium in Neumarkt am 16.06.2016.
[303] NANDA International Inc. Pflegediagnosen: Definitionen und Klassifikation 2015–2017. Herausgegeben von Herdmann H, Kamitsuru S. Kassel: Recom; 2016
[304] NANDA International. Pflegediagnosen: Definitionen und Klassifikation 2007–2008. Deutsche Ausgabe herausgegeben von Berger S, Mosebach H, Wieteck P. Bad Emstal: Recom; 2008
[305] Nielsen GH. Internationale Zukunftsperspektiven von Klassifikationssystemen. In: Sennenwald Etzel B, Hrsg. Pflegediagnostik und Pflegeklassifikationssysteme. Entwicklung und Anwendung. Stuttgart: Kohlhammer; 2003: 113–139
[306] Powers P. Der Diskurs der Pflegediagnosen. Bern: Hans Huber; 1999
[307] Remmers H. Zur Bedeutung biographischer Ansätze in der Pflegewissenschaft. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 2006; 3: 183–191
[308] Rosenblum B. Living in an unstable body. Out/Look. Spring; 1988: 43–51
[309] Rosenhan DL. Gesund in kranker Umgebung. In: Watzlawick P, Hrsg. Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus. München: Piper; 1998; 111–137 (Originaltitel: On Being Sane in Insane Places. Science 1973; 179: 250–258)
[310] Sarasin P. Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers 1765–1914. Frankfurt/M: Suhrkamp; 2001
[311] Schramme T. (Hg.) Kranheitstheorien. Berlin: Suhrkamp; 2012
[312] Schramme T. Patienten und Personen. Zum Begriff der psychischen Krankheit. Frankfurt/M.: Fischer; 2000
[313] Schrems B. Der Prozess des Diagnostizierens in der Pflege. Wien: UTB; 2003
[314] Schrems B. Verstehende Diagnostik. Grundlagen zum angemessenen Pflegehandeln. Wien: Facultas; 2008
[315] Schütze F. Die Fallanalyse. Zur wissenschaftlichen Fundierung einer klassischen Methode der Sozialen Arbeit. In: Rauschenbach T, Ortmann F, Karsten ME, Hrsg. Der sozialpädagogische Blick. 2. Aufl. Weinheim: Juventa; 1993: 191–221
[316] Stemmer R. Pflegeklassifikationen und der Anspruch umfassender Pflege. In: Piechotta G, von Kampen N, Hrsg. Ganzheitlichkeit im Pflege- und Gesundheitsbereich. Anspruch – Mythos – Umsetzung. Berliner Beiträge zur Sozialen Arbeit und Pflege. Bd III. Berlin: Schibri; 2006: 78–98
[317] van der Bruggen H. Pflegeklassifikationen. Bern: Huber; 2002
[318] Watzlawick P, Hrsg. Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus. München: Piper; 1998
[319] Wißmann P, Gronemeyer R. Demenz und Zivilgesellschaft – eine Streitschrift. Frankfurt/M.: Mabuse; 2008
[320] Zanotti R, Chiffi D. Diagnostic frameworks and nursing diagnoses: a normative stance. Nursing Philosophy 2015, 16: 64–73
[321] Zielke-Nadkarni A. Einige Überlegungen zur Fachsprache in der Pflege. Pflege 1997; 10: 43–46
4.10.1.3 Assessmentinstrumente in der Pflege
[322] Aiken L., Sloane DM, Bruyneel L et al. Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. The Lancet 2014, 383, (9931): 1824–1830
[323] Bartholomeyczik S. Pflegebedarf einschätzen. Pflegerisches Assessment. CNE 1/2008
[324] Bartholomeyczik S, Halek M, Hrsg. Assessmentinstrumente in der Pflege. Möglichkeiten und Grenzen. 2. Aufl. Hannover: Schlütersche; 2009
[325] Bartholomeyczik S, Reuter S, Luft L, Nie N van, Meijers J, Schols J. Prävalenz von Mangelernährung, Maßnahmen und Qualitätsindikatoren in deutschen Altenpflegeheimen – erste Ergebnisse einer landesweiten Pilotstudie. Gesundheitswesen 2010, 72 (12); 868–874
[326] Grebe C, Brandenburg H. Resident Assessment Instrument. Anwendungsoptionen und Relevanz für Deutschland. Z Gerontol Geriat 2015 48: 105–113, DOI 10.1007/s00391–015–0855–6
[327] dip (Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung), Hrsg. Pflegeberichterstattung im Überblick. Eine Studie über Pflegedaten im In- und Ausland. Hannover: Schlütersche; 2003
[328] GKV (Gesetzliche Krankenversicherung) Spitzenverband, Hrsg. Das neue Begutachtungsinstrument zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit. Schriftenreihe Modellprogramm zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung Band 2 (2011). Im Internet: www.gkv-spitzenverband.de; Stand: 14.12.2016
[329] Glaus A, Müller S. Messung der Müdigkeit bei Krebskranken im deutschen Sprachraum: Die Entwicklung des Fatigue Assessment Questionnaires. Pflege 2001; 14 (3); 161–171
[330] Hunstein D. Das ergebnisorientierte PflegeAssessment acute Care (ePA-AC). In: Bartholomeyczik S, Halek M, Hrsg. Assessmentinstrumente in der Pflege. Möglichkeiten und Grenzen. 2. Aufl. Hannover: Schlütersche; 2009; 60–78
[331] Hoehl M, Kullick P, Hrsg. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. 4. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2012
[332] Lyon F, Dawson D. Oucher or CHEOPS for pain assessment in children. Emerg Med J 2003; 20: 5
[333] Radzey B. Mini-Mental-Status-Test und Cohen-Mansfield Agitation Inventory. In: Bartholomeyczik S, Halek M, Hrsg. Assessmentinstrumente in der Pflege. Möglichkeiten und Grenzen. 2. Aufl. Hannover: Schlütersche; 2009; 79–93
[334] Reuschenbach B, Mahler C (Hrsg). Pflegebezogene Assessmentinstrumente. Bern: Huber; 2011
[335] Schreier M M, Bartholomeyczik S. Erfassungsinstrumente zur Einschätzung der Ernährungssituation. In: Bartholomeyczik S, Halek M, Hrsg. Assessmentinstrumente in der Pflege. Möglichkeiten und Grenzen. 2. Aufl. Hannover: Schlütersche; 2009; 28–50
[336] Schrems B. Assessments anwenden. Was müssen Anwender können? In: Bartholomeyczik S, Hrsg. Pflegebedarf einschätzen. Pflegerisches Assessment. Lerneinheit 1. CNE Fortbildung und Wissen für die Pflege 2008; 1: 10–12
[337] Student JC, Napiwotzky A, Palliative Care. Stuttgart: Thieme; 2007
[338] Williams MA, Holloway JR, Winn M, Wolamin MO, Lawler ML, Westwick CR, Chin MH. (1979) Nursing Acitivities and Acute Confusional States in Elderly Hip-Fracture Patients. Nursing Research 1979; 28: 25–35
4.10.1.4 Case Management
[339] DNQP, Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege. Hrsg. Expertenstandard Entlassungsmanagement in der Pflege. Osnabrück: DNQP; 2009
[340] Ewers M. Case Management als Aufgabe der Pflege. In: Schaeffler D, Hrsg. Handbuch Pflegewissenschaft. 2. Aufl. Weinheim: Juventa; 2011; 643–660
[341] Ewers M. Krankenhausbasiertes Case Management. Versorgung sicherstellen. Lerneinheit 5. In: CNE 2007; 2: 1–16
[342] Ewers M, Schaeffer D, Hrsg. Case Management in Theorie und Praxis. 2. Aufl. Bern: Huber; 2005
[343] Löcherbach P, Kug W, Remmel-Fapbender R, Wendt WR, Hrsg. Case Management: Fall- und Systemsteuerung in der Sozialen Arbeit. 4. Aufl. München: Reinhardt; 2009
[344] Wendt WR. Case Management im Sozial- und Gesundheitswesen. Eine Einführung. 6., aktualisierte Aufl. Freiburg i. Br.: Lambertus; 2014
4.10.1.5 Recht
[345] Ekert B, Ekert Ch, Psychologie für Pflegeberufe. 3. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2013
[346] Hell W. Alles Wissenswerte über Staat, Bürger, Recht. 7. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2013
[347] Kellnhauser E et al., Hrsg. Thiemes Pflege. 13. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2016
[348] Köther I, Hrsg. Altenpflege. 3. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2011
[349] Laufs A, Uhlenbruck W, Genzel H, Hrsg. Handbuch des Arztrechts, 4. Aufl. München: C.H. Beck; 2010
[350] Palandt O. Bürgerliches Gesetzbuch, 75. Aufl. München: C.H. Beck; 2015
[351] Sappke-Heuser S. Rechtliche Rahmenbedingungen altenpflegerischer Arbeit. In: Charlier S. Soziale Gerontologie. Stuttgart: Thieme; 2007
[352] Student JC, Napiwotzky A. Palliative Care. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2011
[353] Stolz K, Warmbrunn J, Schmolz U, Elsbernd A. Betreuungsrecht und Pflegemanagement. Stuttgart: Thieme; 2007
4.10.2 Fachzeitschriften
[354] International Journal of Nursing Terminologies and Classifications. The Official Journal of NANDA International. Edited by Georgia Griffith Whitley.
4.10.3 Kontakt- und Internetadressen
4.10.3.1 Pflegeprozess, Pflegesysteme, wirtschaftlich Aspekte, Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung
[355] http://www.fh-muenster.de; Stand: 14.12.2016
[356] https://www.dbfk.de/de/expertengruppen/netzwerk-primary-nursing; Stand: 14.12.2016
[357] http://www.dgq.de; Stand: 14.12.2016
4.10.3.2 Pflegediagnosen
[358] http://www.acendio.net; Stand: 14.12.2016
[359] NANDA International, E-Mail: info@nanda.org
[360] www.icnp.info; Stand: 14.12.2016
4.10.3.3 Case Management
[361] http://www.dgcc.de; Stand: 14.12.2016
[362] http://www.netzwerk-cm.ch; Stand: 14.12.2016
4.10.3.4 Recht
[363] http://www.gesetze-im-internet.de; Stand: 14.12.2016