
10 ATL Wach sein und Schlafen
Fallbeispiel
Simone Jochum
Pflegesituation Frau Rosenberger
Frau Rosenberger ist 37 Jahre alt und lebt seit fast einem Jahr von ihrem Ehemann getrennt. Demnächst steht der Scheidungstermin an. Frau Rosenbergers 9-jährige Tochter Annika leidet sehr unter der Trennung ihrer Eltern. Wer zukünftig das Sorgerecht für Annika erhalten wird, ist noch nicht geklärt.
Heute wird Frau Rosenberger auf die internistische Abteilung wegen einer Verschlechterung ihres langjährig bekannten Asthma bronchiale aufgenommen. Gesundheits- und Krankenpflegerin Clara Neumann führt mit Frau Rosenberger das Aufnahmegespräch. Bei der Frage nach auftretenden Schlafstörungen seufzt Frau Rosenberger: „Seit meiner Trennung habe ich Probleme, abends einzuschlafen, manchmal schlafe ich in der Nacht nur wenige Stunden. Morgens bin ich dann wie gerädert und dann kommt noch dieser Husten dazu. Außerdem mache ich mir Sorgen um meine Tochter, weil ich jetzt im Krankenhaus bin und nicht bei ihr sein kann. Wenn ich mir nicht mehr zu helfen weiß, nehme ich ab und zu eine Schlaftablette ein. Aber eigentlich möchte ich keine Schlafmedikamente einnehmen, das ist doch keine Dauerlösung.“ Clara Neumann schlägt Frau Rosenberger Folgendes vor: „Wenn es Ihnen recht ist, richte ich Ihnen jetzt noch die angeordneten Medikamente für den Tag. Danach werde ich noch mal zu Ihnen kommen und mit Ihnen in Ruhe über Ihre Schlafstörungen sprechen.“ Frau Rosenberger nickt zustimmend: „Das wäre sehr nett von Ihnen. Ich befürchte, dass ich hier in der fremden Umgebung sowieso kein Auge zutun werde.“
Die Phasen des Wachseins und Schlafens spiegeln den ständig wechselnden Rhythmus des Lebens wider. Dieser Rhythmus zeichnet sich durch Aktivität im Wachsein und Passivität (zumindest physische) im Schlaf aus. Der Mensch benötigt den regelmäßig wiederkehrenden Schlaf als Ausgleich zum Wachsein. Wachen und Schlafen bestimmen unseren Tagesablauf. Die meisten Menschen gehen jahrelang ungefähr zur selben Zeit ins Bett und stehen zur selben Zeit auf.
Der Körper stellt sich mit seinem Biorhythmus („innere Uhr“) auf diesen Schlaf-Wach-Rhythmus ein. Wie wir unser Wachsein und Schlafen gestalten, ist sehr eng mit unseren Lebensumständen bzw. mit unserem individuellen Lebensstil verknüpft. Nur an Wochenenden, Feiertagen oder im Urlaub kommt es zu Abweichungen der Schlafzeit. Störungen der Gewohnheiten durch andere Lebensumstände (Urlaub, Auslands- oder Krankenhausaufenthalte) können zu Schlafrhythmusproblemen und einem verminderten Wohlbefinden führen (z. B. Jetlag nach einem Aufenthalt in einer anderen Zeitzone).
Merke
Von der „inneren Uhr“ ist es auch abhängig, ob man eher ein Frühaufsteher bzw. Morgentyp („Lerche“) oder Langschläfer bzw. Abendtyp („Eule“) ist.
10.1 Grundlagen aus Pflege- und Bezugswissenschaften
10.1.1 Schlaf-Wach-Rhythmus
Der Schlaf ist eine physiologische Bewusstseinsveränderung, die der Regeneration von physischen und psychischen Kräften dient. Genügend Schlaf zu haben ist entscheidend für unsere Gesundheit und unser Wohlergehen. Durch die veränderte Hirnaktivität und angepasste Bewusstseinslage erholen sich sowohl unser Körper als auch unsere Psyche und sammeln neue Kräfte.
Wie wissenschaftlich bestätigt wurde, kann permanenter Schlafentzug zu psychischen und körperlichen Erkrankungen führen. Knutson et al. (2007) haben in einer epidemiologischen Studie nachgewiesen, dass Schafentzug die Prävalenz von Diabetes und Adipositas erhöhen kann. Auch über schizophrenieähnliche Zustände, ausgelöst durch 24-stündigen Schlafentzug, wurde bereits berichtet (Ettinger et al. 2014). Kurzzeitiger Schlafentzug wiederum kann bei der Behandlung von Depressionen unterstützend wirken.
Im Wachzustand ist der Mensch i. d. R. aktiv, die Organtätigkeit wird durch den Sympathikus bestimmt. Im Schlafzustand ist der Körper auf Ruhe und Erholung eingestellt, die Augen sind geschlossen. Die Organtätigkeit wird in der Ruhephase durch den Parasympathikus beeinflusst. Muskeltonus, Herzfrequenz und Blutdruck sind herabgesetzt, die Atmung ist langsamer und tiefer. So sinkt auch die Körpertemperatur nach der ersten Tiefschlafphase ab und steigt erst wieder beim Aufwachen an. Jedoch sind die Stoffwechselaktivität und die Darmtätigkeit im Vergleich dazu erhöht.
Der Schlaf stellt einen physiologischen Ausgleich zum Wachsein des Menschen dar. Mögliche Funktionen des Schlafs nach Kunz (2006) sind:
-
Energiesparen
-
Erholung
-
Gedächtniskonsolidierung
-
Lernen
-
Koordination metabolischer Prozesse
-
Regeneration des Immunsystems
Obwohl der Schlafende sich in einem Zustand der Bewusstseinsminderung befindet, sind sich die Wissenschaftler sicher, dass der Schlaf ein aktiver Prozess ist. Mentale Prozesse sind weiterhin vorhanden, emotionale Gedächtnisinhalte vom Vortag werden verarbeitet und gespeichert (Birbaumer et al. 2010, Jacobs 2013).
Der gesunde Mensch stellt sich mit seinem Schlaf-Wach-Rhythmus verhältnismäßig exakt auf die 24 Std. eines Tages ein ( ▶ Abb. 10.1). Die Schlafdauer bleibt einigermaßen konstant. Einige Menschen benötigen weniger Schlaf, andere mehr. Der 24-Stunden-Rhythmus ist eingebunden in den natürlichen Wechsel von Tag und Nacht, der auch als zirkadianer Rhythmus (lat. circa = um, herum; dies = Tag) bezeichnet wird. Bei diesem Rhythmus folgen die biologischen Prozesse des Körpers einer „inneren Uhr“. Schaltet man künstlich alle Umwelteinflüsse aus, z. B. bei einer künstlichen Isolation in einem Schlaflabor (keine Geräusche oder Lärm, kein Licht, konstante Raumtemperatur), stellt sich ein Schlaf-Wach-Rhythmus von 25 Stunden (zirkadian) ein (Birbaumer et al. 2010).
Innere Uhr.
Abb. 10.1 Körperliche und geistige Funktionen des Menschen werden durch eine innere Uhr im 24-Stunden-Takt gesteuert.
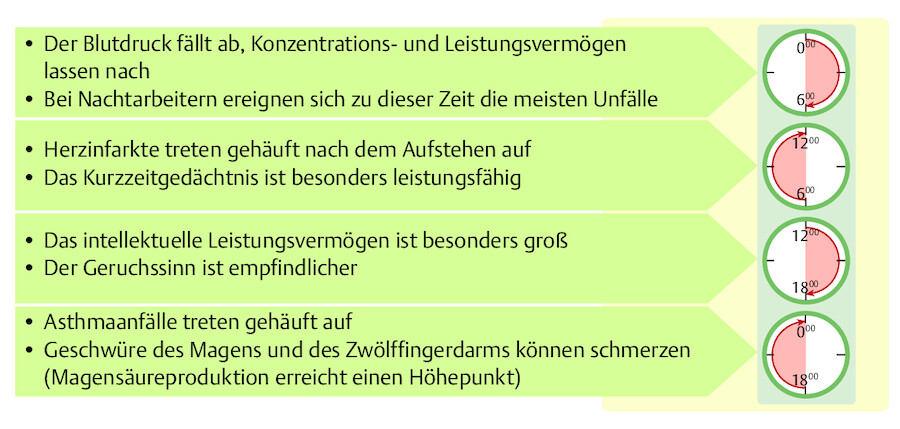
Schichtarbeiter (3-Schicht-System, Nachtdienste) benötigen immer wieder Zeit, ihren Organismus erneut dem zirkadianen Rhythmus anzupassen. Gelingt ihnen dies nicht, können Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus entstehen.
10.1.2 Schlafphasen
Der Schlaf wird vom Weckzentrum (Schlaf-Wach-Zentrum) gesteuert, das seinen Sitz in der Formatio reticularis hat. Im Hinblick auf die Schlaftiefe lassen sich 2 Formen des Schafs unterscheiden:
-
Non-REM-Schlaf (Non-Rapid-Eye-Movement-Schlaf) und
-
der REM-Schlaf (Rapid-Eye-Movement-Schlaf).
Diese beiden Schlafformen wechseln sich im Laufe der Nacht ab.
Non-REM-Schlaf (orthodoxer Schlaf) Entsprechend der Schlaftiefe wird der Non-REM-Schlaf in verschiedene Schlafphasen eingeteilt:
-
Phase 1: SEM-Phase (Slow-Eye-Movement = langsame Augenbewegungen, Einschlafphase, feine Zuckungen der Augenlieder, abrupte Zuckungen einzelner Gliedmaßen)
-
Phase 2: leichter Schlaf (tritt 10–15 Minuten nach dem Zubettgehen auf)
-
Phase 3: mitteltiefer Schlaf (ca. nach 30 Minuten)
-
Phase 4: tiefer Schlaf (erschwerte Erweckbarkeit, Tiefschlafstadium)
In aufeinanderfolgenden Schlafzyklen (Phase 1 → 2 → 3 → 4 → 3 → 2 → 1) werden sie in jeder Nacht etwa 4- bis 5-mal wiederholt ( ▶ Abb. 10.2). Die erste Tiefschlafphase ist in durchschnittlich 35 – 40 Min. erreicht, die Tiefschlafdauer variiert zwischen 30 – und 60 (im ersten Zyklus) und wenigen Minuten (im letzten Zyklus).
Schlafphasen.
Abb. 10.2 Die unterschiedlichen Schlafphasen werden in Zyklen mehrfach in der Nacht durchlaufen. An jeden Zyklus schließt sich eine REM-Phase (Traumphase) an.
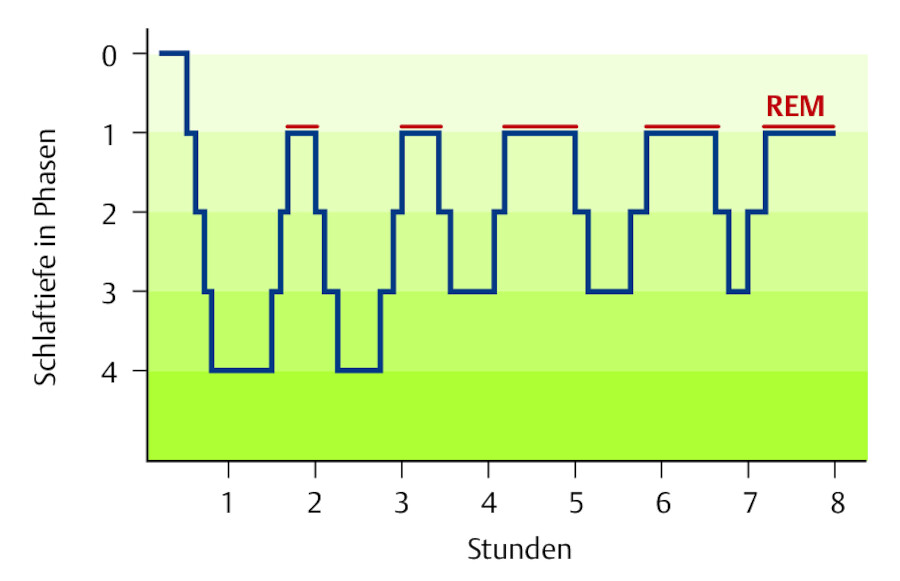
REM-Schlaf (paradoxer Schlaf) Jeder Schlafzyklus wird durch die REM-Phase (Rapid-Eye-Movement) abgeschlossen. Sie ist charakterisiert durch rasche Augenbewegungen und ein fast vollständiges Fehlen des Muskeltonus bei erhöhtem Blutdruck, erschwerter Erweckbarkeit und erhöhter Atemfrequenz. In dieser Phase träumt der Mensch (Traumphase). Die Traumforschung vermutet hinter der Funktion des Träumens Folgendes:
-
Gedächtnisfestigung (Einprägen gelernter Inhalte und gesehener Ereignisse)
-
Kreativitätssteigerung und Lernprozesse
-
Verarbeitung der Tageserlebnisse und unbewusster Konflikte
-
Förderung der Empathiefähigkeit (das traumhafte Hineinversetzen in eine andere Rolle fördert das Einfühlungsvermögen)
-
Stressbewältigung
-
unbewusste Vorbereitung auf anstehende Lebensereignisse (das Erleben einer anstehenden, herausfordernden Situation ist eine Vorbereitung auf das Ereignis [Arnulf 2016])
Die Dauer der Traumphasen nimmt im Laufe einer Nacht zu und kann gegen Morgen bis zu 50 Min. betragen. Bei älteren Menschen geht die Dauer des Tiefschlafs zurück.
In der REM-Phase verbindet das Gehirn neue Informationen mit vorhandenen Gedächtnisinhalten, wodurch neue gedankliche Netze entstehen (Stickold et al. 2000, Cai et al. 2009). Da fast alle Schlafmittel die REM-Phase unterdrücken, kann davon ausgegangen werden, dass der durch Medikamente gewonnene Schlaf nicht erholsam wirkt. Alkohol und Drogen haben in dieser Hinsicht die gleiche Wirkung auf den Schlaf wie Schlafmedikamente.
Schlaflabor Im Schlaflabor wird der Schlaf der Patienten untersucht. Dort können Schlafdauer, Schlaftiefe und Schlafphasen analysiert werden. Die Ergebnisse werden in Form einer Schlafkurve, dem Somnogramm, aufgezeichnet. Weiterhin können auch schlafbezogene Erkrankungen (z.B. Atemstörungen) diagnostiziert und behandelt werden. Die Aufgaben der Pflegekräfte sind das Anbringen der Elektroden, die Steuerung der Aufzeichnungen und der Messungen und die nächtliche Betreuung der Patienten. Über Nacht werden folgende Messungen durchgeführt ( ▶ Abb. 10.3):
Schlaflabor.
Abb. 10.3 Im Schlaflabor werden über Nacht ein Elektroenzephalogramm (EEG), ein Elektrookulogramm (EOG) und ein Elektromyogramm (EMG) aufgenommen.
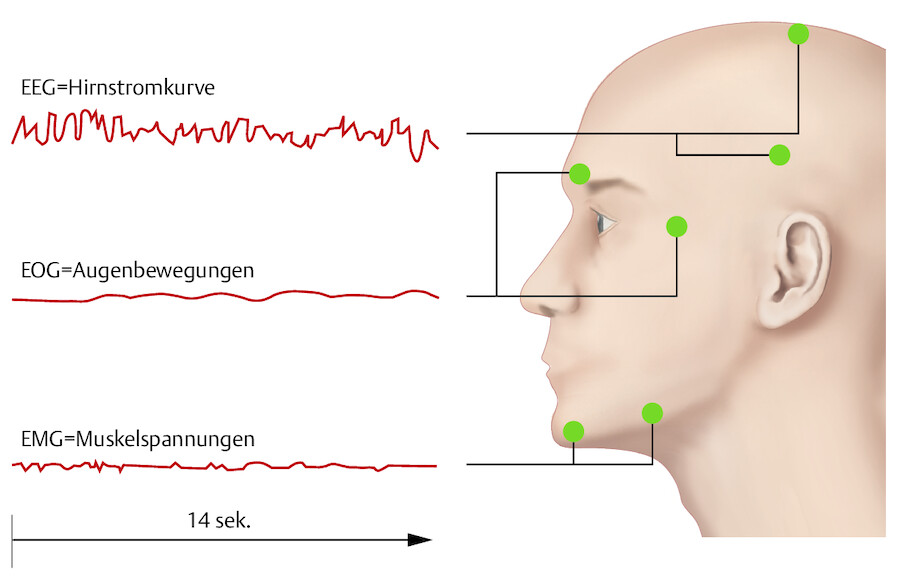
-
EEG (Elektroenzephalogramm) zur Registrierung von elektrischen Hirnströmen
-
EMG (Elektromyogramm) zur Messung der Muskelspannung
-
EOG (Elektrookulogramm) zur Aufzeichnung von elektrischen Strömen, die durch Augenbewegungen entstehen
10.1.3 Wachzustand/Bewusstsein
Definition
Bewusstsein: „Allgemeine Bezeichnung für die Gesamtheit aller psychischen Vorgänge und Qualität von Erlebnissen, verbunden mit Ich-Bewusstsein, Vigilanz (Wachheit), ungestörter Perzeption (Wahrnehmung) und kognitiven Funktionen (Birbaumer et al. 2010).“
Der gesunde Mensch ist im Wachzustand bei klarem Bewusstsein, d. h., er kann seinen Fähigkeiten und seinem Alter entsprechend auf äußere Reize reagieren. Er ist über sich selbst sowie über Zeit und Ort orientiert. Müdigkeit und Schläfrigkeit beeinflussen sowohl die physiologischen als auch die geistigen Fähigkeiten. Zur Beobachtung des Bewusstseinszustandes kann man sich an folgenden Kriterien orientieren:
-
Sprache: Ist eine Unterhaltung möglich?
-
Sensibilität: Erfolgt eine Reaktion auf Schmerzreize (z. B. durch Kneifen)?
-
Motorik: Erfolgt eine Bewegung als Reaktion auf z. B. Schmerzreize?
-
Reflexe: Sind sie auslösbar durch gezielte Reflexüberprüfung?
-
Pupillenreaktion: Reagieren die Pupillen auf Lichteinfall durch eine Taschenlampe?
-
Koordinationsfähigkeit und Reaktionsvermögen: Erfolgen Bewegungen und Funktionen aufeinander abgestimmt, sind Reaktionen auf Einflüsse angemessen schnell?
10.2 Pflegesituationen erkennen, erfassen und bewerten
10.2.1 Schlafbedarf, Schlafdauer und Schlafmuster
Als Pflegende ist es wichtig, den Schlaf des Patienten zu beobachten. Die nachfolgenden Kriterien können Ihnen helfen, den Schlaf besser einzuschätzen:
-
Schlafbedarf/Schlafdauer
-
Schlafmuster
-
Einflussfaktoren auf den Schlaf
-
Schlaftypen
-
Schlafrituale
-
Schlafposition/Schlafhaltung
-
Schlaftiefe (Patient wird beim Betreten des Zimmers durch Pflegekraft leicht wach/schläft tief)
-
Begleitsymptome des Schlafs (Bewegungen, Atmung)
-
pathologische Abweichungen in Schlafqualität, Schafquantität
-
Befinden nach dem Aufwachen
Schlafbedarf und Schlafdauer Schlaf ist eine wesentliche Voraussetzung für Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Die durchschnittliche Schlafdauer liegt in Deutschland bei 7 Stunden und 14 Minuten (RKI 2005). Die tatsächliche Schafdauer ist sehr individuell. Ein verbindliches und objektives Maß gibt es nicht. Der Schlafbedarf und die Schlafdauer verändern sich im Verlauf des Lebens:
-
Säugling: 18 – 20 Std.
-
Kleinkind: 12–14 Std.
-
Schulkind: 10 – 12 Std.
-
Jugendlicher: 8 – 9 Std.
-
Erwachsener: 6 – 8 Std.
-
alter Mensch: ca. 6 Std. + 6–8 Std. für „Nickerchen“
Ebenso verändert sich die Schlaftiefe und somit die Schlafphasen. Beim Neugeborenen macht der REM-Schlaf die Hälfte des Gesamtschlafes aus. Schon im Verlauf des ersten Lebensjahres verringert sich die REM-Schlafzeit drastisch, während die Non-REM-Schlafzeit praktisch gleich bleibt. Im Erwachsenenalter beträgt der REM-Schlafanteil nur noch 20 – 25 % ( ▶ Abb. 10.4).
Schlafbedürfnis.
Abb. 10.4 Das Schlafbedürfnis nimmt im Laufe des Lebens ab. Die Schlafphasen verändern sich und der Anteil des REM-Schlafes am Gesamtschlaf reduziert sich.
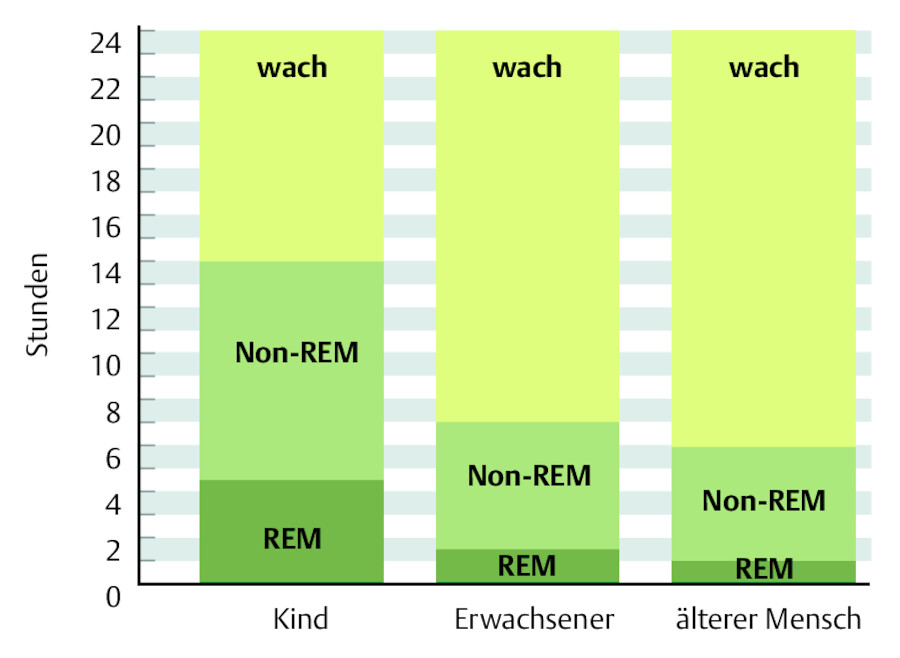
Schlafmuster Im Alter wird das früher monophasische Schlafmuster (Schlaf ohne Unterbrechung) durch ein biphasisches (zweigeteiltes) Schlafmuster abgelöst. Dieses Schlafmuster zeigt, dass zwei Drittel der älteren Menschen eine längere Einschlafzeit haben und während der Nacht mehrmals aufwachen. Der Schlaf älterer Menschen ist durch weniger Tiefschlaf charakterisiert (RKI 2005). Die Wachphasen werden dabei oft als unverhältnismäßig lang und qualitätsbestimmend erlebt, oft mit dem Gefühl, gar nicht geschlafen zu haben. Hier gilt es, diese Situationen als normal und nicht als krankhaft anzunehmen und ins Leben zu integrieren.
10.2.2 Verändertes Schlafbedürfnis
10.2.2.1 Einflussfaktoren
Verschiedene Umstände und Faktoren können das Schlafverhalten und Schlafbedürfnis beeinflussen. Diese Einflussfaktoren können psychisch, physisch, pathologisch oder umgebungsbedingt sein. Zu pflegerischen Maßnahmen bei Schlafstörungen s. ▶ Tab. 10.4 .
Psychische Einflüsse
Stimmungen, sowohl ausgelassene Fröhlichkeit und Erregung als auch Niedergeschlagenheit und Trauer, beeinflussen in großem Maße unseren Schlaf. Akute oder chronische Konflikte, belastende Lebensereignisse sowie unterschiedliche körperliche, psychische oder soziale Stressfaktoren wirken sich positiv oder negativ auf unser Schlafverhalten aus. Krankheit kann als Begleiterscheinung Einfluss auf das Schlafverhalten nehmen, ebenso können Ängste in Bezug auf Diagnose, Therapie, Operation oder Zukunftsperspektiven unseren Schlaf mitunter massiv beeinträchtigen.
Physiologische Einflüsse
Eine ganze Reihe physiologischer Einflüsse beeinflusst unser Schlafverhalten.
Lebensalter Sowohl Schlafdauer als auch Schlaftiefe und Schlafstadien verändern sich im Laufe eines Lebens ( ▶ Abb. 10.4).
Körperliche Aktivität Bewegung und körperliche Aktivität stehen in konstanter Wechselwirkung zum Wachsein und Schlafen. Findet tagsüber eine ausreichende Beanspruchung statt, empfindet der Mensch abends körperliche Erschöpfung und hat ein Schlafbedürfnis. Allerdings kann zu viel abendliche Aktivität ebenso schlafhindernd sein wie zu wenig, da dem Kreislauf und Organismus entweder „aktiv sein“ signalisiert wird oder der Körper nicht ausreichend erschöpft ist.
Essen und Trinken Der übermäßige Genuss von Alkohol unterdrückt die ▶ REM-Phasen und mindert den Erholungswert des Schlafs. Schwere üppige Mahlzeiten am Abend beeinträchtigen den Schlaf, aber auch Hungergefühle können das Einschlafen verhindern. Untersuchungen zeigen, dass Menschen mit Normgewicht oder leichtem Übergewicht besser schlafen als Menschen mit Untergewicht oder während Schlankheitskuren.
Krankheit Manche Krankheiten bzw. Symptome (z. B. Fieber, Schmerzen) beeinflussen unser Schlafverhalten. Beispiele für Krankheiten sind hirnorganische Erkrankungen, Fatigue (chronische Müdigkeit), psychische Störungen (z. B. Depression, Manie) und die Schlafkrankheit (epidemische Enzephalitis). Auch in der Rekonvaleszenzphase ist das Schlafbedürfnis gesteigert.
Eine aktuelle Studie von Schuh-Hofer et al. (2016) kommt zu dem Ergebnis, dass insbesondere der Schmerz und das Schmerzempfinden in einem vielfältigen pathophysiologischen Zusammenhang mit dem Schlaf stehen. Die Prävalenz von Schlafstörungen bei Schmerzpatienten liegt (mit ca. 80%) deutlich über dem Durchschnitt der Allgemeinbevölkerung. Gestörter Schlaf führt zu einer gesteigerten Schmerzempfindlichkeit und begünstig wiederum die Entwicklung von Spontanschmerzen. Neben dem Einsatz schmerzmodulierender Substanzen können Entspannungstechniken helfen.
Umweltbedingte Einflüsse
Eine ungewohnte oder unbequeme Schlafstätte (z.B. Krankenhauszimmer), ein Mehrbettzimmer, unübliche Lichtverhältnisse, Temperatur und Raumluftqualität sowie Lärm können unser Schlafverhalten beeinflussen.
Es gibt Menschen, die in schlecht gelüfteten Räumen oder bei zu hoher oder zu niedriger Luftfeuchtigkeit Einschlafschwierigkeiten haben. Andere wiederum reagieren auf Lichteinflüsse, z. B. flackernde Leuchtreklame, Straßenbeleuchtung, fehlende Abdunkelung oder Dauerbeleuchtung auf Intensivstationen. Außerdem können Geräusche, Straßen- oder Fluglärm, knallende Türen, laute Musik oder das Schnarchen des Partners den Schlaf stören. Lärm, auch wenn er vom Schläfer nicht registriert wird, stört die Schlafqualität unbewusst, denn das Gehör ist im Schlaf funktionstüchtig und nimmt Geräusche wahr, verarbeitet und filtert diese (Herz 2015). Eine epidemiologische Langzeitstudie von Leitmann et al. (2003) kommt zu dem Ergebnis, dass ein dauerhaft hoher Geräuschpegel im Schlaf das Bluthochdruckrisiko um ein Vielfaches erhöht. Darüber hinaus besteht ein Zusammenhang zwischen nächtlicher Lärmbelastung und den Beeinträchtigungen des Immunsystem und des Stoffwechsels (Umweltbundesamt 2015).
Viele Menschen sind in ihrem Schlaf auch von der Wetterlage abhängig (z. B. Wetterumschläge, Innen- und Außentemperaturen) oder schlafen bei Vollmond schlechter.
10.2.2.2 Schlafstörungen (Dyssomnien)
Fallbeispiel
Frau Kaiser, 46 Jahre alt, ist Hausfrau und Mutter von 2 Töchtern. Bei Frau Kaiser wurde eine Verhärtung der rechten Brust im oberen äußeren Quadranten festgestellt, die sich als Mammakarzinom bestätigte. Frau Kaiser erhielt eine Ablatio rechts mit Ausräumung der axillaren Lymphknoten. Nach Abschluss der Wundheilung sind ambulante Chemotherapie und Bestrahlung vorgesehen. Frau Kaiser ist in großer Sorge, was da noch alles auf sie zukommt, und kann nachts nicht schlafen. Sie liegt sehr lange wach, dreht sich x-mal um und findet keine Ruhe. Außerdem vermisst sie ihre Familie. Die betreuende Gesundheits- und Krankenpflegerin im Nachtdienst hat Frau Kaiser eine Schlaftablette angeboten. Frau Kaiser lehnt dies jedoch ab; sie meint, das sei keine Dauerlösung und die Probleme seien morgen nicht beendet, außerdem habe sie schon viel über Abhängigkeiten gelesen.
Ein Patient schildert Schlaflosigkeit, Einschlafschwierigkeiten, häufiges Erwachen oder vorzeitiges Aufwachen. Die Diagnose Schlafstörung ist schnell gestellt, aber welches u. U. vielschichtige Problem dahintersteckt, ist vorerst noch nicht zu ahnen. Der Ursachenbereich kann sehr vielfältig sein (s. Einflussfaktoren).
Etwa ein Drittel der Befragten einer Studie des Robert Koch-Instituts (RKI 2013) hatte in den letzten 4 Wochen potenziell klinisch relevante Symptome einer Einschlaf- oder Durchschlafstörung. Etwa ein Fünftel berichtete zusätzlich über schlechte Schlafqualität.
Langfristig anhaltende Schlafstörungen sollten immer ärztlich abgeklärt werden. Eine sorgfältige Pflegeanamnese und Patientenbeobachtung können bei der Klärung der Ursachen unterstützen. Das Führen eines Schlafprotokolls (s. ▶ Abb. 10.7) kann hilfreich sein.
Klassifikationsmodelle
Bei der Differenzierung von Schlafstörungen gibt es verschiedene Klassifikationsmodelle/-muster. Die ICSD (International Classification of Sleeping Disorders) klassifiziert nach Art und Ursache wie folgt:
-
Insomnien
-
schlafbezogene Atmungsstörungen
-
zirkadiane Schlaf-Wach-Rhythmus-Störungen
-
Parasomnien
-
schlafbezogene Bewegungsstörungen sowie andere Schlafstörungen (AASM 2015, Mayer et al. 2015) ( ▶ Tab. 10.1 ).
Die genannten Störungen treten häufig in Mischformen auf.
|
Hauptkategorien |
Zugeordnete Störungen/Erkrankungen |
|
Insomnie |
|
|
Schlafbezogene Atmungsstörungen |
|
|
Hypersomnien ohne Bezug zu schlafbezogenen Atmungsstörungen |
|
|
Störungen des zirkadianen Rhythmus |
Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus (z.B. durch Schichtarbeit, Zeitzonenwechsel, Jetlag, Hospitalisierung, Substanzmittelgebrauch, Ängste, Besorgnis, Depression, chronische Schmerzen, Atemnot) |
|
Parasomnien |
z.B. Schlafwandeln (Somnambulismus), Pavor nocturnus (plötzliches Aufrichten), Somniloquie (Sprechen im Schlaf), nächtliche Alpträume, schlafbezogene Halluzinationen (und andere Störungen, die jeweils im Schlafablauf auftreten können, ohne in der Regel die Erholungsfunktion des Schlafs zu beeinträchtigen) |
|
Schlafbezogene Bewegungsstörungen |
|
|
Isolierte Symptome, augenscheinlich normale Varianten und geklärte Probleme |
Langschläfer, Kurzschläfer, Schnarchen, Sprechen im Schlaf, Einschlafzuckungen etc. |
|
Andere Schlafstörungen |
u. A. umweltbedingte Schlafstörungen |
Insomnien Insomnie bedeutet im eigentlichen Wortsinn eine komplette Schlaflosigkeit. Im klinischen Sprachgebrauch werden damit jedoch Ein- und Durchschlafstörungen oder ein nicht erholsamer Schlaf und eine damit verbundene Leistungsunfähigkeit oder Tagesbefindlichkeit bezeichnet (Spiegelhalder et al. 2011).
Schlafapnoe Schlafapnoe steht für nächtliche kurze Atemstillstände währende des Schlafs, die oft mit einer lauten und unregelmäßigen Schnarchproblematik einhergehen. Schlafapnoe tritt gehäuft bei Menschen mit Adipositas, arterieller Hypertonie, KHK oder Herzrhythmusstörungen auf (RKI 2005).
Hypersomnien Als Hypersomnie bezeichnet man ein pathologisch erhöhtes Schlafbedürfnis und übermäßige Tagesschläfrigkeit. Begleitet wird die übermäßige Tagesschläfrigkeit durch Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen und Leistungseinbußen. Eine Hypersomnie kann eine Begleiterscheinung der nächtlichen Insomnie oder ein Zeichen anderer körperlicher oder psychischer Erkrankungen (Krebserkrankung, Depression) sein.
Störungen des zirkadianen Rhythmus Dies sind diverse Veränderungen des Schlaf-Wach-Rhythmus, bei denen eine mangelnde Synchronität zwischen dem individuellen und dem in der Umgebung gewünschten Schlaf-Wach-Rhythmus vorliegt.
Parasomnien Parasomnien sind durch unerwünschte Symptome, die im Schlaf auftreten können, gekennzeichnet. Mayer und Kotterba (2004) unterscheiden folgende Ausprägungen der Parasomnien:
-
Pavor nocturnus (plötzliches Aufrichten im Bett, verbunden mit einem Schrei und der Aktivierung des vegetativen Systems [Tachykardie, Tachypnoe])
-
Somnambulismus (Schlafwandeln), Somniloquie (Sprechen im Schlaf).
Insbesondere das Schlafwandeln erfordert eine sorgfältige Diagnostik, da es mit einer Selbstverletzungsgefahr eingeht.
Schlafbezogene Bewegungsstörungen, z.B. Restless-Legs-Syndrom (RLS) Das Restless-Legs-Syndrom (Syndrom der ruhelosen Beine) ist eine schlafbezogene Bewegungsstörung, die mit folgenden Symptomen einhergehen kann:
-
quälende Empfindungen in den Beinen (vor dem Einschlafen)
-
Missempfindungen der Beine (Ameisenlaufen, Brennen, Jucken)
-
Bewegungsdrang der Beine
Folgen von Schlafstörungen/Schlafmangel
Zu welchen Auswirkungen Schlafstörungen führen können, ist abhängig von der Dauer, der Intensität, der Ursache und dem individuellen Empfinden des Betroffenen. Folgende Auswirkungen können auftreten:
-
Konzentrationsschwäche und Schläfrigkeit tagsüber
-
Reduktion der Leistungsfähigkeit
-
Ungeduld und Reizbarkeit
-
innere Unruhe und Nervosität
-
Zerschlagenheit und verlangsamte Reaktion
-
emotionale Störungen
-
Persönlichkeitsstörungen
-
Abnahme der Kreativität
-
gesteigertes Schmerzempfinden
Schlaflosigkeit, wie immer sie sich auch manifestiert und wodurch sie verursacht ist, ist für den Betroffenen ein schwerwiegendes gesundheitliches Problem. Eine Vielfalt an Ursachen kann dazu führen, dass ein Circulus vitiosus entsteht. ( ▶ Abb. 10.5). Neben den akuten Auswirkungen können auch langfristige Störungen durch einen pathologisch veränderten Schlaf ausgelöst werden. Das Schlafapnoesyndrom ist ein Risikofaktor für: Bluthochdruck, Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall (RKI 2005).
Teufelskreis.
Abb. 10.5 Der Teufelskreis des gestörten Schlafes und der Angst vor dem Nicht-schlafen-Können. Hilfe bringt nur das Durchbrechen des Gedankenmusters und der Erwartungshaltung.
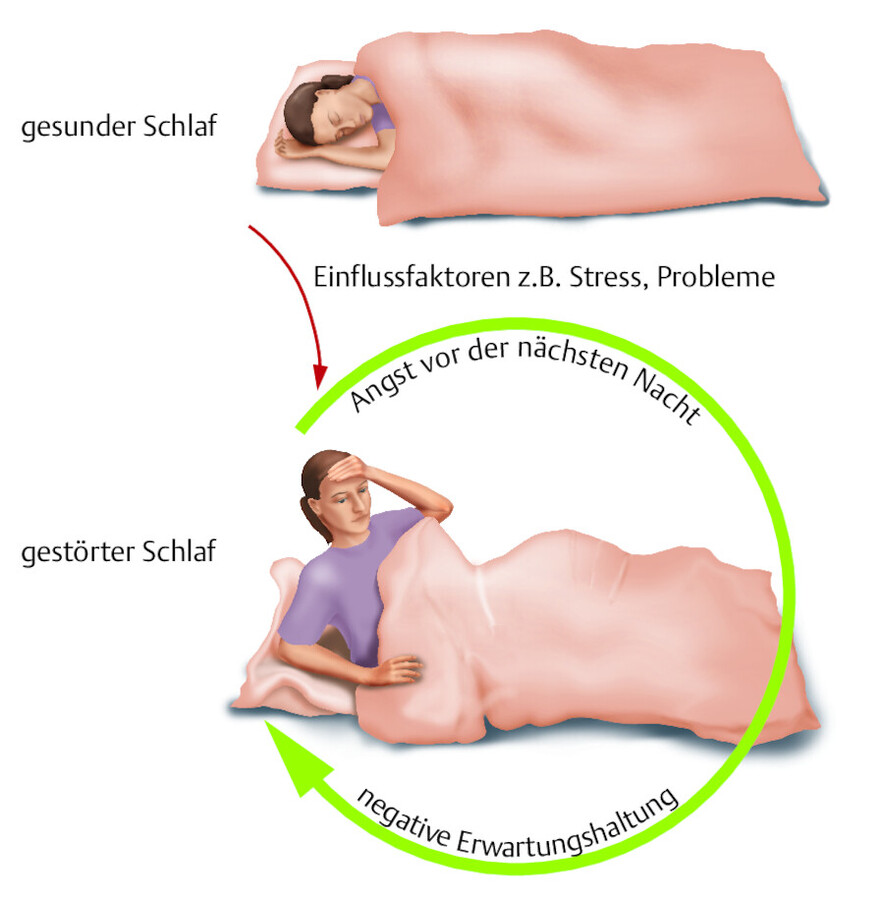
Merke
Menschen mit Schlafstörungen brauchen menschliche Begleitung und fachliche Beratung. Die Ursachen zu beheben ist besser als das Überdecken durch Medikamente.
10.2.3 Schlafanamnese und Schlafprotokoll
Um die vielfältigen Ursachen und Auswirkungen von Schlafstörungen zu erfassen, ist eine gute Beobachtung des Patientenverhaltens am Tag und in der Nacht erforderlich. Des Weiteren ist eine umfangreiche Anamnese zu erheben und ggf. ein Schlafprotokoll anzufertigen ( ▶ Abb. 10.7), um den Schlaf über einen längeren Zeitpunkt beurteilen zu können. Die in ▶ Abb. 10.6 aufgeführten Fragen sollten bei der Anamnese berücksichtigt werden. Mit den Betroffenen sind folgende Fragen zu klären:
Schlafanamnese.
Abb. 10.6 Die aufgeführten Fragen helfen bei der Erstellung der Schlafanamnese.

Schlafprotokoll.
Abb. 10.7 Um den Schlaf über einen längeren Zeitraum hinweg zu beurteilen, kann ein Schlafprotokoll angefertigt werden. Mithilfe der protokollierten Beobachtungen können Hinweise auf die Schlafstörung und dessen Ursache gewonnen werden.
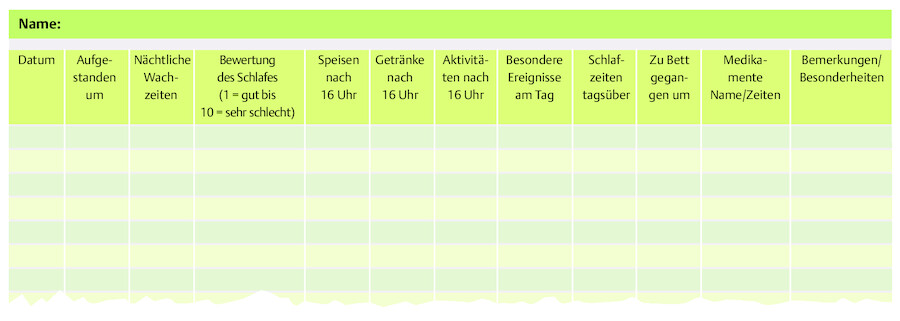
-
Tritt die Schlafstörung akut auf oder besteht generell ein Schlafproblem?
-
Kennt der Patient die Ursachen für seine Schlafstörung?
-
Verfügt er über eindeutige Einschlafrituale?
Praxistipp
Nehmen Sie sich Zeit für diese Gespräche. Nur so werden Sie gemeinsam mit dem Patienten Wege zur Bewältigung seiner Schlafprobleme finden.
Lebensphase Kind
Mechthild Hoehl
Wach sein und schlafen im Kindesalter
Schlafbedarf von Kindern
Schlafbedarf, Schlafverhalten und Schlafmuster verändern sich im Laufe des Lebens – jedes Kind ist anders, weshalb auch der Schlafbedarf sehr unterschiedlich sein kann. Schwankungen der Schlafdauer sind normal. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über den durchschnittlichen Schlafbedarf ( ▶ Tab. 10.2 ).
|
Alter |
Schlafbedarf |
|
bis zu 3 Monaten |
16–18 Std. |
|
4–5 Monate |
14–15 Std. |
|
6–12 Monate |
13 Std. |
|
1–4 Jahre |
12 Std. |
|
5–6 Jahre |
11,5 Std. |
|
7–9 Jahre |
11 Std. |
|
10–11 Jahre |
10,5 Std. |
|
12–13 Jahre |
10 Std. |
|
14–16 Jahre |
9 Std. |
Der Schlaf verteilt sich v.a. im ersten Lebensjahr auf Tag und Nacht; je mehr und je häufiger das Kind über den Tagesverlauf schläft, desto weniger schläft es in der Nacht.
Verteilt sich der Tagschlaf anfangs noch auf 4–5 Schlafphasen, so nehmen diese im ersten Lebensjahr pro Quartal um eine Schlafphase ab . Vom 1. Geburtstag an bleibt dann in der Regel ein Mittagsschlaf als Tagschlaf übrig, der zwischen dem 2. und 5. Geburtstag des Kindes nicht mehr benötigt wird.
Kinder befinden sich je nach Alter bis zu 85% ihrer gesamten Schlafzeit in der REM-Phase. In dieser Phase ist das Gehirn sehr aktiv und die Kinder sind leicht erweckbar. Etwa alle 30 Min. wachen sie kurz auf und prüfen unterbewusst ihre Körperfunktionen, um dann im Idealfall wieder einzuschlafen ( ▶ Abb. 10.8).
Das Schlafmuster von Kindern.
Abb. 10.8
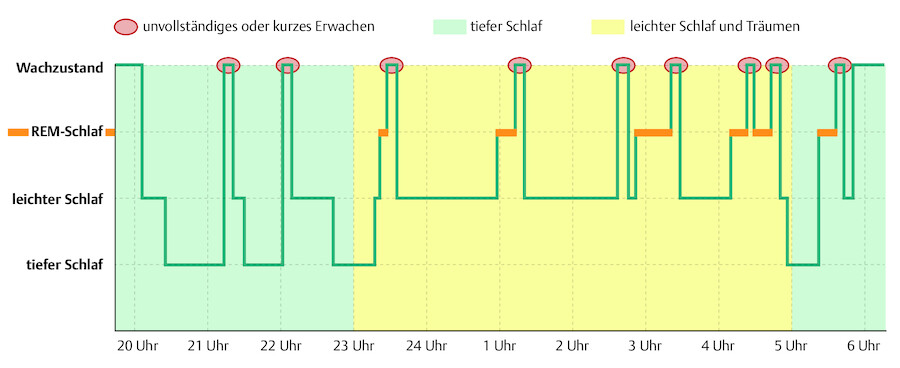
Typische Schlafstörungen im Kindesalter
Schlafstörungen kommen häufig im Kindesalter vor. Ursache hierfür können die folgenden Faktoren sein:
-
passagere Regulationsstörungen aufgrund von Unreife, Übererregbarkeit, Schmerzen durch geburtstraumatische Verletzungen
-
physiologische Schlafunterbrechungen durch die Notwendigkeit einer nächtlichen Nahrungsaufnahme in den ersten Lebensmonaten
-
Schlafunterbrechungen durch entwicklungsbedingte Unruhe im Zusammenhang mit großen Entwicklungssprüngen, z.B. beim Krabbeln-, Laufen- oder Sprechenlernen oder im Rahmen der Sauberkeitsentwicklung
-
unbestimmte Ängste, vor allem im Kindergartenalter, der sogenannten magischen Entwicklungsphase
-
Schlafwandeln (Somnambulismus)
-
Schwierigkeiten der Selbstregulation durch ungünstige Beruhigungsstrategien der Eltern
-
Nachtschreck (lat.: Pavor nocturnus): Der Nachtschreck ist eine Form der Parasomnie, die vor allem im Kleinkindesalter in der Non-REM-Phase auftritt. Er ist gekennzeichnet durch anfallsartig auftretendes, unstillbares Schreien mit vegetativer Erregung bei einem ansonsten nicht oder schwer erweckbaren Kind. Dieses Phänomen ist harmlos.
Bei Einschlafen und Wiedereinschlafen benötigen Kinder je nach Naturell, Regulationsfähigkeit und Unterstützung der Eltern unterschiedlich viel Hilfe. Es gibt bei Eltern unterschiedliche kulturell, weltanschaulich oder persönlich geprägte Auffassungen darüber, wie das optimale Schlafverhalten und Ritual aussieht. Nicht alle dieser Schlafrituale sind von außen betrachtet sinnvoll und zielführend, vor allem dann, wenn die Rituale längere Zeit in Anspruch nehmen oder an bestimmte Grundvoraussetzungen gebunden sind, die sich schlecht auf andere Personen übertragen lassen.
Solange bei den Familien kein Leidensdruck bzgl. des Schlafverhaltens herrscht, besteht jedoch kein Handlungsbedarf. In diesem Fall sollten familiäre Schlafrituale, sofern das Krankheitsgeschehen des Kindes es zulässt, auch im Krankenhaus ermöglicht werden. Dies gilt umso mehr, als dass manche Krankheiten oder therapeutische Interventionen bei Kindern das Schlafverhalten zusätzlich stören können.
Krankheitsbedingte Schlafstörungen im Kindesalter
Durch Krankheiten und deren Behandlung kann der kindliche Schlaf beeinflusst werden:
-
Adenoide Vegetationen (sog. Polypen) führen im Kleinkindsalter zu nächtlichem Schnarchen und Schlafproblemen.
-
Reflux (Sodbrennen)
-
Nächtliche Krampfanfälle können mit dem Pavor nocturnus verwechselt werden.
-
Behandlung mit anregenden Medikamenten erschwert die Selbstregulation. Hier sind vor allem die Sympathomimetika zu nennen, die bei den im Kleinkindsalter häufigen obstruktiven Atemwegserkrankungen eingesetzt werden.
-
Jaktationen: Hin- und Herwerfen des Kopfes oder Körpers als Hilfsmittel zum Einschlafen. Dies kommt bei Kindern mit Wahrnehmungsschwächen, Autismus oder deprivierten Kindern gehäuft vor und sollte kinderneurologisch abgeklärt werden.
-
Wie auch im Erwachsenenalter führen die ungewohnte Umgebung, Geräusche, Schmerzen, Atemnot, Zu- und Ableitungen, Schienen, ungewohnte Schlafhaltungen die therapeutisch verordnet sind, zu Beeinträchtigung der Schlafqualität.
Eine Mitaufnahme einer primären Bezugsperson erleichtert es dem Kind, im Krankenhaus zur Ruhe zu finden.
Frühkindliche Regulationsstörungen
Frühkindliche Regulationsstörungen bezeichnen außergewöhnliche Schwierigkeiten eines Säuglings und Kleinkindes, sein Verhalten in einem oder mehreren Bereichen zu regulieren, z.B. unstillbares Schreien, Schlafstörungen, aber auch Fütterstörungen sowie Störungen der Affektregulation.
Da Säuglinge und Kleinkinder ihr Verhalten in der Regel nur in Zusammenspiel mit einer Bezugsperson regulieren können, sind frühkindliche Regulationsstörungen häufig die Folge oder auch die Ursache von Eltern-Kind-Bindungsproblematiken.
Hält eine solche Problematik länger an oder fühlen sich Familien durch das Schlafverhalten ihres Kindes zunehmend erschöpft, sollten die Familien entwicklungspsychologisch betreut werden.
Eine akute Klinikaufnahme kann bei großer familiärer Belastung zur Krisenintervention notwendig sein, um Kindesmisshandlung, wie z.B. das Schütteltrauma (Shaken Baby Syndrome [SBS]) zu vermeiden.
Störung des Bewusstseins im Kindesalter
Um die Bewusstseinslage von Kindern richtig beurteilen zu können, müssen Alter und Entwicklungsstand berücksichtigt werden ( ▶ Tab. 10.3 ). Sichere Kenntnisse über normales, altersentsprechendes Verhalten sind eine zwingende Voraussetzung. Um die Ansprechbarkeit zu prüfen, müssen altersentsprechende Fragen gewählt werden.
|
Augenöffnen |
|||
|
> 1 Jahr |
< 1 Jahr |
||
|
4 |
spontan |
spontan |
|
|
3 |
auf Anruf |
auf Schreien |
|
|
2 |
auf Schmerz |
auf Schmerz |
|
|
1 |
fehlend |
fehlend |
|
|
Beste motorische Antwort |
|||
|
> 1 Jahr |
< 1 Jahr |
||
|
6 |
führt Befehle aus |
Spontanbewegungen |
|
|
5 |
gut orientierte Reaktion |
gut orientierte Reaktion |
|
|
4 |
zurückziehen auf Schmerz |
zurückziehen auf Schmerz |
|
|
3 |
Flexion auf Schmerz |
Flexion auf Schmerz |
|
|
2 |
Extension auf Schmerz |
Extension auf Schmerz |
|
|
1 |
fehlend |
fehlend |
|
|
Beste verbale Antwort |
|||
|
> 5 Jahren |
> 1 Jahr |
< 1 Jahr |
|
|
5 |
orientiert |
unverständliche Worte |
Plappern |
|
4 |
verwirrt |
unverständliche Worte |
Weinen, kann beruhigt werden |
|
3 |
unzusammenhängende Worte |
andauerndes Weinen, kann nicht beruhigt werden |
andauerndes Weinen, kann nicht beruhigt werden |
|
2 |
unverständlich |
stöhnen |
stöhnen |
|
1 |
fehlend |
fehlend |
fehlend |
|
Quelle nach: Vernet O et al. Betreuung des kindlichen Schädelhirntraumas. PAEDIATRICA 15 (4), 2004; S. 59 |
|||
10.3 Pflegemaßnahmen auswählen, durchführen und evaluieren
10.3.1 Aufgaben und Maßnahmen im Nachtdienst
Während sich im Tagdienst mehrere Pflegekräfte die anfallenden Aufgaben teilen, trägt im Nachtdienst meist eine Pflegekraft die Verantwortung für die Station (Bienstein u. Mayer 2014). Der Nachtdienst beginnt mit einer Übergabe der Kollegen vom Spätdienst. Diese dient der Informationsweitergabe und enthält alle relevanten Informationen. Neben der pflegerischen Betreuung der Patienten gehört es im Nachtdienst zu den Aufgaben der Pflegekraft, für eine ruhige, schlaffördernde Atmosphäre zu sorgen.
Insbesondere nachts können Patienten Unruhe und Ängste verspüren, sodass besonders die psychosoziale Begleitung (z.B. kurzes Gespräch) wichtig ist. Die Aufgaben im Nachtdienst können sich je nach pflegerischem Setting stark unterscheiden.
Allgemeine Aufgaben im Nachtdienst
-
Begrüßung beim ersten Durchgang: Bei Neuaufnahmen stellt sich die Pflegekraft dem Patienten kurz vor, erläutert den Ablauf der Nacht und erkundigt sich nach individuellen Bedürfnissen.
-
Patientenbeobachtung: Die Patientenbeobachtung findet während der Durchgänge oder in konkreten Pflegesituationen statt. Die Beobachtungen (z.B. der Gesamtschlafzeit und das Befinden nach dem Aufwachen) sind wichtige Informationen für den Frühdienst, um die Situation des Patienten am nächsten Tag besser einschätzen zu können.
-
Vorbereitung zur Nachtruhe: zur Durchführung schlaffördernder Interventionen siehe ( ▶ Tab. 10.4 )
-
Rundgänge: Die Häufigkeit der Rundgänge und die Notwendigkeit des persönlichen Kontakts ergeben sich aus der Pflegebedürftigkeit und dem Betreuungsbedarf der Patienten. Hausinterne Standards bzw. Dienstanweisungen bzgl. der Häufigkeit der Rundgänge sind zu beachten.
-
Dekubitusprophylaxe: Nach Möglichkeit Mikrolagerungen durchführen, um den Patienten nicht unnötig zu wecken (weitere Prophylaxen).
-
Verabreichen von Medikamenten: Vor der Gabe schlaffördernder Medikamente sollten andere Maßnahmen der Schlafförderung (Entspannungstechniken etc.) ausprobiert werden. Aufgrund des Abhängigkeitspotenzials mancher Schlafmedikamente sind diese nur zur kurzfristigen Einnahme gedacht.
-
Überwachung: Monitoring, Vitalzeichenkontrolle
-
Aufnahme und Organisation: Neuaufnahme von Patienten, Organisation von Verlegungen
-
Notfall: Management von Notfällen (in Absprache mit dem diensthabenden Arzt)
Aktuelle Situation
-
Laut einer Studie von Bienstein und Mayer (2014) muss eine Pflegekraft heute weniger Patienten im Nachtdienst versorgen als noch vor 25 Jahren. Dafür ist die Versorgung deutlich aufwendiger geworden. Der Nachtdienst geht oft mit einer hohen körperlichen und psychischen Belastung einher. Die Pflegekräfte haben Angst vor herausforderndem und unberechenbarem Verhalten alkoholisierter, psychisch kranker oder dementer Patienten (Gröger 2014).
Gesundheitsförderung im Nachtdienst Als mögliche Maßnahmen der persönlichen Gesundheitsförderung für Pflegekräfte im Nachtdienst empfehlen Bienstein (2014) und Sitzmann (2016) u.a.:
-
komplexe und konzentrationserfordernde Aufgaben sollten nicht in die „konzentrationsverringerte Zeit“ von 1:00–5:00 Uhr morgens fallen
-
Möglichkeiten der Unterstützung schaffen (z.B. durch Kollegen anderer Stationen)
-
angemessene und fördernde Arbeitsumgebung gestalten, z.B. Lichtverhältnisse
-
Meditation und Entspannungsübungen vor dem Nachtdienst
-
leichte Kost zwischen 19 und 20 Uhr, eine warme kleine Mahlzeit gegen Mitternacht, kleine Stärkung kurz vor Arbeitsende
10.3.2 Krankenbett und Bettzubehör
Häusliche Pflege im Fokus
Pflegebett
„Heute Morgen bin ich schon wieder nicht vom Bett hochgekommen und musste liegen bleiben und auf Sie warten. Dabei muss ich zur Toilette und könnte doch auch schon längst gewaschen sein.“ Seit einiger Zeit ist die Mobilität der 83-jährigen Frau Simon so stark eingeschränkt, dass sie nur mit viel Unterstützung einer Pflegenden von der Bettkante in den Stand gelangt. Gesundheits- und Krankenpflegerin Nicole sagt darauf: „Vielleicht wäre ein Pflegebett eine Lösung für Sie. Das ist in der Höhe verstellbar und Sie könnten wieder selbst ein- und aussteigen.“ Frau Simon fragt: „Das kann ich doch gar nicht bezahlen. Und muss ich dann mein Ehebett abgeben?“ Gesundheits- und Krankenpflegerin Nicole kennt ähnliche Einwände bereits. Doch sie weiß, dass es auch um ihre Gesundheit am Arbeitsplatz geht. „Ein Pflegebett kann Ihr Hausarzt verordnen, wie damals den Rollator. So könnten Sie wieder viel selbstständiger sein.“
Hilfsmittelversorgung
In der häuslichen Pflege gehört es zu den Aufgaben einer Pflegekraft und des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK), die Hilfsmittelsituation eines Patienten einzuschätzen, den individuellen Bedarf zu erkennen und über die verordnungsfähigen Hilfsmittel zu beraten. Pflegebedürftige haben laut §40 SGB XI den Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, „die zur Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der Beschwerden des Pflegebedürftigen beitragen oder ihm eine selbstständige Lebensführung ermöglichen“. Die Aufwendungen der Pflegekassen für den Verbrauch bestimmter Pflegehilfsmittel dürfen monatlich den Betrag von 40 Euro nicht übersteigen.
Neben den Hilfsmitteln können die Pflegekassen finanzielle Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes des Pflegebedürftigen gewähren (z.B. für Umbau der Wohnung oder technische Hilfsmittel im Haushalt). Die Zuschüsse dürfen einen Betrag von 4000 Euro je Maßnahme nicht überschreiten. Im aktuellen Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes sind insgesamt 33 unterschiedliche Gruppen an Hilfsmitteln aufgeführt, für die die Kranken- und Pflegekassen aufkommen. Folgende Hilfsmittel werden in der häuslichen Pflege oft verwendet:
-
Pflegebetten und Lagerungshilfen (z. B. Rollen oder Kissen)
-
Inkontinenz- und Stomaversorgung (z. B. Inkontinenzschutzhosen und Stomabeutel)
-
Ess-, Trink- und Haushaltshilfen (z. B. Besteck mit verstärkten Griffen)
-
Alltagshilfen (z. B. Notrufsender)
-
Fahrhilfen (Rollstühle)
-
Bad- und Toilettenhilfen (z. B. Duschsitz, Toilettensitzerhöhung)
-
Gehhilfen (z. B. Gehstöcke, Rollatoren)
Das Pflegebett ist für viele Patienten während eines Krankenhausaufenthaltes der Hauptaufenthaltsort. Auch wenn in den Patientenzimmern kleine Sitzecken integriert sind, so ist doch immer wieder zu beobachten, dass Patienten sich vorwiegend im Bett aufhalten. Bei bettlägerigen Patienten erfüllt dieser Raum sogar alle Räumlichkeiten einer Wohnung, d. h., es wird im Bett gegessen und getrunken, die Ausscheidungen werden hier verrichtet, es ist Wohnraum am Tag und Schlafstätte der Nacht.
Ein Pflegebett unterscheidet sich u a. von einem „normalen“ Bett dadurch, dass es fahrbar ist und viele Funktionen hat (z. B. kann eine Kopfhoch- oder -tieflage eingestellt werden und es ist höhenverstellbar). Ein Krankenbett ist und muss auf die Bedürfnisse der Patienten und der Pflegenden abgestimmt sein. Die Entwicklung der Technik von Krankenbetten hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung gemacht. Es gibt Betten mit einfacher manueller Bedienung oder Betten mit Hydraulik bis hin zur vollelektronischen Ausstattung ( ▶ Abb. 10.9).
Funktionen und Zubehörteile des Pflegebettes.
Abb. 10.9
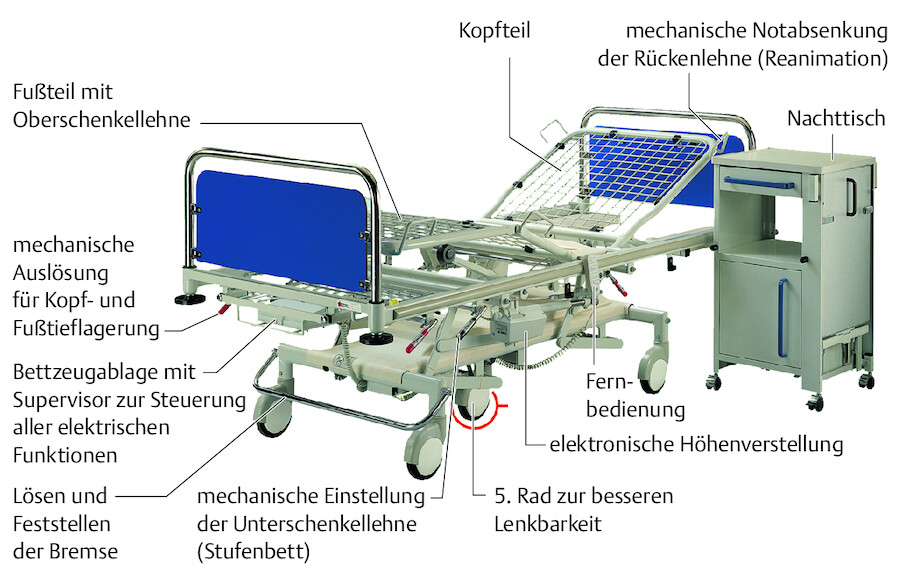
Die Auswahl eines Pflegebettes richtet sich nach dem Angebot der jeweiligen Klinik und dem Lebensalter (z. B. Säuglings-, Kinder-, Jugend- oder Erwachsenenbetten) und speziellen Umständen und Erkrankungen der Patienten (Spezialbetten bei Dekubitusgefahr, Betten zur Herzbettlagerung, Stufenbetten bei Bandscheibenvorfällen, Intensivpflegebetten etc.).
Praxistipp
Damit Sie auch in Akutsituationen schnell und sicher handeln können, informieren Sie sich genau, wie die hausüblichen Betten funktionieren.
Die Standardbetten müssen sich sowohl in Bezug auf Körpermaße (die Durchschnittsgröße von Menschen hat zugenommen) als auch an den physiologischen Beugemöglichkeiten des Körpers orientieren. Die meisten Pflegebetten haben jedoch eine Teilung von 1/3 und 2/3, d. h. die Abknickung des Oberkörpers erfolgt unphysiologisch und dies birgt Gefahren und Folgen in sich:
-
eingeschränkte Atmung (→ minderbelüftete Lungen → Erhöhung der Pneumoniegefahr)
-
eingeschränkter Nahrungstransport und gestörte Nahrungsaufnahme (→ Aspirationsgefahr)
-
erhöhte Scherkräfte und Herunterrutschen im Bett (→ Dekubitusgefahr)
-
unphysiologische Abknickung des Oberkörpers (→ Rückenschmerzen)
-
dauerhaft erhöhter Muskeltonus bei Patienten mit neurologischen Erkrankungen (→ Spastizitätserhöhung)
-
Einschränkung der Mobilität
Darüber hinaus müssten die modernen Betten auch bezüglich des zulässigen Gesamtgewichts verändert werden. Normale Pflegebetten sind für 120 kg zugelassen. Ein zunehmender Anteil der Bevölkerung wiegt jedoch mehr als 120 kg.
Bettzubehör (Hilfsmittel) Zu den Hilfsmitteln am Pflegebett zählen:
Patientenaufrichter (kritisch zu betrachten, auch unphysiologisch) mit z. B. Infusionshalter und Bettbügel, Bettseitenteil, Urinflaschenhalter, Bettverlängerungen, Bettdeckenheber, Gehstützenhalter, Extensionsgestänge, Bedienelement für die elektrische Steuerung des Bettes u. a.
Praxistipp
Da es eine Vielzahl von Zubehörteilen gibt, lassen Sie sich die sichere Montage zeigen und üben Sie diese im Einzelfall ein.
10.3.3 Beziehen des Bettes
Bei der Aufnahme eines Patienten erhält dieser ein gereinigtes und frisch bezogenes Bett, das in den meisten Kliniken von einer Bettenzentrale aufbereitet wird und angefordert werden kann. Sollte diese Dienstleistung nicht zur Verfügung stehen, liegt die Verantwortung für saubere Betten bei den Mitarbeitern der Station. Bei kontaminierten Betten (z. B. MRSA) ist eine Desinfektion der Betten nach den hausinternen Hygieneplänen erforderlich.
Patientenbetten werden meistens zu zweit gerichtet, dies spart unnötige Wege. Es wird im gleichen Rhythmus durchgeführt.
10.3.3.1 Vorbereitung
Saubere Wäsche, die auf einem Wäschewagen mitgeführt wird, sollte in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, um unnötige Wege zu vermeiden. Außerdem ist es günstig, sowohl ein Händedesinfektionsmittel und einige Pflegemittel mitzuführen, da sich einige Pflegemaßnahmen vorteilhaft während des Bettens mitdurchführen lassen, z. B. Einreibungen. Der Wäschewagen sollte auch einen Abwurf für die Schmutzwäsche enthalten. Es besteht meist die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Säcke einzuspannen, um die Wäsche sofort sortieren zu können. Die Säcke sind durch eine Farbkodierung gekennzeichnet. Die eingehängten Wäschesäcke werden mit einem Deckel zugedeckt.
Aus hygienischer Sicht sollte zum Bettenmachen über der Arbeitskleidung ▶ Schutzkleidung getragen werden, um eine Keimverschleppung zu vermeiden. Ebenso ist eine hygienische Händedesinfektion erforderlich. Der Wäscheabwurf steht am besten so am Bett platziert, dass die abgezogene Wäsche direkt in den richtigen Sack abgeworfen werden kann. Die saubere Wäsche sollte keinen Kontakt zur Schmutzwäsche haben, damit Kontaminationen vermieden werden. Günstiger sind aus hygienischer Sicht separate Wagen zum Schmutzwäscheabwurf.
Um das Bettzeug ablegen zu können, kann man ans Fußende des Bettes einen Stuhl stellen oder die am Bett integrierte Bettzeugablage aufklappen.
Merke
Keine Bettwäsche auf dem Fußboden zwischenlagern, beim Aufheben kontaminieren Sie Ihre Hände und Kleidung mit den Fußbodenkeimen!
Beziehen des Bettes ohne Patient
Zum Richten des Bettes wird das Bett auf eine entsprechende Arbeitshöhe gebracht (bei extremen Größenunterschieden von Pflegenden ist ein Mittelmaß zu wählen), dies dient der Entlastung des Rückens. Die Durchführung des Bettwäschewechsels ohne Patienten zeigt ▶ Abb. 10.10.
Die Fotoserie zeigt das Beziehen des Bettes ohne Patient.
Abb. 10.10
(Foto: W. Krüper, Thieme)

Beziehen eines Bettes mit einem bettlägerigen Patienten
Ist ein Patient bettlägerig, muss die Bettwäsche gewechselt werden, ohne dass er das Bett verlässt. Die oben beschriebenen Schritte und Regeln für die Vorbereitung und Durchführung gelten hier ebenso. Für einen möglichst schonenden Wäschewechsel bei einem schwerkranken Patienten sollten einige Aspekte beachtet werden:
-
Am Anfang stehen die Kontaktaufnahme und die Erläuterung der Maßnahme. Je besser der Patient aufgeklärt ist, desto effektiver kann er mithelfen und bekommt keine Angst. Bei bewusstlosen Patienten ▶ Initialberührung zur Kontaktaufnahme durchführen.
-
Lässt die Situation des Patienten es zu, wird das Kopfteil flach gestellt und das Kopfkissen entfernt. Dabei muss der Patient auf Atemnot oder Schmerzäußerungen beobachtet werden.
-
Der Bettlakenwechsel erfolgt je nach Gesundheitszustand, indem sich der Patient auf die Seite dreht oder eine „Brücke“ macht.
▶ Abb. 10.11 zeigt den Bettlakenwechsel mit im Bett liegendem Patienten.
Die Fotoserie zeigt, wie das Bett mit Patienten bezogen wird.
Abb. 10.11
(Foto: W. Krüper, Thieme)

Praxistipp
Die Flachlagerung wird von vielen Menschen als unangenehm und beängstigend empfunden. Erklären Sie den Patienten Schritt für Schritt, was Sie gerade tun, und beziehen Sie den Patienten nach Möglichkeit mit ein. So ist das Gefühl des Ausgeliefertseins nicht so groß.
Patient macht eine Brücke
Kann sich der Patient nicht auf die Seite drehen, so lässt sich analog von oben nach unten verfahren ( ▶ Abb. 10.12):
Aktiv mithelfen.
Abb. 10.12 Der Patient kann beim Bettwäschewechsel mithelfen, indem er eine „Brücke“ macht.
(Foto: W. Krüper, Thieme)

-
Der Patient wird mit dem Oberkörper aufgesetzt und die Laken zur Mitte des Bettes gerollt.
-
Beim Einspannen der sauberen Wäsche wird der Patient aufgefordert, das Gesäß anzuheben (dabei benötigt er evtl. Unterstützung).
-
Schmutzige und saubere Wäsche werden zum Fußende hin abgerollt. Das Stecklaken kann im Anschluss alternativ von einer Seite zur Mitte gerollt und unter dem Gesäß des Patienten durchgezogen werden.
-
Das saubere Bettlaken wird gut gespannt, das Stecklaken nach beiden Seiten gleichzeitig glatt gezogen und kontrolliert, dass der Patient nicht auf Falten liegt.
-
Das Kissen und die Bettdecke werden bezogen und der Patient bequem gelagert.
Merke
In vielen Krankenhäusern werden keine Stecklaken mehr benutzt: Zum einen spart es den Wäscheverbrauch, zum anderen mindert es die Dekubitusgefahr für den Patienten.
Lebensphase Kind
Kinderbetten im Krankenhaus
Kinderbetten im Krankenhaus sind, sofern es sich um gesunde Kinder auf der Wöchnerinnenstation handelt, gemäß den Empfehlungen für die
SIDS-Prävention (s.u.) zu gestalten.
In der Kinderklinik sind die Krankenbetten sowie die Gestaltung der Schlafumgebung den besonderen
Bedürfnissen eines kranken Kindes angepasst.
Zum Einsatz kommen:
-
Inkubatoren: Sie ermöglichen Frühgeborenen mit niedrigem Geburtsgewicht eine exakte Klimatisierung, Anwärmung, Befeuchtung und bei Bedarf auch eine Anreicherung der Umgebungsluft mit exakt dosiertem Sauerstoff. Außerdem bietet der Inkubator einen optimalen Infektionsschutz. Das Frühgeborene kann zur besseren Beobachtung und bei Bedarf zur Durchführung intensivpflegerischer Maßnahmen unbekleidet bleiben.
-
Wärmebetten: Diese kommen bei kranken Neugeborenen zum Einsatz. Die Wärmezufuhr erfolgt über eine Wärmematratze oder Bodenplatte und/oder einem Wärmestrahler. Durch abklappbare Seiten-, Kopf- und Fußteile ist das Kind von allen Seiten zugänglich, Funktionsleisten ermöglichen die Befestigung von medizinischem Material.
-
Gitterbetten: Sie sind in unterschiedlichen Größen, angepasst an die Körpergröße des Säuglings oder Kleinkindes, erhältlich. Das Sturzrisiko aus einem unverschlossenen Gitterbett ist hoch. Deshalb müssen Eltern, die an der Pflege und Versorgung ihres Kindes mitwirken, unbedingt über den korrekten Umgang mit dem Gitterbett informiert werden (Bettgitter verschließen bei Verlassen des Gitterbettes!). Dokumentieren Sie die Informationsweitergabe an die Eltern im Pflegebericht.
SIDS-Prävention
Ein Säugling sollte zur Prävention des plötzlichen Kindstodes (SIDS = Sudden Infant Death Syndrome) im ersten Lebensjahr
-
in Rückenlage,
-
rauchfrei,
-
bei angemessener Raumtemperatur (nicht zu warm, ideal sind 16°–18°C),
-
im Schlafsack,
-
ohne Nestchen,
-
idealerweise im Beistellbett neben dem Elternbett zum Schlafen gelegt werden.
10.3.4 Unterstützung bei Schlafstörungen
Langfristige Schlafstörungen haben Auswirkungen auf die Gesundheit der Patienten und bedürfen ärztlicher Abklärung. Gelegentliche Schlafstörungen kurzzeitiger Natur treten bei vielen Menschen auf. Sie sind von kurzer Dauer und bedürfen keiner speziellen Behandlung, da sie gewöhnlich von selbst verschwinden. Sie haben keine ernsthaften Auswirkungen auf die Gesundheit. Zur Behandlung von Schlafproblemen gibt es kein „Patentrezept“. Im Vordergrund stehen die Analyse der Schlafstörung (Schlafanamnese) und die Behebung der Ursachen ( ▶ Tab. 10.4 ).
|
Einflussfaktoren |
Pflegerische Maßnahmen |
|
Psychische Einflussfaktoren |
|
|
Ängste (vor OP, Diagnose, Zukunft u. a.) |
|
|
Heimweh, ungewohnte Umgebung |
|
|
Physische Einflussfaktoren |
|
|
Bewegungsmangel |
|
|
Schmerzen |
|
|
volle Blase, Nykturie |
|
|
Hunger, Durst, trockener Mund |
|
|
Umgebungsbedingte Einflussfaktoren |
|
|
Licht |
|
|
Gerüche |
|
|
Raumtemperatur: Wärme/Kälte |
|
|
Lärm (z. B. Flurlärm, Geräusche medizinischer Geräte, Schnarchen von Bettnachbarn) |
|
10.3.5 Pflegemaßnahmen zur Schlafförderung
Ziel ist es, einen alltagsadäquaten Umgang mit dem Schlaf zu finden. Viele Maßnahmen erzielen ähnliche Wirkungen. Allerdings sprechen nicht alle Menschen gleich gut darauf an. Es gilt, für sich herauszufinden, was guttut, und dies dann mit Ausdauer einzusetzen bzw. anzuwenden.
Die Pflegemaßnahmen sind in erster Linie prophylaktischer Natur. Sie dienen der Beratung, der Hilfe zur Selbsthilfe und der Information.
10.3.5.1 Warme Getränke und Kräutertees
Unter den verschiedenen Kräutern gibt es einige, denen eine beruhigende Wirkung zugeschrieben wird, z. B. Melisse, Hopfen, Baldrian, Weißdorn, Johanniskraut. Allein das Ritual, sich Zeit zu nehmen, um in Ruhe einen Tee zu trinken, fördert den Prozess des Ab- und Umschaltens.
Manche Menschen und Kinder bevorzugen es abends bzw. vor dem Schlafengehen, warme Milch zu trinken.
10.3.5.2 Duftlampen/ätherische Öle
Bei den ätherischen Ölen sind die Duftrichtungen mit beruhigender Wirkung ähnlich denen der Kräuter, z. B. Lavendel, Melisse.
10.3.5.3 Atemstimulierende Einreibung
Die schlaffördernde Wirkung der atemstimulierenden Einreibung (ASE) nach Christel Bienstein wurde in unterschiedlichen Studien untersucht:
-
Einschlafzeit verkürzt sich (Schürenberg 1993).
-
Einnahme von Beruhigungs- und Schlafmedikamenten kann reduziert werden (Nasterlack 2001).
-
Atmung wird verlangsamt und vertieft. Dies wirkt beruhigend und damit schlaffördernd (Kopke 2010).
-
Durch den Hautkontakt erfährt der Patient Zuwendung und ein Gefühl von Geborgenheit. Das gestiegene Wohlbefinden führt zum schnelleren Einschlafen (Nasterlack 2001, Conrad 2004).
-
Durch den Einsatz von Kräuterölen (z. B. Lavendel- oder Melissenöl) kann dies positiv unterstützt werden.
Zur genauen Beschreibung einer atemstimulierenden Einreibung siehe Kapitel zur ▶ atemstimulierendenden Einreibung.
10.3.5.4 Schlafförderung bei Menschen mit Demenz
Schlafstörungen sind im fortgeschrittenen Stadium einer Demenz weit verbreitet. Die Betroffenen legen sich oft bereits bei der ersten Dämmerung zu Bett und wachen dann mehrfach mitten in der Nacht auf, sind unruhig und häufig erregt. Das veränderte Schlaf-Wach-Muster und die Umkehr des Tag-Nacht-Rhythmus sind hierfür u.a. verantwortlich. Auch die Einschlafzeiten verlängern sich. Die Patienten liegen oft lange wach, bevor sie in den Schlaf finden. Ein hohes abendliches Aktivitätsniveau, das sog. „Sundown-Phänomen“, ist typisch für die Erkrankung.
Folgende pflegerische Grundsätze können bei Menschen mit Demenz schlaffördernd wirken:
-
Aktivitäten und Reize tagsüber anbieten
-
„Nickerchen“ am Tag minimieren
-
Maximierung der Assoziation zwischen Schlafzimmer, Schlafzeitpunkt und Schlaf, z.B. durch schlaffördernde Rituale, Anwendung musikalischer Reize, ruhige Umgebung, abgedunkeltes Zimmer (Morgan et al. 2010)
-
basale Stimulation, Snoezelen
10.3.5.5 Hydro- und Thermotherapie
Alle Wasseranwendungen bewirken eine Entlastung des Kopfes und des Nervensystems, indem das Blut vom Kopf in die Beine abgezogen wird. Anwendungen mit kaltem Wasser wirken belebend auf den Organismus, heiße dagegen entspannend.
Wärme bei motorischer Unruhe Wärmeanwendungen beruhigen bei motorischer Unruhe und helfen beim Einschlafen; dies kann durch den Zusatz von Badesalzen oder -ölen mit Extrakten von Heilkräutern (z. B. Baldrian, Hopfen, Heublumen, Lavendel) noch unterstützt werden. Ebenso unterstützend wirken warme ▶ Bauchwickel oder eine warme Brustauflage mit Lavendelöl.
Wärme bei kalten Füßen Bei kalten Füßen helfen ein warmes Fußbad oder auch Wechselbäder. Die Füße werden zuerst für etwa 3 – 5 Min. in 40 °C warmem Wasser gebadet und anschließend 1 Min. in kaltes Wasser getaucht. Dies regt die Durchblutung an.
Kälte bei hohem Blutdruck Leidet ein Patient an hohem Blutdruck, können der Blutkreislauf und das Druckgefühl im Kopf durch ein kaltes Fußbad entlastet werden. Dies darf allerdings nur bei warmen Füßen durchgeführt werden.
Merke
Es ist notwendig, alle Maßnahmen exakt zu dokumentieren. Nur so können die Wirkungen überprüft und bei ausbleibendem Erfolg alternative Maßnahmen geplant werden.
10.4 Gesundheitsförderung, Beratungsaspekte und Patienteninformation
10.4.1 Schlafrituale
Der Mensch schaltet seinen Organismus meist nicht spontan von Wachsein auf Schlafen um. Es erfolgt noch eine Phase der Ruhe und Entspannung, um von den Tagesereignissen abzuschalten. Eine wohltuende Abendgestaltung hilft dem Organismus, von Aktivität auf Passivität umzuschalten. Diese Umschaltphase wird nach einem immer wiederkehrenden Muster ritualisiert durchgeführt.
Schlafrituale können sehr vielfältig sein: ein Abendspaziergang, Lüften vor dem Zubettgehen, das Zähneputzen am Abend. Was für ein Kind die „Gutenachtgeschichte“, ein Schlaflied oder das Kuscheltier ist, ist für den Erwachsenen z. B. Fernsehen, Lesen oder Musikhören. Andere trinken vor dem Schlafengehen gerne eine heiße Milch, machen sich einen Kakao oder Kräutertee. Des Weiteren ist es möglich, über verschiedene ▶ Entspannungstechniken in den Schlaf zu finden. Gläubige Menschen sprechen abends ein Gebet oder lesen aus der Bibel.
Merke
Um Patienten bedürfnisorientiert zu pflegen, sollten sich Pflegende über die individuellen Schlafgewohnheiten oder Schlafrituale informieren.
10.4.2 Allgemeine Empfehlungen bei Schlafstörungen
Folgende allgemeinen Tipps können gegeben werden (einige sind bei Klinikaufenthalten schwierig bis gar nicht zu bewerkstelligen):
-
Stehen Sie wieder auf, wenn Sie eine halbe Stunde nach dem Zubettgehen nicht eingeschlafen sind. Machen Sie einen Spaziergang über den Flur oder lesen Sie ein Buch in der Leseecke.
-
Beschäftigen Sie sich, bis Sie sich wirklich müde fühlen. Seien Sie nicht deprimiert, sondern sehen Sie in einem missglückten Einschlafversuch die Chance, etwas anderes zu tun.
-
Spüren Sie Ermüdungserscheinungen, sollten Sie diese als physiologisches Zeichen des Körpers erkennen und als Aufruf zum Schlaf nutzen.
-
Versuchen Sie, Müdigkeit durch Lesen zu erreichen.
-
Regelmäßige Gewohnheiten, Wärme und Befriedigung der elementaren Bedürfnisse werden wesentlich dazu beitragen, dass Sie schneller einschlafen.
-
Ein vernünftiges Maß an körperlicher Bewegung (Abendspaziergang) wirkt sich auf den Schlaf und Ihr allgemeines Wohlbefinden günstig aus.
-
Lassen Sie koffeinhaltige Getränke (Kaffee, Tee, Cola) und auch Alkohol am Abend weg. Trinken Sie lieber Kräutertee (z. B. Melisse, Fenchel, Hopfen) oder eine Tasse warme Milch.
10.4.2.1 Bewegung
Viele Menschen verbringen den Tag ohne körperliche Aktivität, ob bei der Arbeit oder in der Freizeit. Körperliche Belastungen sind jedoch für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit unerlässlich, denn ohne sie tritt kein befriedigender Schlaf ein. Alles, was Alltag, Freizeit und Hobby zu körperlicher und sportlicher Tätigkeit bereithält, bietet sich hier als „Therapeutikum“ an. Angefangen beim abendlichen Spaziergang (der auch dem geistigen und psychischen Ausgleich dient) über Fahrradfahren, Schwimmen, Badmintonspielen, Ballsportarten oder Gymnastik.
10.4.2.2 Schlaf-Rhythmus-Training
Der Körper passt sich bei absoluter Regelmäßigkeit einem ▶ zirkadianen Rhythmus an („innere Uhr“). Der physiologische Schlafablauf kann trainiert werden, indem man einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus lebt und immer zur gleichen Zeit ins Bett geht und zur gleichen Zeit aufsteht. Diese Regelmäßigkeit muss anfangs z. T. gegen das eigentliche körperliche Bedürfnis durchgeführt werden, z. B. den Mittagsschlaf wegzulassen.
10.4.2.3 Entspannungstechniken
Eine Erkenntnis lautet: Einschlafstörungen sind Abschaltstörungen. Bei schlechten Schläfern lässt sich nachweisen, dass sie ein höheres Niveau physiologischer Aktivität und eine schlafstörende Anspannung aufweisen. Untersuchungen von Entspannungstechniken haben gezeigt, dass diese sich positiv auf das Schlafverhalten auswirken (Conrad 2004, Kopke 2010).
Entspannungstechniken können in Kursen erlernt werden, die z. B. von den Volkshochschulen angeboten werden. Informationen über derartige Kurse sind bei der Krankenkasse erhältlich. Als Anregung für die Beratung werden 4 Techniken kurz vorgestellt.
Autogenes Training nach Schulz Beim Autogenen Training, einer konzentrativen Selbstentspannungsübung, erfolgt durch ständiges Wiederholen gleicher Formeln eine Umschaltung des Organismus von aktiv auf passiv. Über die Autosuggestion werden die Tätigkeit des Sympathikus und die damit verbundenen Organtätigkeiten herabgesetzt und die des Parasympathikus aktiviert. Der Körper schaltet auf Ruhe um.
Fantasiereisen Bei Fantasiereisen wird eine Geschichte vorgelesen. Dieser hört man mit geschlossen Augen zu. Störende Gedanken und Umwelteinflüsse treten in den Hintergrund und werden ausgeblendet. Die Fantasiereise verfolgt nicht das Ziel, dass der Zuhörer direkt einschläft. Sie soll eher ein Umschalten der Gedanken und des Organismus auf Ruhe herbeiführen.
Yoga, Meditation Diese Formen der Entspannungstechnik können durch Atemübungen, spezielle Körperübungen und meditative Anteile neben der Entspannung auch eine Veränderung der Einstellung gegenüber Körper, Seele und Krankheitssymptomen bewirken.
Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson Bei der Progressiven Muskelrelaxation werden Muskelgruppen systematisch an- und entspannt. Dadurch erfährt der Körper insgesamt Entspannung.
10.4.3 Schlafförderung durch Medikamente
Die Einnahme von Schlafmitteln bei Schlafstörungen ist sehr weit verbreitet. Schlafmittel setzen jedoch lediglich am Symptom „Schlafstörung“ an und wirken nicht auf die Ursache (z. B. emotionale Belastungen, Angst). Der durch Hypnotika (Schlafmittel) erzwungene Schlaf ist ein anderer als der natürliche Schlaf. Die Abfolge der unterschiedlichen Schlafphasen wird verändert. Die meisten Schlafmittel unterdrücken die für die Erholung wichtige ▶ REM-Phase.
Nach einer gewissen Zeit erscheint dem Menschen das Hilfsmittel „Schlaftablette“ als unverzichtbar und notwendig, um in den Schlaf zu finden. Dies kann sich in einer körperlichen wie auch in einer emotionalen Abhängigkeit äußern.
Ein unkritisches, allgemeines Anbieten einer Schlafmedikation sollte im Krankenhaus der Vergangenheit angehören. Indikation und Auswahl des Medikaments sind eine ärztliche Aufgabe. Pflegende stellen i. d. R. die Medikamente bereit und kontrollieren deren Einnahme. Je stärker wirksam ein Präparat ist, desto intensiver muss der Patient beobachtet werden, um evtl. unerwünschte Wirkungen schnell erfassen zu können.
Merke
Für die Dosierung von Schlafmitteln gilt die Devise: „So wenig wie möglich!“
10.4.3.1 Pflanzliche Präparate
Schwach wirkende, pflanzliche Präparate können für einige Patienten eine Hilfe sein, besser ein- und durchzuschlafen. Eine abgestufte Auswahl an Präparaten sollte vorhanden sein und sich an den individuellen Bedürfnissen des Patienten orientieren. Gleiches gilt für die Dosis: Oft reichen bereits halbe Standarddosen aus, um eine ausreichende Wirkung zu erzielen.
10.4.3.2 H1-Antihistaminika
Die sog. H1-Antihistaminika haben ihre Bedeutung vornehmlich in der Selbstmedikation. Die ursprünglich als Nebenwirkung aufgetretene Müdigkeit wird somit zur eigentlichen Indikation dieser Präparate, die rezeptfrei und damit in Apotheken zur Selbstmedikation erhältlich sind.
10.4.3.3 Benzodiazepine
Bei den stark wirksamen Benzodiazepinen müssen Nebenwirkungen und Risiken bedacht und auch wahrgenommen werden, um eine sichere Anwendung zu ermöglichen.
Erholungswert Mit Benzodiazepinen wird der weniger tiefe Schlaf verlängert und der eigentliche Tiefschlaf verkürzt, was den Erholungswert des Schlafes reduziert.
Wirkdauer Viele Benzodiazepine (z. B. Valium) haben außerordentlich lange Halbwertszeiten (Wirkdauer). Ein Teil der Wirkung tritt in der Nacht ein, aber auch tagsüber sind noch eine Sedierung und Anxiolyse (Angstminderung) gegeben. Bei einigen Patienten kann das erwünscht sein, bei einer (Ein-)Schlafmedikation ist dies eine unerwünschte Wirkungsverlängerung („Hang-Over“, Überhangeffekt).
Muskulatur Eine stark muskelrelaxierende Wirkung erhöht die Gefahr von Stürzen beim morgendlichen Aufstehen älterer Patienten.
Kumulation Bei vielen Benzodiazepinen erfolgt bei regelmäßiger Einnahme eine Kumulation (Anhäufung) des Wirkstoffs ( ▶ Tab. 10.5 ). Bei längerem Gebrauch kann ein abruptes Absetzen zu schwierigen Entwöhnungsprozessen führen: Schlaflosigkeit, Angstzustände, Schwindel oder Verwirrtheit können verstärkt auftreten. Somit sollte bei einer längerfristigen Einnahme dieser Präparate eine Ausschleichphase mit kontinuierlicher Dosisreduktion erfolgen. Dies reduziert sowohl die psychische als auch die physische Gewöhnung an die Benzodiazepine. Sind die Ausscheidungsleistungen der Niere und der Leber im höheren Alter reduziert, tritt auch bei relativ niedrigen Dosierungen eine besonders starke Kumulation auf.
|
Freiname |
Präparate (Beispiele) |
Halbwertszeit, Wirkdauer |
|
Pflanzliche Sedativa |
||
|
Baldrianwurzel |
u. a. Baldrian Dispert |
|
|
Hopfenzapfen |
meist in Kombinationen u. a. Baldriparan, Sedacur |
|
|
Passionsblume |
meist in Kombinationen u. a. Moradorm S, Passin |
|
|
H1-Antihistaminika |
||
|
Diphenhydramin |
u. a. Dolestan, Halbmond |
5 – 6 Std. |
|
Doxylamin |
u. a. Gittalun, Hoggar N |
8 – 10 Std. |
|
Benzodiazepine |
||
|
Triazolam |
Halcion |
2 – 4 Std. + länger wirksame Metabolite |
|
Brotizolam |
Lendormin |
4 – 7 Std. |
|
Flurazepam |
u. a. Dalmadorm |
1 – 2 Std. + lang wirksame Metabolite |
|
Temazepam |
u. a. Planum, Remestan |
7 – 15 Std. |
|
Lormetazepam |
u. a. Noctamid |
10 – 14 Std. |
|
Flunitrazepam |
u. a. Rohypnol (BtM!) |
10 – 20 Std. + lang wirksame Metabolite |
|
Nitrazepam |
u. a. Mogadan |
20 – 30 Std. |
|
Oxazepam |
u. a. Praxiten |
6 – 15 Std. |
|
Benzodiazepin-Analoga/GABA-Rezeptor-Agonisten |
||
|
Zolpidem |
u. a. Bikalm, Stilnox |
2 – 3 Std. |
|
Zopiclon |
u. a. Ximovan |
4 – 5 Std. |
Nebenwirkungen Paradoxe Wirkungen mit euphorischen Erscheinungen anstelle der Sedierung sind insbesondere bei älteren Patienten möglich. Auch die atemdepressive Wirkung kann bei Patienten mit Lungenerkrankung oder Schlafapnoe eine unerwünschte Reaktion verursachen.
Benzodiazepin-Analoga/GABA-Rezeptor-Agonisten
Diese Wirkstoffe (Zolpidem, Zopiclon, s. ▶ Tab. 10.5 ) mit Benzodiazepin-ähnlicher Wirkung sind derzeit die meistverwendeten verschreibungspflichtigen Schlafmittel. Sie sind relativ gut verträglich, haben eine kurze Halbwertszeit und auch lang wirkende Metabolite (Stoffwechselprodukte) treten nicht auf. Aber auch diese Substanzen sind nur für die kurzfristige Anwendung geeignet. Ein langfristiger Gebrauch kann zur Abhängigkeit führen und nach dem Absetzen des Medikaments eine Entzugssymptomatik auslösen.
10.4.3.4 Wirkmechanismus von Schlafmitteln
Benzodiazepine Der Wirkort ist das zentrale Nervensystem, v. a. das limbische System und teilweise die Formatio reticularis. In diesen Hirnregionen besteht eine hohe Dichte an sog. Benzodiazepin-Rezeptoren, an denen diese Hypnotika spezifisch binden. Durch die Bindung wird der in den Nervenzellen lokalisierte Botenstoff GABA (Gammaaminobuttersäure) in seiner hemmenden Wirkung auf das ZNS verstärkt. Die Nervenzelle reagiert weniger empfindlich auf erregende Impulse und verarbeitet weniger Reize. Dadurch wirken diese Hypnotika anxiolytisch (angstlösend), beruhigend und entspannend. Aufgrund der direkten Rezeptorwirkung der Benzodiazepine wurde es möglich, einen Benzodiazepinrezeptor-Antagonisten zu entwickeln (Flumazenil, z.B. Anexate), der spezifisch und schnell die Wirkungen der Benzodiazepine aufheben kann. Dies ist insbesondere bei Überdosierungen oder erheblichen Nebenwirkungen indiziert ( ▶ Abb. 10.13).
Die Benzodiazepine wirken über die Hemmung des ZNS.
Abb. 10.13
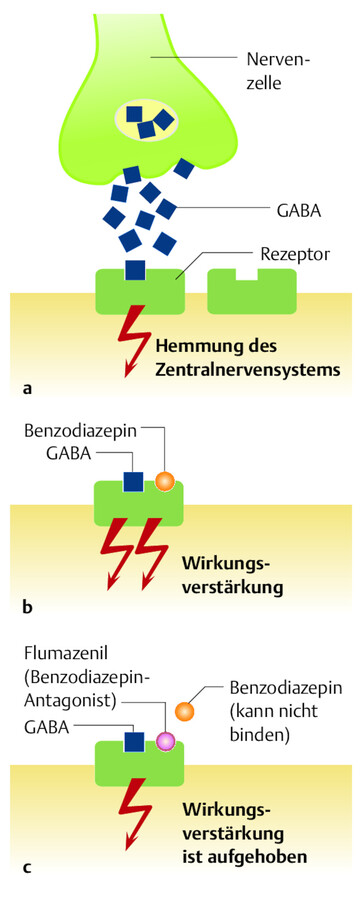
Benzodiazepin-Analoga/GABA-Rezeptor-Agonisten Die neueren Substanzen (z. B. Zopiclon, Zolpidem) wirken ebenso über den Benzodiazepin-Rezeptorkomplex, allerdings nicht an der gleichen Bindungsstelle. Die Bindung an den gleichen Rezeptor erklärt die sehr vergleichbare Wirkung dieser Substanzen. Die geringere Problematik von Toleranz- und Abhängigkeitsentwicklung könnte mit der unterschiedlichen, benachbarten Bindungsstelle in Zusammenhang stehen. Ein spezifischer Antagonist ist bislang nicht verfügbar.
Pflanzliche Präparate Der Wirkmechanismus ist im Wesentlichen unklar. Insbesondere beim Baldrian stellt sich die Frage nach den eigentlich wirksamen Substanzen. Bestimmte Wirkungen, die auch mit dem GABA-System zusammenhängen könnten, werden aus Untersuchungen abgeleitet. Klinische Prüfungen von pflanzlichen Hypnotika ergeben aufgrund des hohen Placeboeffekts bei der Indikation Schlafstörung keine einheitlichen und zweifelsfreien Ergebnisse.
10.5 Basale Stimulation
Basale Stimulation ist ein ganzheitlicher Pflegeansatz, der das Befinden und die Aktivitäten des Patienten in den Mittelpunkt stellt. Der Patient wird dabei als Akteur seiner eigenen Entwicklung gesehen. Das Konzept setzt darauf, dass es die eigenen Kompetenzen des Patienten sind, die ihn wieder gesund oder leistungsfähiger machen, und nicht die Medizin, Pflege, Pädagogik usw.
Entstehungsgeschichte Basale Stimulation entstand als pädagogisches Konzept zur Förderung schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher Mitte der 1970er-Jahre. Die Kinder waren als Dauerpflegefälle pädagogisch mehr oder weniger aufgegeben, therapeutische Angebote fanden fast nicht mehr statt und auch eine medizinische Behandlung im engeren Sinne bot sich nicht an. Deshalb wandten sich Pädagogen, Therapeuten und Kinderkrankenschwestern verstärkt dem Aspekt der körperlichen Anwesenheit dieser Kinder zu. Man entdeckte, dass jenseits von gesprochener Sprache und den üblichen Wegen Kontakt mit diesen Kindern aufgenommen werden konnte, wenn man sich auf die körperliche Kommunikation konzentrierte. Beispiele dafür sind:
-
Nachmodellieren des Körpers durch behutsame Berührung lässt körperliche und auch fremde Identität erfahren.
-
Innehalten des Betreuers während einer Tätigkeit ermöglicht dem Kind, sich auszudrücken und Zustimmung oder Ablehnung zu zeigen.
-
Wiederkehrende, anregende Aktivitäten ermöglichen Sicherheit, Freude und Eigenbewegungen.
Begriffsbestimmung Der Begriff „basal“ sollte ursprünglich deutlich machen, dass es sich um ganz einfache und grundlegende Formen der Anregung handelt. Der Begriff „Stimulation“ macht deutlich, dass es Anregungen im Sinne von Einladungen sind, ein Kommunikations- und Pflegeangebot anzunehmen, für die der Betroffene keine Voraussetzungen zu leisten braucht. Die sprachliche Wurzel von „stimulus = Reiz“ hat sich im Nachhinein als ungünstig herausgestellt. Es handelt sich in keinem Falle um eine „Bereizung“ von hilflosen Menschen.
Definition
Inzwischen verstehen wir unter basaler Stimulation ein umfassendes Konzept, das voraussetzungslos Angebote an kurzzeitig oder langfristig schwer kommunikations- und aktivitätsbeeinträchtigte Menschen macht.
Kern des Konzeptes Basale Stimulation will auch bei schwerst eingeschränkten Patienten nicht nur die vitalen Grundfunktionen sichern, sondern humane Begegnungen zwischen Pflegenden und Patienten gestalten. Diese Begegnungen werden strukturiert, die Pflegenden lernen, unnötige Irritationen und Störungen zu vermeiden und Sicherheit zu geben. Die Förderung eines Grundvertrauens durch individuell angepasste Rituale, Wiederholungen und persönliche Pflegeangebote gehört zum Kern der Basalen Stimulation.
Aufgabe der Pflegenden Pflegende sollen die Ressourcen der Patienten erkennen und sie darin unterstützen,
-
mit anderen Menschen zu kommunizieren,
-
die Umgebung und v. a. sich selbst wahrzunehmen,
-
sich in Bewegung zu erleben und auszudrücken.
10.5.1 Grundannahmen des Konzepts
Zu den grundlegenden Annahmen des Konzepts gehören:
-
Ganzheitlichkeit des Menschen
-
pflegerisches Selbstverständnis
-
körperliche Existenz und Kommunikation
-
Gefährdung des Patienten durch Habituation (Gewöhnung an eine gleichbleibende Wahrnehmungssituation)
10.5.1.1 Grundannahme Ganzheitlichkeit des Menschen
Auch wenn sich während einer Krankheit Funktionsausfälle oder unklare Störungen in den Vordergrund schieben, bleibt der Mensch dennoch eine Ganzheit. Begriffe wie „die Galle von Zimmer 7“, „der Schlaganfall“, „das Koma hinten“ sind Anzeichen dafür, dass diese Ganzheit im Krankenhausalltag oft nicht mehr gesehen wird. Der Patient als Mensch findet sich in diesen Aussagen nicht wieder: „Ich bin doch viel mehr als nur eine Galle!“
Entwicklungsbereiche
Der Mensch lässt sich nur in der Theorie in seine einzelnen Funktionen zerlegen, in der Realität bleibt er eine Ganzheit aus sich wechselseitig beeinflussenden, bestärkenden und ergänzenden Wirkgrößen (Entwicklungsbereichen). Ein isoliertes Erleben in einem Bereich ist nicht möglich, die anderen Bereiche sind immer mitbeteiligt. ▶ Abb. 10.14 zeigt die Entwicklungsbereiche und ihre Vernetzung.
Entwicklungsbereiche.
Abb. 10.14 Die wichtigsten menschlichen Entwicklungsbereiche stehen immer miteinander in Beziehung.
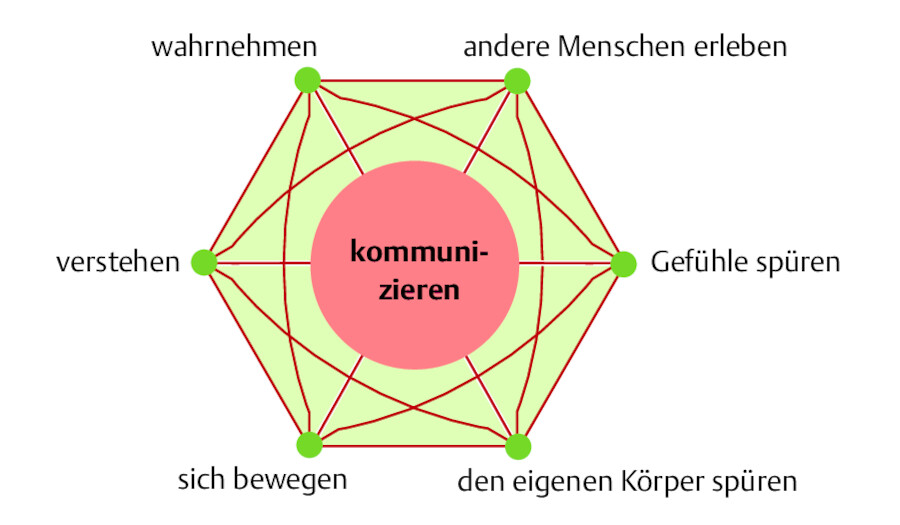
Beispiel „Kontaktaufnahme“ Stellen Sie sich vor, Sie würden einem in seiner Bewegung eingeschränkten Patienten nach verbaler Ankündigung die Decke wegnehmen, um ihn beim Einnehmen einer anderen Position zu unterstützen. Er wird wahrnehmen, dass sich etwas in seiner Umwelt verändert, dass Sie neben seinem Bett stehen und etwas tun. Er sieht Sie, er hört Sie, er riecht und spürt. Je nach Ihrem Verhalten und seinem momentanen Befinden wird er sich respektiert oder hilflos oder auch ganz anders fühlen. Er wird sich vielleicht an frühere Situationen erinnern, vielleicht vergleichen, wie es zu Hause im eigenen Bett war. Das Wegziehen der Decke wird auch eine emotionale Erwartungshaltung in ihm auslösen: z. B. „mir wird kalt“, „die ist nett“ oder „jetzt geht es endlich los“. Der Patient wird aufgrund Ihrer Aktivität vielleicht selbst aktiv werden und sich ansatzweise bewegen, mithelfen oder sich wehren. Er macht dabei verschiedene Körpererfahrungen.
Bei dieser Pflegemaßnahme steht die Kommunikation zwischen Pflegeperson und Patient im Zentrum. Es könnte aber auch z. B. die Bewegungsunfähigkeit oder die Wahrnehmung des Patienten im Mittelpunkt stehen (s. ▶ Abb. 10.14).
Praxistipp
Sie können bei jeder Ihrer pflegerischen Aktivitäten variieren und unterschiedliche Aspekte betonen ( ▶ Abb. 10.15, Übung 1). Wenn Sie die Decke mit eindeutigen, nachmodellierenden Bewegungen über den Körper des Patienten wegstreifen, so betonen Sie die Körpererfahrung. Wenn Sie die Hand des Patienten führen und Sie ihn die Decke greifen lassen und mit ihm gemeinsam die Decke wegziehen, so betonen Sie die Bewegung und Sozialerfahrung.
Selbsterfahrung.
Abb. 10.15

Rangfolge Es gibt keine eindeutige Rangfolge der Entwicklungsbereiche. Je nach Situation steht mal die Körpererfahrung, mal die Bewegung oder die Sozialerfahrung im Vordergrund. Aus diesem Grund müssen die Bereiche auch in der Pflege gleichmäßig Beachtung finden.
Ganzheitlichkeit der Pflegenden
Auch die Pflegenden wirken ihrerseits ganzheitlich auf den Patienten. Das bedeutet, dass eine einfache Pflegemaßnahme, die vielleicht nur aus einer losen Folge von Berührungen besteht (z. B. das Messen des Blutdrucks), immer auch die Körpererfahrung und die Sozialerfahrung des Patienten mit beeinflusst. Pflegende heben Teilbereiche des Körpers (z. B. den Oberarm während des Blutdruckmessens) manchmal so in den Vordergrund, dass die anderen scheinbar verschwinden. Es ist ein wichtiges Ziel der basalen Stimulation, diese isolierende Sichtweise aufzulösen und eine ganzheitlichere Wahrnehmung zu erreichen.
Chance für die Pflege
Die Ganzheitlichkeit des Menschen stellt eine Ressource dar, die die Pflege nutzen sollte. Selbst Menschen, die im Koma liegen und anscheinend nicht zur Kontaktaufnahme fähig sind, nehmen wahr, erleben soziale Kontakte, fühlen und erinnern sich und versuchen, sich zu strukturieren. Sie passen sich Veränderungen an, sie reagieren innerhalb ihrer Möglichkeiten und sind sogar in der Lage zu lernen. Lernen und Entwicklung geschehen in diesem Sinne innerhalb einer ganzheitlichen Kommunikation. Siehe dazu Übung 2 ( ▶ Abb. 10.15).
Aufgabe der Pflege ist es, diese Entwicklungen zu unterstützen und Bedingungen zu schaffen, unter denen der einzelne Mensch seine Möglichkeiten leichter und unbehinderter entfalten kann.
Beispiel „Spastik“ Eine Spastik wird häufig auf ein Defizit der Bewegungsfähigkeit reduziert. Sie kann aber auch Ausdruck eines Lernprozesses sein. Wenn der eigene Körper nach schwerer Krankheit nicht bewegt werden kann und sich dadurch verschwommen und fremd anfühlt, so kann durch einen erhöhten Muskeltonus (Anspannen der Muskeln) ein erstes Spüren erreicht werden. Dies führt kurzfristig zur eindeutigen Wahrnehmung und zum Gefühl der Sicherheit im eigenen Körper. Langfristig führt eine Spastik aber zu ▶ Schmerzen und Kontrakturen.
Die Pflegenden sollten das Potenzial des Sich-spüren-Wollens erkennen und fördern, z. B.
-
kann der Arm durch rhythmische, atemsynchrone Bewegungen als Teil des ganzen Körpers gespürt werden,
-
kann der Arm durch eindeutige Berührungen differenzierter als durch Spastik erlebt werden, kann die Umwelt durch Materialerfahrungen (Decke, Matratze, Nachttisch) erkundet werden.
Der Patient braucht seine bis dahin für ihn sinnvolle Spastik nicht mehr, weil er sich anders wieder erspüren kann. Die Spastik wurde nicht „behoben“ und „korrigiert“, vielmehr wurden dem Menschen neue Möglichkeiten eröffnet, zu lernen und sich zu entwickeln. Der bis dahin spastische Arm wird zum Ausgangspunkt einer neuartigen Kommunikation, die ein Wahrnehmen in allen Entwicklungsbereichen (s. ▶ Abb. 10.14) ermöglicht.
10.5.1.2 Grundannahme pflegerisches Selbstverständnis
Basale Stimulation beruht auf einem Pflegeverständnis, das den Menschen mit seiner individuellen Entwicklung ins Zentrum stellt. Unterstützen und Begleiten sind Hauptaufgaben der Pflege und nicht Gesundmachen, Korrigieren und Belehren. Impulse des Patienten werden aufgenommen und weiterverfolgt. Standardisierte routinemäßige Abfolgen werden möglichst vermieden und den Bedürfnissen des Patienten angepasst. Beispiele dafür sind:
-
Ein Patient wird später geweckt, weil er die Nacht zuvor schlecht geschlafen hat.
-
Die Ganzkörperwaschung wird abgebrochen, weil der Patient überfordert wirkt.
-
Das Eincremen wird wiederholt, weil der Patient es zu genießen scheint.
Krankheiten werden als eine Form der Entwicklung angesehen. Pflege unterstützt den Menschen in seiner Entwicklung und zeigt damit eine Nähe zu pädagogischem und therapeutischem Arbeiten.
10.5.1.3 Grundannahme körperliche Existenz und Kommunikation
Alle Äußerungen des Menschen sind letztlich körperlicher Art, sei es Sprache oder Schrift, Atmung oder Mimik. Der Körper ist das Bezugssystem, über das Menschen in Beziehung miteinander treten. Erst beim Kontakt mit einem anderen Menschen wird den körperlichen Äußerungen Bedeutung zugeschrieben. Der andere Mensch rekonstruiert die Bedeutung und gibt ihnen Sinn. Basale Stimulation geht davon aus, dass
-
der Körper immer in der Lage ist, sich zu äußern (z. B. durch die Atmung, die Beschaffenheit der Haut, die Muskelspannung),
-
der Körper immer ansprechbar ist für Berührungen, Temperaturunterschiede, Lageveränderungen usw. Siehe dazu Übung 3 ( ▶ Abb. 10.15).
Chance für die Pflege
Pflege hat wie keine andere Berufsgruppe Zugang zum Körper des Menschen und steht damit in unmittelbarem Kontakt zu Menschen in schwierigsten Entwicklungsphasen. Pflege sollte die Kommunikationsfähigkeit des Körpers nutzen und sich auf die basale Ebene des Körperlichen einlassen ( ▶ Abb. 10.16).
Basale Ebene.
Abb. 10.16 Die Kommunikation über die basale Ebene kann bei Menschen in schwierigen Entwicklungsphasen unterstützend wirken.
(Foto: A. Fischer, Thieme)

Die basale Kommunikationsfähigkeit (Berührung und Nähe, Distanz und Abwehr, Wärme und Kühle, Sicherheit und Irritation, Aufforderung und Beruhigung) bleibt erstaunlich lange erhalten und kann in der Pflege nicht nur genutzt, sondern auch kultiviert werden. Siehe dazu Übung 4 ( ▶ Abb. 10.15).
Beispiel „Bei der Positionsveränderung unterstützen“ Der Patient wird an der Schulter berührt, um seine Aufmerksamkeit zu wecken. Ein Zeichen seiner Aufmerksamkeit wird abgewartet (z. B. Augenbewegungen hinter geschlossenen Augenlidern). Dann erfolgt eine weitere, klare Berührung am Kopf, gefolgt von angedeuteten Bewegungen, um den Patienten auf eine Lageveränderung vorzubereiten. Wieder wird abgewartet, ob die Berührungen verstanden worden sind:
-
Zeigt die Atmung eine Zustimmung?
-
Verändert sich der Muskeltonus in den Lippen oder an den Schultern?
-
Sind kleinste Bewegungen erkennbar?
Dann wird der ganze Körper mit der Decke abgestrichen (nachmodelliert). Der Patient reagiert evtl. mit komplexen Bewegungen, gähnt oder streckt sich. Nun wird der Patient durch kleine, rhythmische Bewegungen, die sich an seiner Atmung orientieren, bewegt. Die kleinen Bewegungen deuten die Richtung der kommenden, großen Bewegung an. Dadurch wird der Patient zum Mitmachen ermuntert, weil die gesamte Aktivität für ihn nachvollziehbar wird. Die Bewegung nimmt allmählich zu, der ganze Körper wird bewegt.
So dient eine Positionsveränderung nicht nur der Druckentlastung, sondern auch der Kontaktaufnahme und Kommunikation.
10.5.1.4 Gefährdung des Patienten durch Habituation
Patienten, die in ihrem Bewusstsein und in ihrer Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt sind, sind besonders gefährdet, im Pflegeprozess fremdbestimmt und abhängig zu werden. Sie werden häufig als „nicht mehr kommunikativ“, „nicht orientiert“ oder „nicht ansprechbar“ bezeichnet. Sie werden nur noch mit schematischen Sprachformeln angesprochen, Reaktionen auf der Sprachebene werden nicht beachtet und die Kommunikation mit ihnen wird häufig drastisch eingeschränkt.
Es kommt sogar vor, dass in Anwesenheit dieser Patienten über sie gesprochen wird, so als ob sie am „System“ Sprache keinen Anteil mehr hätten. Aus unterschiedlichen Untersuchungen (Salomon 1994, Hannich 1994) geht aber hervor, dass auch scheinbar tief bewusstlose Menschen Sprache verstehen und sich ihrer erinnern können. Sie können anhand der Stimme sogar Personen voneinander unterscheiden.
Grundlagen der Wahrnehmung
Spezifische Informationsfolgen aus der Umwelt werden durch unsere Sinnesorgane so umformuliert, dass sie für unser Zentralnervensystem verarbeitbar werden. Aus diesen Informationen bilden (konstruieren) wir eine innere Wirklichkeit, die für uns die Abbildung der äußeren Wirklichkeit ist.
Der Prozess der Wahrnehmung ist uns i. d. R. nicht bewusst und läuft ständig ab. Auch unseren eigenen Körper nehmen wir selbst wahr (propriozeptive Wahrnehmung). Diese Selbstwahrnehmung ist bei schwer beeinträchtigten Patienten durch die sog. Habituation gestört.
Habituation
Definition
Habituation ist die Gewöhnung an eine gleichbleibende Wahrnehmungssituation. Habituation bedeutet, dass Informationen aus einer Umwelt, die ständig gleich bleibt, nicht mehr wahrgenommen werden. Was sich nicht mehr ändert, erscheint nicht mehr informativ und wird ausgeblendet. Manchmal treten dann selbst erzeugte Wahrnehmungen (Halluzinationen vergleichbar) an die Stelle der Informationen.
Veränderung der Wahrnehmung Unsere Selbstwahrnehmung ist an die aktive Bewegungsfähigkeit des Körpers und seiner Sinnesorgane gebunden. Nur durch aktives Herumschauen können wir sehen. Ein unbewegtes Starren auf einen Punkt führt dazu, dass alsbald die Seheindrücke verschwimmen. Das Gehirn versucht aber weiterhin, aus den Informationen eine Wirklichkeit zu rekonstruieren: Flecken werden zu Spinnen an der Decke, Lampen scheinen zu schwingen und lose Kabel mutieren zu Rattenschwänzen.
Propriozeptive Habituation Ein Mensch, der krankheitsbedingt lange in einer Position verharren muss, ohne seine Lage selbst verändern zu können, gerät sehr schnell in eine propriozeptive Habituation: Er spürt seinen eigenen Körper nicht mehr. Siehe dazu Übung 5 ( ▶ Abb. 10.15). Ganze Körperteile gehen „verloren“, Grenzen verschwimmen, die körperliche Identität wird bedroht. In diesem Sinne kann eine ▶ Spastik aus der Sicht des Patienten sinnvoll sein, um sich selbst zu spüren.
Innerer Rückzug Eine andere Bewältigungsstrategie ist der innere Rückzug. Die Patienten wirken teilnahmslos und apathisch. Andere entwickeln sog. Stereotypien, z. B. rhythmisches Klopfen oder Kopfbewegungen, um sich selbst mit den nötigen Informationen zu versorgen. Wieder andere verletzen sich sogar selbst, sie kratzen oder beißen sich, um sich selbst zu spüren. Aus der Sicht des Betroffenen kann das sinnvoll sein.
Beispiel „Autoaggression“ Ein junger Mann hatte einen Drogenunfall, wurde reanimiert und lag 4 Wochen auf der Intensivstation. Er war wach, ansprechbar, aber nahezu unbeweglich, alle Extremitäten spastisch. Nachdem er verlegt wurde, kam er kurzfristig auf die Intensivstation zurück, weil er Autoaggressionen entwickelt hatte: Er biss sich ganze Stücke aus seiner Unterlippe heraus. Scheinbar realisierte er seine Situation, sein „Nichts-mehr-tun-Können“. Er konnte nicht weglaufen, nicht mit seiner Freundin telefonieren, sich nicht mal betrinken. Er musste es einfach aushalten. Kann es da nicht sinnvoll sein, sich ganze Stücke aus den Lippen rauszubeißen, weil dies leichter zu ertragen ist als die Vorstellung, den Rest des Lebens in einem Pflegeheim zu verbringen? Diese Handlung scheint für uns kaum nachvollziehbar zu sein, doch die Bewältigungsstrategien jedes Menschen stellen sich anders dar. Siehe dazu Übung 6 ( ▶ Abb. 10.15).
Interaktion zwischen Patienten und Pflegenden
Die Interaktion zwischen Patienten und Pflegenden kann dadurch massiv gestört sein, dass beide in einer unterschiedlichen Wirklichkeit leben. Für den Patienten stellt sich die ungewohnte und häufig auch bedrohliche Umgebung im Krankenhaus anders dar als für die Pflegenden, die hier ihrer täglichen Arbeit nachgehen.
Beispiel Wahrnehmungsstörung Die bedrohlichen Spinnen, die ein Patient an der Decke kriechen sieht, existieren in den Augen des Pflegenden nicht. Als Folge seiner visuellen Habituation (fehlende Sehanregung durch starren Blick an die weiße Decke) sieht der Patient kleine schwarze Punkte, die sich über die Decke bewegen. Sie werden von ihm als Spinnen interpretiert, vor denen er sich fürchtet und die er beseitigt haben möchte. Es reicht nicht aus, wenn die Pflegenden ihn dann verbal beruhigen und beschwichtigen.
Sie müssen ja nicht glauben, dass da wirklich etwas an der Decke ist, aber glauben Sie dem Patienten, dass er da etwas wahrnimmt. Vertrauen Sie jemandem, der Ihnen immerzu sagt „stimmt nicht“ oder „alles nicht so schlimm“?
Pflegende müssen dafür sorgen, dass die visuelle Habituation nicht weiter fortschreitet, z. B. durch Lageveränderung und veränderte Blickrichtung.
10.5.2 Zentrale Lebensthemen
Im Folgenden werden die zentralen Lebensthemen der basalen Stimulation erläutert, wobei die Reihenfolge einen gewissen Aufbau berücksichtigt, der eine allgemeine Orientierung geben kann. Eine rein schematische Anwendung würde gegen das Prinzip der Individualisierung verstoßen.
-
Leben erhalten und Entwicklung erfahren.
-
Das eigene Leben spüren.
-
Sicherheit erleben und Vertrauen aufbauen.
-
Den eigenen Rhythmus entwickeln.
-
Die Außenwelt erfahren.
-
Beziehung aufnehmen und Begegnung gestalten.
-
Sinn und Bedeutung geben.
-
Das eigene Leben gestalten.
-
Autonom leben und Verantwortung übernehmen.
-
Die Welt entdecken und sich entwickeln.
10.5.2.1 Leben erhalten und Entwicklung erfahren
Erste Aufgabe von Pflege ist es zu helfen, das Leben eines Patienten zu erhalten. Pflege unterstützt ihn, die medizinischen Maßnahmen zu akzeptieren. Sie begleitet und unterstützt ihn. Zu den Grundfunktionen des Lebens gehören atmen, sich ernähren, sich. Siehe dazu Übung 7 ( ▶ Abb. 10.15). Pflegende unterstützen Patienten darin, selbstständig zu atmen, wieder selbstständig Nahrung zu sich zu nehmen und dadurch ein Stück Autonomie wiederzugewinnen. Sie fördern Eigenbewegungen des Patienten und damit seine Wahrnehmungsfähigkeit und Lebendigkeit.
Was kann ich tun, um den Patienten in seiner Entwicklung zu begleiten?
-
Helfen Sie dem Patienten, seinen Atem wiederzufinden, z. B. durch eine ▶ atemstimulierende Einreibung oder atemsynchrone Bewegungen.
-
Fördern Sie den Appetit des Patienten durch den Gebrauch seiner Lieblingsspeisen und akzeptieren Sie auch, wenn der Patient vor lauter Sorge nicht essen mag.
-
Unterstützen Sie die Eigenbewegungen des Patienten. Helfen Sie ihm, sich selbst und seine Umwelt zu begreifen oder auch wieder erste Schritte zu gehen.
-
Nutzen Sie seine früheren Gewohnheiten!
Fallbeispiel
Eine Patientin nach Schlaganfall schien die Hoffnung aufgegeben zu haben, je wieder laufen zu können, obwohl sie auf der mehr betroffenen Seite bereits wieder etwas spüren und sich auch ansatzweise bewegen konnte. Ich fragte sie, was sie früher gerne gemacht habe, und sie zählte einige Aktivitäten auf, darunter auch Tanzen. Ich bat sie daraufhin um einen Tanz. Sie willigte erstaunt ein und war bereit, sich auf die Bettkante mobilisieren zu lassen. Im Stehen nahm ich sie in einer klassischen Tanzhaltung in den Arm, stützte leicht das schwache Knie und begann, sie in einem Walzerrhythmus hin und her zu bewegen. Sie folgte dem Takt und schließlich konnten wir erste, kleine Tanzschritte durch das Zimmer machen. Als wir das halbe Zimmer durchquert hatten, bedankte ich mich und ging – nicht tanzte – mit ihr im Arm zurück.
10.5.2.2 Das eigene Leben spüren
Ein Patient sollte das eigene Leben in irgendeiner Form wahrnehmen: sich selbst spüren, seinen Körper wahrnehmen und sich im Kontrast zur unbelebten, unmittelbaren Umwelt erleben. „Ich bin ein Individuum, bin für mich, stehe in Kontakt zu anderen und zu Dingen, bleibe aber dennoch eine Einheit.“
Was kann ich tun, damit der Patient sich selbst wieder spüren kann?
-
Helfen Sie ihm, eine geeignete Position im Bett oder im Stuhl zu finden.
-
Fördern Sie seine körperliche Wahrnehmung durch Berührungen und Waschungen, die den Körper nachformen.
-
Lassen Sie ihn selbst Kleidung auswählen und gestalten Sie das An- und Ausziehen der Kleidung als Erlebnis.
Fallbeispiel
Ein junger, bettlägeriger Mann mit Hirnhautentzündung war sehr unruhig. Er atmete sehr schnell, öffnete gelegentlich die Augen, sah durch einen hindurch und schien stark zu fantasieren. Auf Ansprache reagierte er nicht. Ich berührte ihn an seiner Hand, drückte diese fest und wartete ab, ob er aufmerksam werden würde. Seine Reaktion war nicht eindeutig, aber als ich seinen Körper mit festen Berührungen von oben nach unten nachmodellierte, veränderte sich sein Blick. Anschließend ließ ich die Luft aus seiner Wechseldruckluftmatratze und deckte ihn mit einer großen Röntgenschürze zu, der Thorax blieb dabei frei. Er schien nach innen zu lauschen und beruhigte sich, die Atmung wurde langsamer und regelmäßig. Nach ca. 1 Stunde begann er wieder unruhig zu werden. Ich stellte den vorherigen Zustand wieder her und er beruhigte sich erneut. So entwickelte sich ein Wechselspiel: Sobald er Unruhe entwickelte, veränderte ich die Situation. Im weiteren Verlauf atmete er insgesamt immer ruhiger.
10.5.2.3 Sicherheit erleben und Vertrauen aufbauen
Sicher fühlen kann man sich nur, wenn bestimmte erkennbare, voneinander unterscheidbare Ereignisse immer wieder auftreten und man ahnen kann, dass sie auch in Zukunft auftreten werden. Sicherheit erlebt ein Patient, wenn z. B. sein Stöhnen oder ein Schweißausbruch dazu führen, dass eine Pflegeperson sich um ihn kümmert. Erst wenn sich ein Patient sicher fühlt und den Pflegenden vertraut, kann so etwas wie Kooperation entstehen.
Wie muss ich mich verhalten, damit der Patient sich sicher fühlt?
Wenn ein Patient sein Umfeld nicht selbst beobachten und kontrollieren kann, so kann es vertrauensbildend wirken, wenn er immer gleich begrüßt wird. Dies kann z. B. ein Klopfen an der Tür, ein Ansprechen oder eine Berührung sein. Der Patient sollte mit Namen angesprochen werden und an einer bestimmten, deutlich wahrnehmbaren Stelle berührt werden.
Beispiel „Initialberührung“ Vor einer pflegerischen Maßnahme wird der Patient zunächst verbal angesprochen. Dann erfolgt eine ruhige, eindeutige Berührung am Körper im Bereich des oberen Rumpfes, jedoch nicht oberhalb vom Sternum. Die Berührung wird eher stützend und tragend unterhalb der Schulter angeboten ( ▶ Abb. 10.17). Diese Berührung dauert einen Moment und geht dann in eine gleitende Berührung der Hand über, die sich von der Stelle der Initialberührung aus zu der Körperpartie hin bewegt, wo etwas getan werden muss. Arbeiten Sie währenddessen im Aufmerksamkeitsbereich des Patienten, machen Sie sich wahrnehmbar, sodass der Patient nicht erschrickt, wenn Sie ihn plötzlich berühren. Geben Sie dem Patienten seinerseits das Gefühl, wahrgenommen zu werden:
Initialberührung.
Abb. 10.17 Die Hand der Pflegenden berührt, begrüßt, leitet jede Pflegemaßnahme ein und beendet diese.
(Foto: A. Fischer, Thieme)

-
Brechen Sie eine Bewegung ab, wenn es dem Patienten wehtut, und machen Sie es dann anders.
-
Wiederholen Sie eine Berührung, wenn diese dem Patienten angenehm ist.
-
Lassen Sie sich vom Patienten leiten, wenn es wichtig ist.
Die Initialberührung kann auch zur Verabschiedung eingesetzt werden. Wieder verweilt die Hand ruhig an der Schulter, erhöht noch einmal kurz den Druck, um sich dann zu entfernen. Initialberührungen können natürlich in Absprache mit dem Patienten auch an einer anderen Körperpartie stattfinden. Daraus kann sich ein Ritual entwickeln, das die Pflegemaßnahmen für den Patienten vorhersehbar und berechenbar macht.
Fallbeispiel
Ein verwirrter, bettlägeriger Patient hat sich wiederholt seine Magensonde gezogen. Ich habe die Aufgabe, ihm eine neue Sonde zu legen. Nach der verbalen Information, die ihm nicht von Bedeutung scheint, richte ich sein Kopfteil auf und erkläre es ihm noch einmal: „Herr Müller, ich muss Ihnen eine neue Magensonde legen. Die führe ich gleich in Ihre Nase ein.“ Es folgt eine Berührung an der Nase. „Dann geht dieser dünne Schlauch durch die Speiseröhre bis in den Magen. Darüber kriegen Sie später Suppen und Getränke.“ Wieder erfolgt eine Berührung, diesmal am Bauch. Herr Müller wirkt jetzt aufmerksam. Nach einer erneuten Berührung der Nase, schiebe ich die Sonde um einige Zentimeter vor. Herr Müller kräuselt die Stirn und scheint zurückzuweichen. Ich ziehe die Sonde ein Stück zurück und erkläre: „Es tut mir leid, dass es Ihnen so unangenehm ist.“ Kurze Pause, Herr Müller atmet ein und aus. „Es wird gleich einfacher, wenn Sie schlucken … Können wir ?“ Er nickt. Ich schiebe die Sonde weiter, passiere unter seinem Schlucken den Rachen. Dann würgt er und hebt die Hand. Ich warte ab, bis er sich beruhigt. Seine Hand schiebt sich weiter hoch und ich biete ihm an, diese Hand auf meinen Arm zu legen, um mich ggf. zu unterbrechen. Nun schieben wir gemeinsam die Sonde bis in den Magen. Herr Müller hatte Vertrauen, selbst in seiner Verwirrtheit, denn ihm wurde zugehört.
10.5.2.4 Den eigenen Rhythmus entwickeln
Patienten sollten auch in der fremden Umgebung des Krankenhauses einen eigenen Rhythmus von Wachen, Ruhen und Schlafen entwickeln dürfen: Phasen der Aktivität und Phasen des Nachdenkens wechseln sich ab. Auch die Verarbeitung der Krankheit verläuft nicht geradlinig, sondern eher rhythmisch. Manche Patienten brauchen lange, um sich mit ihrer neuen Situation zu beschäftigen, andere leben mit einer bemerkenswerten Heiterkeit (s. ▶ Abb. 10.15, Übung 8).
Wie kann ich den Patienten darin unterstützen, seinen eigenen Rhythmus zu finden?
Beobachten Sie den Patienten genau und koordinieren Sie Ihre Aktivitäten mit den Phasen des Patienten, in denen er aufnahmebereit ist. Eine Förderung ist sinnlos, wenn der Patient übermüdet ist. Es kann z. B. sinnvoll sein, nur eine Teilwaschung anzubieten. Fragen Sie den Patienten oder seine Angehörigen, was für einen Aktivitäts- und Ruherhythmus er bisher hatte, und versuchen Sie daran anzuknüpfen. Akzeptieren Sie in Phasen der Krankheitsverarbeitung, dass der ansonsten motivierte Patient für eine gewisse Zeit gar nichts will.
Fallbeispiel
Nach einem Schlaganfall brauchte Herr Petri Unterstützung bei der Morgentoilette. Er war relativ wach, motorisch allerdings noch sehr eingeschränkt. Sobald seine Aufmerksamkeit nachließ, legte ich eine Pause ein. So zog sich die Waschung, einschließlich Rasieren und Mundpflege, über 3 Stunden hin. In den Pausen habe ich anderes machen können und immer, wenn er wieder wach wurde, habe ich mich wieder um Herrn Petri gekümmert. Irgendwann fragte der Patient genervt, wie lange das noch dauern würde. Ich war sehr erstaunt, denn mein Arbeitsrhythmus bestand in einem kontinuierlichen Vor-mich-hin-Arbeiten mit kurzen Pausen. Sein Rhythmus bestand offensichtlich darin, erst „etwas zu erledigen“, um dann eine lange Pause zu machen. Ich habe ihm meinen Rhythmus aufgezwängt.
10.5.2.5 Außenwelt erfahren
Es geht nicht um „Bereizung“ oder ein hektisches Zeigen von allem, was um den Patienten herum ist. Vielmehr sollen sinnvolle Beziehungen zu den einzelnen Objekten aufgebaut werden. Der Nachttisch kann nur dann als bedeutungsvoll erlebt werden, wenn der Patient immer wieder erfährt, dass er ihm nützlich ist (s. ▶ Abb. 10.15, Übung 9).
Wie kann ich den Patienten darin unterstützen, seine Umwelt zu erfahren?
-
Lassen Sie den Patienten seine Matratze ertasten, damit er spürt, wie viel Platz er hat, um sich auf die Seite drehen zu können.
-
Zeigen Sie ihm seinen Nachtschrank.
-
Bewegen Sie das Bett, damit er einen anderen Blickwinkel für das Zimmer bekommt.
-
Lassen Sie den Patienten vor einer Positionsveränderung seine Umwelt wahrnehmen.
-
Führen Sie die Hände oder auch Füße des Patienten nacheinander über die Matratze bis zu deren Rand, um dem Patienten eine räumliche Vorstellung zu geben. Nutzen Sie alle sich bietenden Gelegenheiten, mit dem Patienten seinen derzeitigen Orientierungsraum zu erkunden. Es gibt viele Dinge wie Türen, Wasserhähne und Schubladen, die vom Patienten bewegt und in ihrer Bedeutung verstanden werden können.
10.5.2.6 Beziehung aufnehmen und Begegnung gestalten
Schwer beeinträchtigte Menschen können sich ihre Bezugspersonen nicht selbst aussuchen. Daher ist es wichtig, sie zu beobachten und herauszufinden, wie sie Beziehungen aufnehmen. Ein Stöhnen kann ein solches Signal sein, ein leichtes Bewegen der Hand oder der Versuch, den Kopf zu wenden (s. ▶ Abb. 10.15, Übung 10).
Fallbeispiel
Ein junger Mann mit Hirnhautentzündung und Tetraspastik (Spastik aller vier Gliedmaßen) schien sehr aufmerksam seine Freundin zu betrachten. Diese war während seines mehrwöchigen Aufenthaltes sehr engagiert und wir versuchten, die intensive Beziehung, die zwischen beiden scheinbar bestand, zu unterstützen. Wir boten der jungen Frau an, sich zu dem Patienten ins Bett zu legen und ihn in den Arm zu nehmen. Kurze Zeit später war es für uns sehr erstaunlich zu sehen, wie sehr der Patient in der Lage war zu entspannen. Er konnte in ihren Armen plötzlich seine Arme strecken und sie auch umarmen.
Prävention und Gesundheitsförderung
Angehörige wollen mit ihrem erkrankten Familienmitglied möglichst „normal“ weiter zusammenleben können. Das wird nicht immer möglich sein. Das vorherige Beispiel zeigt, dass es aber sehr sinnvoll sein kann, die Angehörigen in die basal stimulierende Pflege einzubeziehen, sie anzuleiten und zu beraten. Sie können dadurch ihre eigene Situation besser verarbeiten und neue Wege zu Kommunikation und Beratung entwickeln. Bewusstseinsveränderte Patienten können das wahrnehmen und oftmals aktiver werden, wenn sie sich von einer bekannten und vertrauten Person umgeben fühlen. Angehörige können über Initialberührung, Berührung, ASE, Massagen bis hin zur angeleiteten basal stimulierenden Ganzkörperwaschung schrittweise tätig werden. Angehörige entwickeln hier oft ein sehr kreatives Potenzial, sie fühlen sich sicherer in der schwierigen neuen Situation.
10.5.2.7 Sinn und Bedeutung geben
Krankheit verändert das Leben möglicherweise radikal: Der eigene Körper hat sich verändert, die Lebenssituation ist ungewohnt, es fehlen Orientierungen. Bisherige Werte gelten nicht mehr, neue Werte sind noch nicht gefunden. Durch Sicherheit und Vertrauen kann ein Mensch neue Deutungen seines Lebens vornehmen. Auch das Abschiednehmen vom Leben kann vielleicht als sinnvoll erlebt werden.
10.5.2.8 Das eigene Leben gestalten
Pflege sollte Patienten dabei unterstützen, ihre persönliche Umwelt aktiv mitzugestalten, z. B. das Bett oder den Nachttisch. Wer in einer Welt leben muss, die nur von anderen arrangiert wird, kann diese Welt nicht als seine Welt akzeptieren.
Welche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung kann ich dem Patienten anbieten?
-
Zeigen und erklären Sie dem Patienten, welche Möglichkeiten er hat zu gestalten, z. B. eine Pinnwand oder Magnettafel.
-
Wecken Sie seine Aufmerksamkeit, z. B. indem Sie ihm Bilder zeigen.
-
Nachtbekleidung kann von zu Hause mitgebracht und je nach Stimmung gewechselt werden.
Womöglich gibt es neben Fotos noch andere Objekte, die der Patient gerne ansieht und um sich haben möchte. Wohin schaut der Patient häufig, was scheint von Bedeutung zu sein? Folgt er mit den Augen, wenn ich diesen Gegenstand bewege?
Fallbeispiel
Ich betreute einen Patienten mit Hirninfarkt und Aphasie, dessen Hände in ständiger Bewegung waren. So bat ich seine Ehefrau darum, einige Gegenstände von zu Hause mitzubringen, mit denen der Patient sich gerne beschäftigt hatte. Wir mobilisierten den Patienten auf die Bettkante und dort begann er, die auf dem Tisch liegenden Objekte zu betrachten. Er griff von sich aus ein Foto heraus, das ihn mit seiner Frau im Arm vor ihrem Haus zeigte. Er betrachtete dieses Bild kurz und begann dann zu weinen. Scheinbar hat ihm das Bild deutlich gemacht, in was für einer Lage er sich befindet. Wir brachen ab, unterstützten ihn bei der Positionsveränderung in eine umgrenzende Position und brachten ein Laken als Baldachin an seinem Bett an, um seinen Rückzug zu unterstützen. Am nächsten Morgen blickte er interessiert umher und dies konnte als eindeutiges Zeichen gesehen werden, dass er wieder Umweltkontakt suchte.
10.5.2.9 Autonom leben und Verantwortung übernehmen
Wir sind der Überzeugung, dass jeder Mensch immer die Möglichkeit hat, in einer gewissen Weise autonom zu leben und verantwortlich für andere zu sein. Pflege kann im idealen Fall Menschen darin unterstützen, autonom und verantwortungsvoll zu leben und zu sterben. Ziel ist es, dass der Patient in der Enge der sozialen Beziehung dennoch autonom ist und andererseits in seiner Autonomie nie allein ist (s. ▶ Abb. 10.15, Übung 11).
10.5.2.10 Die Welt entdecken und sich entwickeln
Dieses Lebensthema wurde vor allem für die Arbeit mit Kindern formuliert, es kann aber auch für ältere und alte Menschen Bedeutung haben. Immer geht es in unserem Leben darum, sich nach außen zu orientieren, seinen eigenen Platz in der jeweiligen Welt zu finden. Ob dies die Welt der Familie ist oder für eine bestimmte Zeit die Welt des Krankenhauses, einer Rehabilitationsklinik oder einer Pflegeeinrichtung: Diese Welt muss entdeckt werden. Mit dieser Entdeckung ist die eigene Entwicklung verbunden, denn es stellen sich Aufgaben der Um- oder Neuorientierung, der Anpassung oder der Gestaltung. Menschen leben nicht auf einer „Insel“, sondern in Relationen und menschlichen Beziehungen. Und manchmal wollen sie Abschied nehmen.
10.5.3 Atemstimulierende Einreibung
Die atemstimulierende Einreibung ist ein wichtiger Bestandteil der basalen Stimulation und kann leicht in den pflegerischen Alltag integriert werden. Nachfolgend wird die Durchführung kurz beschrieben:
Bei der atemstimulierenden Einreibung (ASE) handelt es sich um eine rhythmische, mit unterschiedlichem Händedruck arbeitende Einreibung zur Förderung der Atmung im Rücken- oder vereinzelt auch Brustbereich. Durch sich angleichende, beruhigende oder anregende Atemrhythmen entsteht zwischen Patient und Pflegekraft ein kommunikativer Prozess, der sehr viel Bewusstheit, Entspannung und Sicherheit vermitteln kann. Je nachdem, wie viel Druck ausgeübt wird und wie sich die spiralförmigen (s. u.) Bewegungen während der ASE verändern, kann die ASE begleitend oder auch fördernd angeboten werden.
Ursprünglich war die ASE so gestaltet, dass die Pflegenden den Atemrhythmus vorgaben und mit einem sanften Druck im Sinne eines Angebotes arbeiten. In den letzten Jahren hat sich dieses Vorgehen teilweise verändert. Mitunter kann es sinnvoller sein, auch im unphysiologischen Atemrhythmus des Patienten zu beginnen, um noch deutlicher ein Angebot im Sinne des Beziehungsaufbaus zu machen. Weiter können wir u. U. mit einem recht deutlichen Druck arbeiten, wenn wir die Patienten zu einer Veränderung anregen möchten. Wenn wir die zentralen Ziele berücksichtigen, so können zur ASE noch weitere Variationsmöglichkeiten entwickelt werden: Vertiefung der Atmung zur Sicherheit, das spürbare Erleben des eigenen Atems, das suffiziente Atmen, das der Erhaltung des eigenen Lebens dient usw.
Ziel Die ASE soll die eigene Atmung des Patienten sowie seine Körperselbstwahrnehmung fördern: Er soll sich mit einem anderen Menschen wohl und in Übereinstimmung fühlen. Der Patient spürt und erlebt, dass er frei und ausreichend atmen kann, sich über seine Atmung ausdrücken kann und darüber auch wahrgenommen wird.
Indikationen Einsatzmöglichkeiten der ASE sind u. a.:
-
Ermöglichen eines Beziehungsaufbaus
-
psychische Stabilisierung
-
Stressminderung
-
Atemunterstützung
-
Weaning (Entwöhnung vom Beatmungsgerät)
-
prä- und postoperative Vor- und Nachsorge
-
Beruhigung
-
Orientierung
-
Entwicklung eines Tag-Nacht-Rhythmus
-
Einschlafförderung
Kontraindikationen Die ASE ist nicht indiziert bei Rippenserienbrüchen oder nur eingeschränkt indiziert nach Operationen am Thorax.
Voraussetzung der Pflegenden Dazu zählen:
-
Kenntnis des Vorgehens
-
Konzentrationsfähigkeit
-
warme Hände
-
keine Ringe an den Händen
-
möglichst keine Handschuhe
Positionierung Mögliche Positionen sind: sitzend, 90°/135°> Gradlage, Bauchlage (Rückenlage, d. h. ASE auf der Brust nur in Ausnahmefällen).
Beginn Zunächst wird nach einer Kontaktaufnahme an den Schultern ( ▶ Abb. 10.18 a) der Rücken des Patienten mit einer W/O-Lotion mit ruhigen und systematischen Berührungen nachmodelliert. Nach einem kurzen Erspüren des Atemrhythmus des Patienten beginnt die ASE mit der Ausatmung ( ▶ Abb. 10.18 b).
Atemstimulierende Einreibung.
Abb. 10.18 a Nach einer Kontaktaufnahme an den Schultern wird der Rücken des Patienten mit einer W/O-Lotion mit ruhigen und systematischen Berührungen nachmodelliert, b nach einem kurzen Erspüren des Atemrhythmus des Patienten beginnt die ASE mit der Ausatmung, c Bewegungsrichtung der Hände beim Ausatmen (rot) und beim Einatmen (blau).
(Foto: P. Blåfield, Thieme)

Spiralförmige Bewegungen Während der Ausatmung gleiten die Hände rechts und links neben der Wirbelsäule 10 – 15 cm nach unten, dann werden die Finger nach außen gedreht und die Hände gleiten entlang der Rippen nach außen. Während dieser Bewegung wird ein leichter Druck mit Zeigefinger, Daumen und Daumenballen nach innen zur Unterstützung der Ausatmung ausgeübt. Während der Einatmung gleiten die Hände nach oben und drehen sich zurück zur Wirbelsäule. Dabei wird ein leichterer Druck mit der Handkante Richtung Kopf ausgeübt, der Thorax also bei der Einatmung unterstützt.
Diese spiralförmige Bewegung wird so lange wiederholt, bis die Hände am unteren Rippenrand angelangt sind (je nach Größe des Rückens, bzw. der Hände 5 – 8-mal), danach werden die Hände nacheinander nach oben auf die Schultern gelegt und die ASE fortgeführt ( ▶ Abb. 10.18 c). Hierbei ist es wichtig, nicht erneut auf die Atmung des Patienten zu warten, sondern im Rhythmus bleibend fortzufahren.
Wenn eine Übereinstimmung der Patientenatmung und der Händebewegung erreicht wird, kann die Atmung je nach Indikation dazu angeregt werden, in Frequenz, Verhältnis und Tiefe verändert zu werden. Wie lange die gesamte ASE dauert, richtet sich nach der Indikation und umfasst i. d. R. 3 – 8 Minuten.
Abschluss Der Rücken des Patienten wird wie zu Beginn nachmodelliert, um einen klaren Rahmen spürbar zu machen. Das weitere Vorgehen richtet sich nach der Befindlichkeit des Patienten und der Indikation der ASE. Wenn die ASE z. B. zum Einschlafen angeboten wird, so kann der Patient nach der ASE in einer schlafbegünstigenden Position unterstützt, das Licht reduziert und ihm „Gute Nacht“ gewünscht werden. Eine ASE zur Orientierung kann in einem anderen Gesamtzusammenhang verstanden werden, vorher wurde der Patient beim Aufsetzen unterstützt und hinterher folgen andere, ebenfalls orientierende Angebote wie Ansprache, Umwelterkundung oder eine Aufgabenstellung: „Warten Sie auf mich, ich komme in 2 Minuten wieder“.
Prävention und Gesundheitsförderung
Interventionsschritte der Pflege
Christoph S. Nies
Das Zusammenspiel von Wachsein und Schlafen bildet den Lebensrhythmus eines Menschen, der für einen ausgeglichenen physischen und psychischen Zustand eine wichtige Rolle spielt. Insbesondere der Schlaf trägt mit seiner regenerativen Wirkung wesentlich zum psychischen Wohlbefinden wie auch zum Sammeln neuer körperlicher Kräfte bei. Diese Regeneration und das entstehende Wohlbefinden sind für einen gesunden wie auch einen erkrankten oder pflegebedürftigen Menschen der wesentliche Aspekt, um sich den Anforderungen des Lebens in angemessener Weise stellen zu können. Der erholsame Schlaf hat damit einen eigenständig gesundheitsförderlichen Charakter, den es vonseiten einer gesundheitsförderlich bzw. präventiv ausgerichteten Pflege zu unterstützen und zu erhalten gilt. Ein auf den individuellen Biorhythmus eines Menschen abgestimmter Schlaf-Wach-Rhythmus ist damit Ziel der gesundheitsförderlichen Interventionen in der ATL „Wach sein und schlafen“.
Veränderte Lebensumstände wie ein Krankenhausaufenthalt oder eine Umsiedelung in ein Pflegeheim können zu Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus führen. In Folge kann es zu starken Beeinträchtigungen des Wohlbefindens und der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit kommen, was für einen Genesungsprozess sehr hinderlich sein kann. Risikofaktoren oder erste Anzeichen für Störungen im Schlaf-Wach-Rhythmus auszumachen und daraufhin geeignete Interventionen einzuleiten ist, nicht zuletzt aufgrund des intensiven Kontaktes zum Pflegeempfänger, die originäre Aufgabe einer präventiv ausgerichteten Pflege innerhalb der vorliegenden ATL. Dies geschieht auf den verschiedenen Ebenen der Prävention.
▶ Tab. 10.6 zeigt beispielhaft mögliche Interventionen der pflegerischen Gesundheitsförderung und Prävention bezüglich der ATL „Wach sein und schlafen“. Die tabellarische Aufteilung erfolgt in Orientierung an den Interventionsschritten ▶ Gesundheitsförderung, Primärprävention, Sekundärprävention und Tertiärprävention.
|
Gesundheitsförderung |
Primärprävention |
Sekundärprävention |
Tertiärprävention |
|
Interventionen |
|||
|
|
|
|
|
Interventionszeitpunkt |
|||
|
im Gesundheitszustand – kein Selbstpflegedefizit im Bereich Wachsein und schlafen vorhanden |
erkennbare Risikofaktoren – Gefahr der Entstehung eines Selbstpflegedefizit im Bereich Wachsein und Schlafen |
beginnende pathologische Veränderungen, die mit einem Selbstpflegedefizit im Bereich Wachsein und schlafen einhergehen, sind vorhanden |
ausgeprägte pathologische Veränderungen, die mit einem Selbstpflegedefizit im Bereich Wachsein und schlafen einhergehen, sind vorhanden |
|
Zielgruppe |
|||
|
|
|
|
|
Interventionsorientierung |
|||
|
salutogenetische Ausrichtung (Förderung) |
pathogenetische Ausrichtung (Vorbeugung) |
pathogenetische Ausrichtung (Korrektur) |
pathogenetische Ausrichtung (Kompensation) |
|
Zielsetzung |
|||
|
Beeinflussung von Verhältnissen und Lebensweisen – Förderung eines gesunden Schlaf-Wach-Rhythmus und eines qualitativ hochwertigen Schlafes |
Beeinflussung des Ernährungsverhaltens – Vermeidung von Risikofaktoren die Störungen im Bereich des Wachseins und Schlafens auslösen können |
Frühbehandlung des Defizites im Bereich des Wachseins und Schlafens |
bestehendes Selbstpflegedefizit im Bereich des Wachseins und Schlafens ausgleichen – Folgeerkrankungen vorbeugen |
10.6 Lern- und Leseservice
10.6.1 Literatur
[607] American Academy of Sleep Medicine (AASM). International classification of sleep disorders (ICSD-3). Illinois; 2015
[608] Birbaumer N, Schmidt RF. Biologische Psychologie. Berlin: Springer Verlag; 2010
[609] Bienstein Ch, Mayer H. Nachts im Krankenhaus. Die Schwester/Der Pfleger 2014; 5/14: 428–433
[610] Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Rahmenempfehlungen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Menschen mit Demenz in der stationären Altenhilfe. Berlin: Forschungsbericht aus der Gesundheitsforschung; 2007
[611] Cai D, Mednick SA, Harrison EM, Kanady JC. REM, not incubation, improves creativity by priming associative networks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2009; 16: 10130–10134
[612] Conrad J. Atemstimmulierende Einreibung fördert Entspannung udn subjektives Wohlbefinden. Die Schwester/Der Pfleger 2004; 43(2): 104–107
[613] Deutsch J, Schnekenburger FG. Pädiatrie und Kinderchirurgie für Pflegeberufe. Stuttgart: Thieme; 2009
[614] Deutscher Bundestag. Sozialgesetzbuch (SGB). Elftes Buch (XI). Inkrafttreten: 1.1.2015. Letzte Änderung: 21.12.2015. Berlin: 2015
[615] Ettinger U, Petrovsky N, Hill A. Sleep Deprivation Disrupts Prepulse Inhibition and Induces Psychosis-Like Symptoms in Healthy Humans. The Journal of Neuroscience 2014; 34: 9134–9140
[616] Faust V, Hole G, Baumhauer H. Der gestörte Schlaf und seine Behandlung. 2. Aufl. Ulm: Universitätsverlag; 1992
[617] Finzen A. Medikamentenbehandlung bei psychischen Störungen. 12. Aufl. Bonn: Psychiatrie Verlag; 1998
[618] Gröger AC. Eine Nachtschicht als Pfleger: vor 25 Jahren und heute. Ärzte Zeitung; 09.12.2014
[619] Herz M. Zu viel um die Ohren. Auswirkungen von Lärm. Physiopraxis – Das Fachmagazin für Physiotherapie. Stuttgart: Thieme; 2015; 13(09): 60–61
[620] Hoehl M, Kullick P. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. 4. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2012
[621] Jacobs GD. Schlafen Sie besser! Das Sechs-Wochen-Programm gegen Schlafstörungen – entwickelt an der Harvard Medical School. Bern: Hans Huber; 2013
[622] Knutson KL, Spiegel K, Penev P, et al. The metabolic consequences of sleep deprivation. Sleep Medicine Reviews 2007; 11(3): 159–162
[623] Kopke K. Die Atemstimmulierende Einreibung (ASE) – Eine pflegerische Interventionsstudie zur Schmerzreduktion bei mehrfach erkrankten älteren Menschen. Dissertation an der medizinischen Fakultät der Charité – Universität Berlin. Berlin: 2010
[624] Kunz D. Melatonin und Schlaf-Wach-Regulation. Habilitationsschrift zur Erlangung der Lehrbefähigung für das Fach Psychiatrie. Berlin: Universität Berlin; 2006
[625] Lauber A, Schmalstieg P. Wahrnehmen und Beobachten. Aus: Verstehen & Pflegen Bd. 2; 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2007
[626] Leitmann T, Maschke C, Wolf. Epidemiologische Untersuchungen zum Einfluss von Lärm auf das Immunsystem und die Entstehung von Arteriosklerose. Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorensicherheit 2003; 01(03): Berlin: Umweltbundesamt; RKI
[627] Mayer G, Kotterba S. Parasomnien im Erwachsenenalter. Deutsches Ärzteblatt 2004; 34/35: 2323–2329.
[628] Mayer G, Rodenbeck A, Geisler P, Schulz H. Internationale Klassifikation der Schlafstörungen: Übersicht über die Änderungen in der ICSD-3. Somnologie. Berlin: Springer Verlag; 2015; 19: 116–125
[629] Morgan K, Kloss J. Schlaf – Schlafstörungen – Schlafförderung: Ein forschungsgestütztes Praxishandbuch für Pflegende. Bern: Verlag Hans Huber; 2000
[630] Nasterlack B. Pflegeinterventionen bei Schlafstörungen. Die Wirkung der Atemstimmulierenden Einreibung spricht für sich. Pflegezeitschrift 2001: 54(9): 254–259
[631] Robert Koch-Institut (RKI). Schlafstörungen. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 27. Berlin: RKI; 2005
[632] Robert Koch-Institut (RKI). Häufigkeit und Verteilung von Schlafproblemen und Insomnien in der deutschen Erwachsenenbevölkerung. Ergebnisse einer Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1). Bundesgesundheitsblatt; Berlin: RKI; 2013; 56: 740–748.
[633] Schuh-Hofer S, Schäfer-Voß S, Treede RD. Schlaf und Schmerz. Aktuelle Neurologie. Stuttgart: Thieme; 2016; 43(04): 249–255
[634] Schürenberg A. Die Atemstimmulierende Einreibung als einschlafförderndes Mittel. Pflege 1993; 6(2): 135–143
[635] Sonn A, Bühring U. Heilpflanzen in der Pflege. Bern: Hans Huber; 2004
[636] Sonn A. Wickel und Auflagen. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2004
[637] Spiegelhalder K, Backhaus J, Riemann D. Schlafstörungen. Fortschritte der Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe; 2011
[638] Sitzmann F. Jetlag – Schichtarbeiter-Syndrom des Menschen und seiner Bakterien. Hogrefe Pflegekalender Pflege 2016; 9/2015
[639] Spork P. Das Schlafbuch. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt; 2007
[640] Stickgold R, Jamens L, Hobson JA. Visual discrimination learning requieres sleep after training. National Neurosci 2000; 3: 1237–1238
[641] Sturm A, Clarenbach P. Checkliste Schlafstörungen. Stuttgart: Thieme; 1997
10.6.1.1 Basale Stimulation
[642] Bartoszek G, Nydahl P. Ich begleite dich durch deine Verwirrtheit. Zeitschrift für Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege (GFK) 1996; 1: 15
[643] Bienstein C, Fröhlich A, Hrsg. Bewußtlos. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben; 1994
[644] Bienstein C, Fröhlich A. Basale Stimulation in der Pflege. Bern: Hogrefe; 2016
[645] Buchholz Th, Gebel-Schürenberg A, Nydahl P, Hrsg. Begegnungen – Basale Stimulation in der Pflege, ausgesuchte Fallbeispiele. Bern: Huber; 2001
[646] Buchholz Th. et al. Der Körper eine unförmige Masse. Wege der Habituationsprophylaxe. Die Schwester/Der Pfleger 1998; 7: 568
[647] Fröhlich A, Hrsg. Wahrnehmungsstörungen und Wahrnehmungsförderung. Heidelberg: Universitätsverlag Winter; 2005
[648] Fröhlich A. Basale Stimulation. Pflege aktuell 1995; 6–7: 504
[649] Fröhlich A. Basale Stimulation in der Pflege – Das Arbeitsbuch. Bern: Hogrefe, 2016
[650] Fröhlich A. Basale Stimulation – das Konzept. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben; 2015
[651] Fröhlich A et al. Fördern – Pflegen – Begleiten. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben; 1997
[652] Hannich H, Dirkes B. Ist Erleben im Koma möglich? Intensiv 1996; 4: 4
[653] Hatz-Casparis M, Roth-Sigrist M. Basale Stimulation in der Akutpflege. Bern: Huber; 2012
[654] Mathys R, Straub J. Spastizität – Pflegerische Interventionen aus Sicht der Basalen Stimulation und der Ortho-Bionomy. Bern: Huber; 2011
[655] Nydahl P, Bartoszek G, Hrsg. Basale Stimulation – Wege in der Pflege Schwerstkranker. München: Urban & Fischer; 2012
[656] Nydahl P. Schön tief Luft holen? Basale Stimulation im Weaning. Intensiv 2002; 5: 202
[657] Salomon, F.: Bewusstsein und Bewusstlosigkeit aus anästhesiologischer und intensivmedizinischer Sicht. In: Bienstein C, Fröhlich A, Hrsg. Bewusst-los. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben; 1994
10.6.2 Internetadressen
[658] http://www.schlafgestoert.de; Stand: 07.03.2017
[659] http://www.meine-gesundheit.de; Stand: 07.03.2017
[660] http://www.psychosoziale-gesundheit.net; Stand: 07.03.2017
[661] www.rki.de; Stand: 07.03.2017
10.6.2.1 Basale Stimulation
[662] http://www.basale-stimulation.de; Stand: 07.03.2017