
21 ATL Sinn finden im Werden – Sein – Vergehen
Fallbeispiel
Simone Jochum
Pflegesituation Frau Groß
Frau Groß ist 42 Jahre alt und wird mit akuter Verschlechterung des Allgemeinzustandes auf die internistische onkologische Station aufgenommen. Bei Frau Groß wurde vor einem Jahr ein kleinzelliges Bronchialkarzinom diagnostiziert. Sie wurde mit einer Chemotherapie behandelt. Frau Groß ist verheiratet, hat eine 14-jährige Tochter und lebt in einem eigenen Haus mit großem Garten.
Gesundheits- und Krankenpflegerin Marie Kremer begleitet Frau Groß auf ihr Zimmer. „Jetzt können sie sich erst mal etwas ausruhen, Frau Groß. Das Aufnahmegespräch führe ich dann gleich mit Ihnen.“ Frau Kremer bereitet alle notwendigen Unterlagen im Stationszimmer vor und betritt etwas später erneut das Zimmer von Frau Groß. „Seit wann hat sich denn Ihr Zustand so verschlechtert?“, erkundigt sie sich. „Seit letzter Woche geht es jeden Tag etwas mehr bergab mit mir und seit heute geht fast gar nichts. Mein Mann hat momentan zum Glück Urlaub, ich kann zu Hause nicht mal mehr die Treppen steigen. Aber na ja, wahrscheinlich werde ich sowieso nicht mehr nach Hause zurück kommen“, erklärt Frau Groß mit zittriger Stimme. Marie Kremer blickt verständnisvoll. „Ich habe versucht, mit meinem Mann über die Situation zu sprechen“, spricht sie weiter, „also wie es ist, wenn ich nicht mehr da sein werde. Aber er sagt dann immer, dass es noch lange nicht so weit ist und wechselt das Thema. Ich möchte meine Familie nicht belasten, aber ich will auch, dass alles geklärt und geregelt ist, wenn irgendwann der Tag gekommen ist. Ich habe solche Angst.“ Frau Groß beginnt leise zu weinen. Frau Kremer legt die Aufnahmeunterlagen beiseite. Sie nimmt die Hand von Frau Groß und schweigt.
21.1 Sinn finden
Merke
Alles Lebendige wird, ist und vergeht.
Die Tatsache ist so selbstverständlich, dass wir Menschen dies an uns kaum beobachten, aber an den anderen sehen wir die Veränderungen.
21.1.1 Werden und wachsen
„Du bist mal groß geworden!“, sagt die Tante zu ihrer Nichte, jedes Mal, wenn sie zu Besuch kommt. Die Kleine kennt den Ausruf schon und kann ihn spöttisch nachahmen.
Ganz kleine Kinder strecken die Arme über dem Kopf in die Höhe und zeigen, dass sie „soo groß“ sind. Am Türrahmen im Kinderzimmer ist eine Messlatte angebracht. „Schon wieder 2 Zentimeter gewachsen“, sagen die Eltern und die Kinder sind froh und stolz.
Kinder wollen wachsen und groß werden. Dann, ja dann können sie endlich alles tun, was sie als Kinder noch nicht können oder nicht dürfen. „Endlich 18!“ steht in einer Glückwunschbotschaft in der Zeitung. Endlich kann man den Führerschein machen, darf so lange aufbleiben und ausgehen, wie man will, kann entscheiden, ob man zu Hause bei den Eltern bleiben will oder ausziehen möchte.
Wachsen und werden sind in dieser frühen Lebensphase eng verbunden. Die Neugier auf die Welt setzt schon das kleine Kind in Bewegung, es versucht zu krabbeln und aufzustehen und die ersten Schritte weg aus den behütenden Armen seiner Mutter zu machen. Abenteuerlust und Träume bestimmen die nächsten Ziele. Gefördert und gestützt von der nahen Umgebung ist das Werden ein Wagnis und eine Lust.
Dieses Werden hat seinen Sinn in sich.
21.1.2 Erste Sinnfragen
Die ersten Sinnfragen tauchen dann auf, wenn die Wege zur Realisierung der Träume schwierig werden. Ein 10-jähriger Junge, dessen Eltern ihm gerne helfen würden die nächste Klassenstufe und den Übergang in eine weiterführende Schule zu erleichtern, stellt die Sinnfrage vielleicht so:
-
„Was hat es für einen Sinn, so viel zu lernen, wenn ich doch keine guten Noten bekomme?“
-
„Was hat es für einen Sinn zu lernen, wenn mir die Schule keinen Spaß macht?“
Noch etwas älter geworden, argumentieren Heranwachsende provokativ:
-
„Ihr habt gelernt, wie ihr sagt, fleißig, und was habt ihr heute davon? So ein Leben wie ihr möchte ich nicht führen. Das hat doch alles keinen Sinn!“
21.1.3 Frage nach dem Sinn bei Enttäuschung und Frustration
Es ist gar nicht einfach, auf diese Fragen zu antworten. Denn Sinnerfüllung stellt sich erst ein, wenn die Mühe vorangegangen ist. Bei Frustrationen und Enttäuschungen möchte man alles hinschmeißen, möchte, dass ein Wunder geschieht und alles wie in Träumen leicht wird.
Das kann auch in der Berufsausbildung von Pflegenden geschehen. Hatte man sich den Beruf zu schön vorgestellt und hat als Motivation zur Berufsausbildung nur im Kopf, „mit Menschen zu tun haben zu wollen“, kann schon eine erste Begegnung mit der Realität des pflegerischen Alltags eine Enttäuschung sein. „War das wirklich sinnvoll, diesen Beruf zu wählen?“, fragt man sich vielleicht schon nach dem ersten Realitätsschock.
Fallbeispiel
Ein Team einer Station ist gestresst. Zu der regelmäßigen pflegerischen Arbeit kamen in den letzten Wochen zusätzliche Anforderungen auf die Pflegenden zu. Sie, die gewohnt waren, in einem kleinen Team zu arbeiten, müssen sich mit einem anderen Team zusammentun und den Dienst auf der größeren Station übernehmen.
„Dafür bin ich nicht in die Pflege gegangen“, klagt eine Mitarbeiterin und (fast) alle stimmen ihr zu. Ein Pfleger setzt dem Ganzen noch die Spitze auf: „Ich habe gelernt, der Patient solle im Mittelpunkt stehen. Aber jetzt steht nur noch der Profit im Mittelpunkt.“ So stellten die Mitarbeiter dieses Teams die Sinnfrage in ihrem Beruf ...
21.1.3.1 Antworten auf Sinnfragen
Schnelle Antworten sind bei Sinnfragen unsinnig, sie verkennen die Tiefe und die existenzielle Bedeutung solcher Fragen.
Deshalb sollte eine andere Form des Miteinandersprechens beginnen. Eine Form, die die Frage ernst nimmt, so ernst, dass derjenige, der mit nachdenklichen Fragen beginnt, selber weiß, dass die Antworten nicht einfach sind und niemand bei Sinnfragen einfach abgetan werden kann. Eine Gesprächsform, die die gemeinsame Suche nach dem Sinn ermöglicht, in der sich alle Zeit nehmen, genauer und konkreter zu fragen, wann und unter welchen Bedingungen der Sinn verloren zu gehen droht.
Im obigen Beispiel ist das so gelaufen:
Fallbeispiel
... Nach der verzweifelten Klage einer älteren Mitarbeiterin, die sagte: „Früher habe ich mich an der Dankbarkeit der Patienten gestärkt. Da bin ich trotz aller Mühen, die es immer schon gab, froh geworden und das gab mir Kraft“, fragt eine Kollegin: „Gibt es denn heute gar nichts mehr, was dich freut?“
Nach einigem Zögern suchten daraufhin alle nach den Kleinigkeiten im Alltag, die sie freuen können. Verwunderlicherweise standen dabei nicht mehr die Patienten im Mittelpunkt, sondern die Teamkollegen.
So hat diese Gruppe in ihrer Suche einen Punkt gefunden, der die Sinnfrage verändert hat, aber sie auch beantwortbar erscheinen ließ. Eine Antwort, die im Miteinandersuchen nach dem Sinn der pflegerischen Arbeit in diesem Team gefunden wurde, könnte man so umschreiben: „Wenn ich mich von euch anderen verstanden fühle, wenn ich mit euch zusammen sein kann und weiß, dass wir uns bemühen, uns gegenseitig eine Stütze zu sein, dann finde ich meine Aufgabe als Pflegende sinnvoll.“
21.1.4 Sinnsuche mit Anderen
Die einsame Suche nach dem Sinn seines Tuns und Handelns kann zu Trauer und Verzweiflung führen. Das, was man sich erträumte und auf was man hoffte, hat sich nicht so erfüllt, wie man es sich gewünscht hatte.
Schlimm wird es dann, wenn einem nur noch einfällt: „Das, was ich tue, hat keinen Sinn!“ In einer solchen Stimmung neigen wir dazu zu verallgemeinern. Dann sagen wir nur allzu gerne: „Alles hat keinen Sinn mehr!“ Damit verdunkelt sich die Welt um uns herum und in einem selber.
Aus dieser Dunkelheit finden Menschen nur schwer alleine heraus, denn ihre Augen sind von Tränen verschleiert, ihre Ohren taub und ihr Körper wie gelähmt und ganz erstarrt. Wie können die Tränen abgewischt, die Ohren geöffnet, das Bewusstsein der Lebendigkeit des Körpers wiedererlangt werden?
Dann, wenn andere Menschen da sind, die behutsam die Sinne wieder wecken. Behutsam und einfühlsam, auch dann, wenn sie den Weinenden nicht ganz verstehen, aber doch eine Ahnung haben von den Leiden, von denen der Weinende ergriffen ist. Dass die Hilfe auch demjenigen Kraft gibt, der helfen will, ist nicht nur Kinderglaube, sondern auch durch die Hirnforschung wissenschaftlich bewiesen. Das gute Gefühl, jemandem zu helfen, ist als Hochstimmung nachweisbar.
Merke
Wenn freundschaftliche oder auch liebende Hilfe nicht helfen kann, müssen therapeutische Hilfen aufgesucht werden. Dazu brauchen die (im pathologischen Sinne) depressiven Menschen diejenigen anderen, die sie zum Weg in die Therapie ermutigen.
Supervision Teams brauchen Zeit und Raum, in dem sie sich miteinander austauschen können, um die Ressourcen ihrer Kollegialität zu nutzen. Eine bewährte Methode ist die Supervision.
21.1.5 Große Sinnfragen
Männer und Frauen sind immer mal wieder mit den großen Sinnfragen konfrontiert. Hatten sie sie im Alltag vergessen, solange sie gesund waren, gut aufgehoben unter Menschen, die sie lieben und von denen sie geliebt werden, wenn ihre Anstrengungen belohnt wurden und immer wieder neue Hoffnungen nährten, so vertrauten sie darauf, dass es gut geht, das Leben.
Bei schweren seelischen und körperlichen Schmerzen steht dann doch auf einmal groß und unausweichlich die Frage nach dem Sinn des Lebens vor ihnen. Ein Unfall, eine Krankheit, eine Trennung, ein Verlust eines geliebten Menschen sind Anlässe, die die Sinnfrage unausweichlich machen. Und wieder helfen nicht die schnellen Antworten. Wenn jemand unvorsichtigerweise sagt: „Ihre Krankheit hat sicher einen Sinn!“, dann kann der Betroffene sich entweder der Autorität einer Pflegenden glaubend ergeben oder aber eine solche Antwort als totales Missverständnis erleben, was sein Vertrauen in die Helfenden erschüttert.
Merke
Pflegende können bei großen Sinnfragen nur Begleiter sein, Begleiter auf einem Weg, den der Betroffene selber finden muss.
Als Begleiter können Pflegende auch von Kranken, Verletzten und Trauernden lernen, wenn sie gut zuhören und lernen wollen. Was sind die „Halteseile“ für diesen Menschen, woraus zieht er trotz allem Hoffnung? So können sie darüber staunen, wenn jemand aus seinem Glauben heraus unbeantwortete Fragen stehen lassen kann, weil er Größerem vertraut. Staunen darüber, wie Frauen sich gegenseitig trösten, die ihre Kinder verloren haben, und wie Kranke, die wissen, dass ihre Krankheit zum Tode führt, noch auf die Erfüllung manchmal ganz kleiner Träume hoffen. Pflegende können die Suche nach dem Sinn fürsorglich begleiten.
Merke
Die Frage nach dem Sinn von Leiden ist die Frage, die keiner beantworten kann.
Wenn der vorübergehende Schmerz einsichtig gemacht werden kann als ein Schmerz, der auf Besserung und Heilung hoffen lässt, kann vernünftiger Zuspruch helfen, bei unangenehmem Schmerz beim Zahnarzt genauso wie beim Einstich für eine Spritze. Das schönste Beispiel von sinnvollen Schmerzen sind die Wehen bei einer Geburt, die sofort vergessen werden, wenn das kleine menschliche Wesen auf dem Bauch der Mutter schreiend oder schmatzend liegt.
Leiden, das größer ist als der vorübergehende oder zu behandelnde Schmerz, lässt uns Menschen ratlos und mitfühlend hilflos die Frage stellen: „Warum muss der Mensch so leiden?“
Angehörige und Trauernde sprechen einsichtig davon, dass der Tod, dem lange Krankheit und viel Leid vorangegangen sind, eine Erlösung war für den Leidenden und für die Mitleidenden. Wenn das Vergehen, das Sterben natürlich erscheint, nach einem langen, erfüllten Leben, dann können selbst die Trauernden in ihren Todesanzeigen versöhnt davon reden, dass die Zeit gekommen war.
Wenn Kinder und junge Menschen, Männer und Frauen mitten aus dem Leben gerissen werden oder für immer behindert oder verstümmelt bleiben, dann stellt sich die Frage unausweichlich: „Was hat das Leiden für einen Sinn?“ Philosophen haben sich seit Jahrhunderten mit dieser Frage auseinandergesetzt. Künstler, Lehrer und Meister in verschiedenen Religionen haben sich an diese Sinnfrage gewagt. Verbannte und Gefolterte, Alleingelassene, Hungernde und Frierende schreien sie heraus in ihrer Verzweiflung.
Merke
Eine allgemeine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Leidens gibt es nicht. Es gibt aber immer wieder individuelle Erfahrungen eines Sinns des Leidens.
Fragt ein Leidender: „Was hat dieses mein Leiden für einen Sinn?“, dann kann vielleicht eine Antwort wie diese Trost sein: „Ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber ich kann Sie begleiten, wenn Sie sich auf die Suche begeben.“
21.2 Sterben als erlebte Krise
21.2.1 Krisen
Krisen gehen wir am liebsten aus dem Weg. Auch mit Sterben sind häufig Krisen verbunden. Beides bezeichnet einen Übergang: Altes geht zu Ende, die Sicherheit ist weggebrochen, das Neue noch nicht erreicht. Es ist eine schwierige Übergangssituation.
Definition
Eine Krisensituation ist ein schmerzhafter seelischer Zustand, der von einem überraschenden Ereignis oder akutem Geschehen hervorgerufen wird. Die Krisensituation kann entstehen, wenn sich ein Mensch auf dem Weg zu wichtigen Lebenszielen Hindernissen gegenübersieht.
Krise kann Bedrohung und Gefahr beinhalten, es können aber auch Möglichkeiten der Reifung, des Wachstums damit verbunden sein.
Sterben wird von vielen unangenehm befürchtet. Es kann als eine biografische Krise angesehen werden, die das Ende unseres Lebens markiert. Und es stellen sich gerade in der Sterbesituation viele Menschen Sinnfragen: Nach dem Wozu des bisherigen Lebens, nach dem Sinn des Leidens und Sterbens, nach Schuld und Vergebung, nach einem Weiterleben oder der Verwandlung, nach dem, was von uns bleibt. Solche Fragen können spannend, klärend, gewinnbringend, aber auch belastend, niederschmetternd wirken.
Lebensphase Kind
Mechthild Hoehl
Entwicklung des Todesverständnisses bei Kindern
Die Vorstellung vom Tod ändert sich im Laufe der Entwicklung. Je nachdem, wie weit ein Kind bereits mit der Thematik betraut wurde und v.a. wie es an das Thema „Sterben und Tod“ herangeführt wurde, werden seine Vorstellungen und Erfahrungen, die es damit verbindet, geprägt. ▶ Tab. 21.1 zeigt in einer groben Übersicht, was sich Kinder unterschiedlichen Alters unter dem Tod vorstellen.
|
Alter |
Entwicklungsstand |
|
2 Jahre |
|
|
2–3 Jahre |
|
|
3–4 Jahre |
|
|
4–6 Jahre |
|
|
6–8 Jahre |
|
|
8–10 Jahre |
|
|
ab der Pubertät |
|
Trauerreaktionen bei Kindern
Kinder erleben den Verlust eines nahestehenden Menschen oft ganz anders als Erwachsene. Und sie reagieren anders. Mögliche kindliche Reaktionen können sein: plötzliche Verhaltensänderungen, Schlafstörungen, Alpträume, Rückgang von Schulleistungen, Gereiztheit und Launenhaftigkeit, starke Trennungsängste, Entwicklungsregression (z.B. Daumenlutschen, Bettnässen), große Angst um die noch lebenden Angehörigen, Übernahme der Aufgaben des Verstorbenen, Vorwürfe gegen sich und andere, Schuldgefühle (subjektives Schuldempfinden).
Umgang mit trauernden Kindern
Vermieden werden sollten Formulierungen wie „Oma ist friedlich eingeschlafen ...“ Dieses könnte Ängste vor dem eigenen Einschlafen verursachen. Aber auch Formulierungen wie „Opa ist gestorben, weil der krank war …“ könnten bewirken, dass Kinder schon bei normalen Krankheiten Ängste entwickeln.
Um das Trauern zu erleichtern, benötigen Kinder Informationen. Sie haben das Recht zu erfahren, was passiert ist. Sie sollten kindgerecht und umfassend über die Umstände des Todes informiert werden (auch bei Suizid!). Ebenso sollten Kinder, wenn sie es wünschen, beim Abschiednehmen, der Beerdigung, der Gestaltung der Trauerfeier usw. mit einbezogen werden.
Nach dem Trauerfall vermitteln vertraute Rituale Sicherheit. Geduld, Aufmerksamkeit und die Möglichkeit der Verarbeitung im kreativen Gestalten und Spiel erleichtern Kindern die Situation. Manche Kinder unterdrücken ihre gelebte Trauer, um die ebenfalls trauernden erwachsenen Bezugspersonen zu schützen. Dies ist aber längerfristig schädlich. Externe Trauerberater können betroffenen Kindern einen geschützten Rahmen für ihre Gefühlsäußerungen schaffen.
21.2.2 Von Sterbenden lernen
Sich auf das Thema Sterben einzulassen, fällt vielen schwer. Der Umgang mit Sterbenden ist auch bei professionell Pflegenden oft angstbehaftet, da die Auseinandersetzung mit dem Sterben anderer eng mit der Auseinandersetzung um das eigene Leben verbunden ist. Eine adäquate Begegnung mit dem Leid des anderen fordert die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit eigenen existenziellen Fragen, Nöten, Ängsten und Zukunftssorgen heraus.
Eine qualifizierte Sterbe- und Trauerbegleitung ist ohne kompetentes Wissen heute nicht mehr möglich. Es sind medizinische, psychologische, soziale, rechtliche und spirituelle Kenntnisse erforderlich. Beim Umgang mit Sterbenden ist es für den Einzelnen aber auch Aufgabe innezuhalten, zurückzutreten und zu schauen, zu reflektieren.
Merke
Um Menschen in der Sterbephase begegnen und sie sensibel pflegen zu können, müssen Pflegende ein bestimmtes Grundwissen mitbringen. Zum Entwickeln einer Haltung von Wertschätzung, Solidarität und Empathie gegenüber dem Kranken muss aber auch die Bereitschaft bestehen, sich mit dem eigenen Sterben und Tod auseinanderzusetzen.
Von Sterbenden können wir viel lernen: Geduld, Leidensfähigkeit, Dankbarkeit für Kleinigkeiten, den Umgang mit Ängsten, Humor trotz allem, die Frage nach dem Jenseits usw. ( ▶ Abb. 21.1).
Humor kann helfen, schwierige Situationen auszuhalten.
Abb. 21.1
(Foto: K. Oborny, Thieme)

Berührt und betroffen werden vom eigenen und fremden Leiden verträgt keine Belehrung. Hier geht es mehr darum, Zugänge zu ermöglichen und zu erhalten, etwas Hereinzulassen, was uns ängstigt, etwas zu teilen und mitzuteilen. Solche Lernprozesse haben mit Erfahrung von Leid, mit Einlassen und Zulassen von eigenen und fremden Ängsten und Verlusterfahrung zu tun.
Hilde Domin (1987) hat die Unterweisung, die wir von Sterbenden erhalten, also indem der Sterbende zum Lehrmeister wird, in einem Gedicht so formuliert:
„Unterricht
Jeder, der geht, lehrt uns ein wenig über uns selber.
Kostbarster Unterricht an den Sterbebetten,
alle Spiegel so klar wie ein See nach großem Regen,
ehe der durstige Tag die Bilder wieder verwischt.
Nur einmal sterben sie für uns, nie wieder.
Was wüssten wir je ohne sie?
...
Wir, deren Worte sich verfehlen, wir vergessen es,
und sie?
Sie können die Lehre nicht wiederholen.
Dein Tod oder meiner, der nächste Unterricht so hell,
so deutlich, dass es gleich wieder dunkel wird.“ (Domin 1987)
21.3 Sterben und Tod
Sterben und Tod berühren uns v. a. durch 2 Aspekte: unsere persönliche Einstellung und die Tabuisierung in der Gesellschaft.
21.3.1 Persönliche Einstellung
Zur Bereitschaft und Fähigkeit, sterbende Menschen zu pflegen, gehört, sich mit dem eigenen Sterben zu befassen und über die persönliche Einstellung zum Tod nachzudenken. Diese Einstellung hat einen großen Einfluss darauf, ob wir Patienten in der Sterbephase menschlich pflegen können. Denn nur, wenn wir uns selbst als Menschen mit Schwächen und Unzulänglichkeiten annehmen, können wir auch den Patienten so akzeptieren. Wenn wir das Sterben als größten von vielen Abschieden verstehen, können wir uns ihm leichter stellen.
21.3.2 Tabuisierung in der Gesellschaft
Verdrängen In der heutigen Zeit wird der Tod aus dem Bewusstsein verbannt. Wie die Gedanken ans Sterben, so wird auch das Sterben selbst aus dem Leben verdrängt. In früheren Zeiten kam der Mensch schon als Kind mit dem Tod in Berührung, denn die Anwesenheit alter Menschen und Sterbender in der Familie war selbstverständlich. Seit dem 19. Jahrhundert wird das Sterben zunehmend aus dem familiären Bereich in Kliniken und Altenheime verlegt. Die meisten Menschen sterben alleine, in Krankenhäusern oder in Heimen. 96 % der unter 25-Jährigen haben greifbar noch keinen Leichnam gesehen.
Ängste Der Umgang mit sterbenden Patienten ist oft angstbehaftet. Pflegende stehen in einem Rollenkonflikt: Einerseits sind sie Mitglieder der Gesellschaft und verdrängen Leid, Krankheit und Sterben. Andererseits wird von Pflegenden und Ärzten aber erwartet, dass sie das können, was vielen Menschen heute nicht mehr möglich ist: mit Sterbenden zu leben und zu arbeiten.
Was können wir gegen unsere Angst vor dem Tod tun? Einige Pflegende flüchten in Aktionismus, d. h., sie verrichten eine Tätigkeit nach der anderen, nur um etwas zu tun zu haben. Sie versuchen, ihre Angst zu kompensieren. Konkrete Pflegehandlungen können aber auch helfen, die eigene Unsicherheit zu überbrücken und mit dem Sterbenden in Kontakt zu kommen ( ▶ Abb. 21.2).
Konkrete Pflegehandlungen können helfen, die Unsicherheit mit Sterbenden zu überbrücken. (Situation nachgestellt)
Abb. 21.2
(Foto: A. Fischer, Thieme)

Fallbeispiel
„Wenn ein Patient auf meiner Station im Sterben liegt, fühlt es sich komisch an, länger bei ihm im Zimmer zu bleiben. Meist haben wir viel Arbeit und ich kann mich nicht einfach neben sein Bett setzen. So finde ich immer einen Grund, oft zu dem Sterbenden zu gehen. Einmal nehme ich das Blutdruckgerät mit, ein anderes Mal kontrolliere ich die Infusion oder die Sauerstoffzufuhr, obwohl ich genau weiß, dass ihm damit nicht geholfen werden kann. Trotzdem, dabei halte ich ihm kurz die Hand, streichle ihn und kann ihn spüren lassen, dass ein Mensch bei ihm ist.“
Offener Umgang mit dem Tod Wichtig ist, dass im Team offen über den Tod eines Patienten gesprochen wird. Auch Mitpatienten müssen trauern und ihre Gefühle aussprechen können.
Praxistipp
Ein Stationsritual im Sterbefall, z. B. eine brennende Kerze in einer Ecke des Stationsflures (brandgeschützt im Windlicht oder als schwimmende Kerze), kann Anlass zum Gespräch über einen Verstorbenen sein. Sollte es aus Brandschutzgründen nicht erlaubt sein, eine Kerze aufzustellen, kann eine LED-Kerze verwendet werden.
21.3.3 Alterssuizid
Vergleicht man das Suizidrisiko in unterschiedlichen Altersgruppen, haben ältere Menschen das höchste Risiko, einen Suizid zu begehen (Sitzmann 2014b). Besonders Männer über 65 Jahren stellen eine Hochrisikogruppe dar.
Sucht man nach den Ursachen, treten v.a. psychosoziale Faktoren in den Vordergrund, wie z.B.
-
Inaktivität,
-
Isolation,
-
Krankheit,
-
Vereinsamung durch Tod des Lebenspartners und
-
Depression.
Laut Angaben von Statista (Statista 2017) lag die Suizidrate im Jahr 2015 in Deutschland bei ca. 10 000 Fällen. Davon ausgenommen sind jedoch jene Personen, die einen „indirekten“ Suizid begehen, z.B. durch Nahrungsverweigerung oder das Ablehnen lebensnotwendiger Medikamente oder Behandlungen. Schätzungen zufolge soll es rund 10-mal so viele Suizidversuche geben wie tatsächlich vollendete Suizide.
Lebensphase alter Mensch
Gewalt in der Pflege
Gewalt und Missbrauch sind sowohl gesellschaftlich als auch in der Pflege immer noch ein Tabuthema (Beine 2017). Übergriffe auf Patienten werden selten bis gar nicht aufgedeckt, oft fehlt es schlicht an Beweisen. Gewalt kann viele Ausprägungen haben. Sie kann sich bereits auf verbaler Ebene in einer entwürdigenden, rohen und brutalen Sprache äußern (Sitzmann 1989; 2005b; 2006). Ebenso vielfältig können die Auslöser für Gewalt sein, oft ist es ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren:
-
Personalmangel
-
Überlastung/Burnout
-
Stress, allgemeine Unzufriedenheit
-
Zeitdruck
-
Missverständnisse und mangelnde Kommunikation
-
langwierige Konflikte mit Kollegen usw.
Eine der wirksamsten Möglichkeiten der Gewaltprävention ist die offene Kommunikation im Team. Sprechen Sie Vermutungen offen an, Stillschweigen oder bewusstes Wegsehen können dramatische Folgen haben.
21.3.4 Patientenverfügung
Definition
Die Patientenverfügung ist eine Willenserklärung zum Umfang medizinischer Behandlung im Falle der Einwilligungsunfähigkeit. Ergänzend zur Patientenverfügung ist eine ▶ Vorsorgevollmacht sinnvoll. In ihr bestimmt ein Mensch einen Dritten, an seiner Stelle im Fall der Einwilligungsunfähigkeit zu entscheiden. In einer Betreuungsverfügung kann der Volljährige eine Person vorschlagen, die zum Betreuer bestellt werden soll. Sofern dies nicht dem Wohl des Volljährigen widerspricht, ist diesem Vorschlag zu entsprechen. Möchte die volljährige Person von einer bestimmten Person nicht betreut werden, soll darauf Rücksicht genommen werden (§1897 Absatz 4 BGB)
Menschliche Selbstbestimmung Um sicherzugehen, dass im Fall der Einwilligungsunfähigkeit im Sinne des Betroffenen gehandelt wird, gibt es die seit 2009 im Zivilrecht gesetzlich verankerte Patientenverfügung. In dieser wird der Patientenwille schriftlich festgehalten.
Liegt keine Patientenverfügung vor oder sind die Formulierungen zu ungenau, entscheidet ein Vertreter gemeinsam mit dem Arzt auf Basis des mutmaßlichen Willens des Patienten über eine Behandlung. Um diesem vorzubeugen, sollte eine Patientenverfügung immer ganz konkret beschreiben, für welche Situation sie gelten soll. Es ist sinnvoll, beim Verfassen einen medizinischen Wortlaut zu beachten.
Formulierungsbeispiel „Wenn ich an einer unheilbaren Krankheit leide, die nach ärztlicher Einschätzung unaufhaltbar zum Tode führen wird und keine Anzeichen von Lebenswille bei mir erkennbar sind, hat für mich Leidensminderung absoluten Vorrang vor allen anderen therapeutischen Maßnahmen ...“.
Für Interessierte gibt es z.B. vom Bundesministerium für Gesundheit, Kirchen und Hospizorganisationen Informationen und Vorlagen für eine Patientenverfügung.
Vorsorgevollmacht Die Vorsorgevollmacht legt schriftlich fest, dass der Bevollmächtigte an die Patientenverfügung gebunden ist und den darin geäußerten Willen gegenüber Pflegenden und Ärzten durchzusetzen hat. Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sollten gemeinsam erstellt werden.
Abwägungen als Gesunder Es empfiehlt sich, dass der Mensch, der eine Patientenverfügung erstellen möchte, sich in eine intensive Auseinandersetzung sowie tief greifende persönliche Abwägungen im Hinblick auf Tod und Sterben begibt. Das Ringen um Krankheit, Leiden und Tod ist notwendig, um sich bewusst zu werden, dass eine Patientenverfügung als Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts auch die eigene Verantwortung für die Folgen bei Umsetzung der Patientenverfügung umfasst. Da das im Fall einer plötzlichen schweren Erkrankung nicht immer möglich ist, ist es angebracht, dass die Verfügung bereits in gesunden Tagen formuliert wird. Am Ende dieser persönlichen Willensbildung kann sowohl die Entscheidung stehen, eine Patientenverfügung zu erstellen, als auch die Entscheidung, keine Vorsorge treffen zu wollen. Eine Beratung bei der Erstellung einer Patientenverfügung ist empfehlenswert und trägt dazu bei, sich selbst Klarheit über das Gewollte zu verschaffen.
Kritische Überlegungen Eine Patientenverfügung wird in mehrfacher Hinsicht als kritisch angesehen, z. B. könnte sie die krankheitsbedingte Prognose eines Patienten verschlechtern. Es wird befürchtet, dass Patientenverfügungen bei den behandelnden Ärzten zu einer „negativen therapeutischen Grundeinstellung“ führen könnten. Dadurch könnte sich dann die Prognose tatsächlich verschlechtern. Dieser Effekt ist in der Literatur als „Futility“ (Aussichtslosigkeitsannahme) beschrieben (Sitzmann 2014a). Andere sehen in den Bestrebungen für die Patientenverfügung einen Einstieg in die Euthanasie „durch die Hintertür“. Ein gesellschaftlicher Zwang zum „sozialverträglichen Frühableben“ wird befürchtet (Sitzmann u. Zegelin 2006).
Wiederholung der Verfügung Es existieren dazu keine gesetzlichen Vorschriften, Willensäußerungen unterliegen keiner Verjährung. Es empfiehlt sich aber, die Verfügung im Abstand von 2 – 3 Jahren erneut zu unterschreiben. Damit wird ihre fortbestehende Gültigkeit bestätigt.
21.4 Palliative Care: wahrnehmen – verstehen – schützen
Fallbeispiel
Pflegesituation Frau Ott
Mit folgendem Beispiel möchten wir aufzeigen, was die palliative Haltung in der Pflege bewirken kann.
Eine Palliative-Care-Fachkraft berichtet: „Frau Ott, eine bereits bekannte, onkologisch kranke Patientin, 67 Jahre alt, wurde wegen Verschlechterung des Allgemeinzustandes, starkem Gewichtsverlust und Exsikkose zur Palliativpflege stationär aufgenommen. Schmerztherapeutisch war sie sehr gut eingestellt. Die Mobilisation vom Bett auf den Nachtstuhl und ins Bad war noch möglich. Frau Ott hatte ein metastasierendes Mammakarzinom, das vor einigen Jahren palliativ chemotherapeutisch und durch Radiotherapie behandelt wurde. Vor ca. 2 Jahren traten Metastasen in den Knochen der rechten Gesichtshälfte im Bereich des Jochbeines auf, wodurch sie sehr entstellt aussah. Frau Ott konnte seit einigen Wochen, bedingt durch massive Schluckbeschwerden, nur noch teelöffelweise Wasser, Tee oder etwas klare Brühe zu sich nehmen.
Sie litt unter stärkster Heiserkeit, ein Umstand, der eine verbale Kommunikation sehr erschwerte. Sie hätte ohne Probleme Wünsche oder Bedürfnisse auf einen Block schreiben können. In diesem Punkt war sie jedoch sehr eigen. Ich glaube, Frau Ott hat durch diesen Umstand Zeit, die sie für sich brauchte, von uns allen, von Ärzten und Pflegekräften, eingefordert.
Ich weiß, dass sie über die infauste Prognose ihrer Erkrankung sehr gut informiert war. Psychisch machte Frau Ott einen stets ausgeglichenen und zufriedenen Eindruck. Durch Gespräche während pflegerischer Tätigkeiten erfuhr ich, dass sie mit ihrer Freundin gemeinsam in einer großen Wohnung lebte und von dieser auch liebevoll betreut wurde. Sie sprach von sich aus auch mehrmals das Thema Sterben und Tod an, aber in einer Form und Abgeklärtheit, die mich zum Nachdenken veranlasste.
Am vierten Tag ihrer stationären Aufnahme hatte ich Spätdienst und wurde von Kollegen mit den Worten begrüßt: ,Frau Ott ist dermaßen aggressiv und fordernd, nichts kann man ihr recht machen, an allem hat sie etwas zu meckern. Viel Spaß heute Nachmittag!‘ Ich konnte jedoch die Aussagen meiner Kollegen vom Frühdienst nicht bestätigen.
Frau Ott war wie gewohnt freundlich, und es fiel auch kein unangebrachtes Wort. Das Einzige was mir auffiel war, dass sie am späten Nachmittag immer wieder für eine halbe Stunde in einen regelrechten Tiefschlaf fiel, jedoch auf Ansprache erwachte. Ansonsten gab es keine Besonderheiten. Am folgenden Tag hatte ich Frühdienst. Originalton Nachtwache: ,Ich musste Frau Ott in ein Einzelzimmer schieben, sie war nicht mehr ansprechbar und nicht erweckbar. Der diensthabende Arzt sagte, sie sei präfinal. Ihre Freundin wurde informiert, war auch schon hier.‘
Genau so fand ich Frau Ott vor, als läge sie im Koma. Dennoch gab es keinen Hinweis darauf, aus welchem Grund dieser Zustand eingetreten war. Ab dem nächsten Tag hatte ich eine Woche Urlaub und am darauffolgenden Samstag Frühdienst. Die Übergabe meiner Kollegen lautete: ,Frau Ott geht es wieder besser, sie hat einfach 2 Tage ohne Unterbrechung geschlafen, ist wieder ganz schön fordernd, macht aber einen depressiven Eindruck. Schmerzen hat sie keine. Übrigens, sie hat oft nach dir gefragt.‘
Als ich das Zimmer von Frau Ott betrat, strahlte sie mich an mit den Worten: ,Gott sei Dank, dass Sie wieder da sind. Ich habe auf Sie gewartet.‘ Auf mein: ,Weshalb?‘ erhielt ich eine Antwort, mit welcher ich absolut nicht gerechnet hatte. Sie sprach mit heiserer Stimme, unter größter Anstrengung, jedoch klar und verständlich: ,Das geht nur Sie und mich etwas an. Bitte bringen Sie mir Dolantin in ausreichender Dosierung und spritzen Sie mir dies!‘ Auf mein erschrockenes ,Ja, aber …‘, fiel sie mir sofort ins Wort: ,Wenn Sie es nicht spritzen wollen, dann bringen Sie mir wenigstens die Ampullen, ich spritze es selbst durch den Port. Ich will und kann nicht mehr! Und bitte, sprechen Sie mit niemandem darüber!‘
Meine erste Reaktion: ,Das kann ich nicht, und das würde ich auch niemals tun. Aber ich bin im Moment mit dieser Situation völlig überfordert. Ich brauche jetzt etwas Zeit für mich. Bitte haben Sie Verständnis.‘ Ich betreute Frau Ott an diesem Tag weiter, hatte jedoch Kommunikationsprobleme, konnte ihr kaum in die Augen sehen. Umso überlegener wirkte sie. Für mich war diese Situation unerträglich. Nach Dienstende bat ich sie um ein Gespräch. Ich habe ihr nur diese eine Frage gestellt: ,Was ist passiert?‘ – Hierdurch kam einiges zutage: Schon als Frau Ott vor ca. 5 Jahren die Diagnose ihrer Erkrankung erfuhr und wenig später feststand, dass eine Heilung nicht mehr möglich sei, habe sie sich mit ,aktiver Sterbehilfe‘ beschäftigt, ,ein Türchen offen gelassen‘.
Als Frau Ott bei uns stationär aufgenommen wurde, ,habe sie ganz einfach mal den fehlenden Schlaf der letzten Wochen nachgeholt‘. – Zitat: ,Mir war alles egal, ich hatte einfach keine Kraft mehr und keine Lust zu reagieren, wollte nur meine Ruhe haben.‘ Das Schlimmste aber sei für sie gewesen, dass man ihr den letzten Rest an Selbstständigkeit genommen habe.
Einfache Dinge waren jedoch für Frau Ott von hohem Stellenwert: ,Jeder weiß, dass ich mich nur mit klarem Wasser wasche. Und jeden Tag gab man mir, trotz Protest, Waschlotion ins Waschwasser.‘
,Meinen Oberkörper habe ich immer selbst gewaschen. Irgendwann wurde mir auch das abgenommen; ich war wohl zu langsam.‘
,Wenn ich den Schieber benutze, putzt mich einfach jemand ab. Ich will das selbst tun.‘
,Warum muss ich seit einer Woche jeden Tag die gleiche klare Suppe essen? Ich möchte mal wieder etwas anderes! Kein Mensch fragt mich!‘
,Ich fühle mich in diesem Zimmer abgeschoben, allein gelassen!‘
Mit jedem Satz von Frau Ott wurde mir klarer, was ihr eigentliches Anliegen war, auf keinen Fall aber aktive Sterbehilfe. Trotzdem sprach ich sie noch einmal darauf an. Ihre Antwort: ,Ich wusste, dass Sie so reagieren, nicht locker lassen. Und, ich wusste eine Zeit lang selbst nicht mehr, was ich will. Ich weiß, dass ich sterben muss, aber ich will noch ein bisschen leben vor meinem Tod.‘
Am nächsten Morgen verlegten wir Frau Ott mit ihrem Einverständnis in ein 4-Bett-Zimmer. Raus aus der Isolation! Sie hatte sehr nette Zimmernachbarinnen; mit einer Patientin, die sehr viel handarbeitete, verstand sie sich besonders gut. Auf deren Anregung hin bzw. nach einem ,Fachgespräch‘ unter Patientinnen: ,Frau Ott, haben Sie schon was im Kopf? (Damit meinte sie Metastasen.) Nein? O.K. Haben Sie etwas an den Händen? Nein? Ja also, warum tun Sie dann nichts?‘, begann Frau Ott wieder zu stricken. Das hatte sie früher für ihr Leben gern getan. Innerhalb von 2 Tagen hatte sie eine komplette Ausfahrgarnitur für das Baby ihres Neffen gestrickt und war sehr stolz darauf. Außerdem begann sie wieder zu lesen (wir hatten etwas Literatur in der Nähe ihres Bettes platziert) und machte Kreuzworträtsel.
Frau Ott war ,bettmobil‘, sie hat sich (mit klarem Wasser), soweit ihre Ressourcen dies ermöglichten, allein gewaschen, erhielt von uns insgesamt nur die Hilfe, die sie benötigte und wünschte (Umdenken im Team war nötig!). Sie begann auch wieder, weiche Brötchen, bestrichen mit Butter, nicht zu essen, sondern ,auszulutschen‘, wie sie es nannte, und probierte passierte Kost aus. Manchmal konnte sie etwas essen, manchmal nicht. Wichtig war für sie das Angebot. Parenterale Ernährung erfolgte zusätzlich über den Port. Nach intensiver Rücksprache mit dem behandelnden Arzt entschied sich die Patientin ganz bewusst für den Verzicht einer geplanten Therapie, lehnte auch weitere Untersuchungen ab.
Sie wollte nach Hause und auch zu Hause sterben.
Ihre Schmerztherapie war im Moment adäquat. Ferner war sie bei ihrem Hausarzt, der sie schon jahrelang betreute, in guten Händen. Von ihm konnte sie jederzeit kompetente Hilfe erwarten, falls die Schmerzen stärker und andere Symptome auftreten würden. Von unserer Seite wurden die Pflegeüberleitung eingeschaltet, ein ambulanter Pflegedienst für die häusliche Mitbetreuung gefunden, fehlende Hilfsmittel organisiert. 2 Wochen nach unserem Gespräch wurde Frau Ott nach Hause entlassen.
Mir ist bekannt, dass Frau Ott noch 6 Monate gut gelebt hat und einen schönen Tod hatte, ohne Schmerzen und in Würde.“ (Mladek 2004)
Definition
Aus dem lateinischen Wortstamm pallium (Mantel) und dem angelsächsischen Begriff care (Fürsorge, Pflege) zusammengesetzt, versteht man unter Palliative Care die „fürsorglich-umhüllende“, lindernde und schützende Sorge für schwer kranke und sterbende Menschen mit ihren Angehörigen.
Das setzt bei den Helfenden eine spezielle Haltung wie Echtheit, Wertschätzung und Einfühlsamkeit voraus (Rogers 1983). In der Palliative Care ist die Beziehung der Pflegenden zu den Kranken und ihren Angehörigen (im weitesten Sinn) die Basis der Pflege. Diese Basis fußt auf den 3 Pflegekompetenzen: wahrnehmen – verstehen – schützen (Student u. Napiwotzky 2011).
Die WHO weist gerade dem Pflegeberuf in der Palliative Care eine gewichtige Rolle zu: Pflegende tragen in besonderer Weise Verantwortung für Informationsvermittlung, Beratung und Anleitung von Kranken und ihren Angehörigen und sorgen nicht zuletzt für die Kontinuität der Fürsorge zwischen Zuhause und dem Krankenhaus. Wegen ihrer Nähe zu den Kranken sind Pflegende außerdem in idealer Weise geeignet, Schmerzen und andere Symptome zu beobachten und richtig einzuschätzen (WHO 1990).
Allerdings entspricht dies oftmals nicht der Realität des allgemeinen Pflegealltags. Pflegende sehen sich selbst oft als Spezialisten unter anderen Spezialisten (z. B. Diätassistenten, Physiotherapeuten) und werden auch von anderen Berufsgruppen so gesehen. Das verweist Pflege dann tendenziell in die Funktionspflege, die bestimmte Handgriffe bzw. Eingriffe zu bestimmten Zeiten vornimmt. Folgende negativen Aspekte eines multiprofessionellen Teams sind dann kaum zu umgehen (Davy u. Ellis 2003):
-
Viele Termine und Konsultationen stören das Leben der Kranken und ihrer Angehörigen, sodass kaum Zeit und Kraft für andere Dinge bleibt.
-
Unklare, widersprüchliche Informationen in verschiedenen Fachsprachen verunsichern die Betroffenen.
-
Jeder Spezialist will „sein Stück“ abbekommen und versäumt es, eine Beziehung zu den Betroffenen aufzubauen, in der sie als „ganze Menschen“ und nicht als Problemstücke wahrgenommen werden.
-
Manche Bedürfnisse werden gar nicht berücksichtigt, weil jeder Spezialist annimmt, darum kümmert sich der andere.
21.4.1 Standort der Pflegenden
Um ihre Rolle verantwortlich einnehmen zu können, muss der Standort der Pflegenden anders definiert werden, so wie es ▶ Abb. 21.3 zeigt. Im Mittelpunkt steht die kranke Person mit ihren Angehörigen. Ihnen am nächsten sind die Pflegekräfte. Die Pflegekraft ist ihre primäre professionelle Bezugsperson, die einerseits den Überblick behält über das, was mit der kranken Person und ihren Angehörigen passiert und die andererseits um die Möglichkeiten der spezialisierten Fachkräfte weiß und diese zum richtigen Zeitpunkt heranzieht. Das ähnelt der Rolle, die eine Mutter für ihr noch unterstützungsbedürftiges Kind hat, in professionalisierter Form. Eine ähnliche generalistische Funktion haben Hausärzte für ihre Kranken in der Allgemeinpraxis oder die Heilerziehungspflegenden für Menschen mit Behinderungen in den entsprechenden Einrichtungen.
Standort der Pflegenden in der Palliative Care.
Abb. 21.3
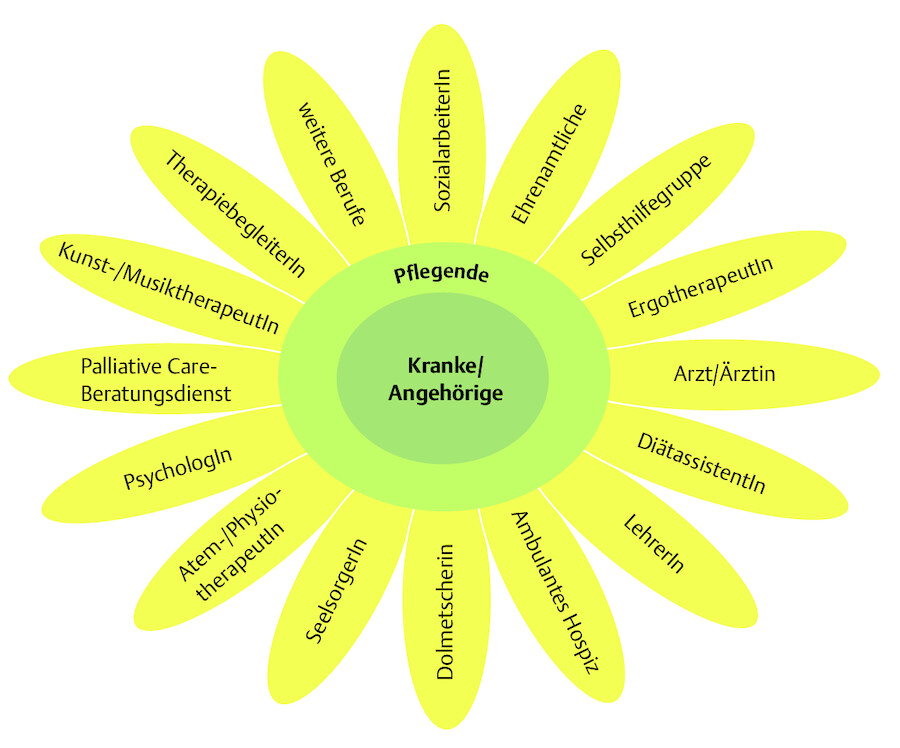
21.4.2 Entwicklung von Palliative Care
Die Entwicklung der Medizin hatte im ausgehenden 19. und insbesondere im 20. Jahrhundert das optimistische Ziel, Menschen wieder gesund zu machen, derart in den Vordergrund gerückt, dass jene, bei denen das nicht mehr zu erreichen war, weil sie zu krank oder zu alt waren, an den Rand gedrängt wurden oder gar ganz aus dem Blickfeld verschwanden. Zunächst fast unmerklich hat sich in der Mitte des vorigen Jahrhunderts eine sanfte Revolution gegen die Ausblendung von Sterben, Tod und Trauer formiert. An der Spitze der sich daraus entwickelnden Bewegung standen 2 Frauen: die englische Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin Cicely Saunders und die aus der Schweiz stammende amerikanische Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross. Beide knüpften letztlich an das an, was – insbesondere die weiblich geprägte – Heilkunst seit ihren Anfängen stets gekennzeichnet hat: die Fähigkeit, dem kranken Menschen ganz nahe zu sein und zu bleiben, auch wenn es Angst macht; die Fähigkeit, mutig ganz genau hinzusehen, auch wenn Abstoßendes zu erkennen ist, und ein tiefes Wissen darum, wie Beschwerden, insbesondere Schmerzen, zu lindern sind (Achterberg 1991).
Hospizbewegung In ihrem Bemühen um einen menschlicheren Umgang mit Sterbenden und Trauernden entwickelten sie das, was bald zu einer weltumspannenden Bewegung wurde: die Hospizbewegung. Was die beiden Gründerinnen dieser Bewegung mit auf den Weg gegeben haben, ist die enorme Lernfähigkeit und die Bereitschaft, sich ständig auf die Bedürfnisse sterbenskranker Menschen in unterschiedlichen Rahmenbedingungen flexibel einzustellen. Im Zentrum stehen dabei die Wünsche der sterbenden Menschen, die sich – orientiert an den 4 Dimensionen unseres Lebens – in 4 Gruppen zusammenfassen lassen (Student u. Zippel 1987) ( ▶ Abb. 21.4):
4 Wünsche sterbender Menschen.
Abb. 21.4
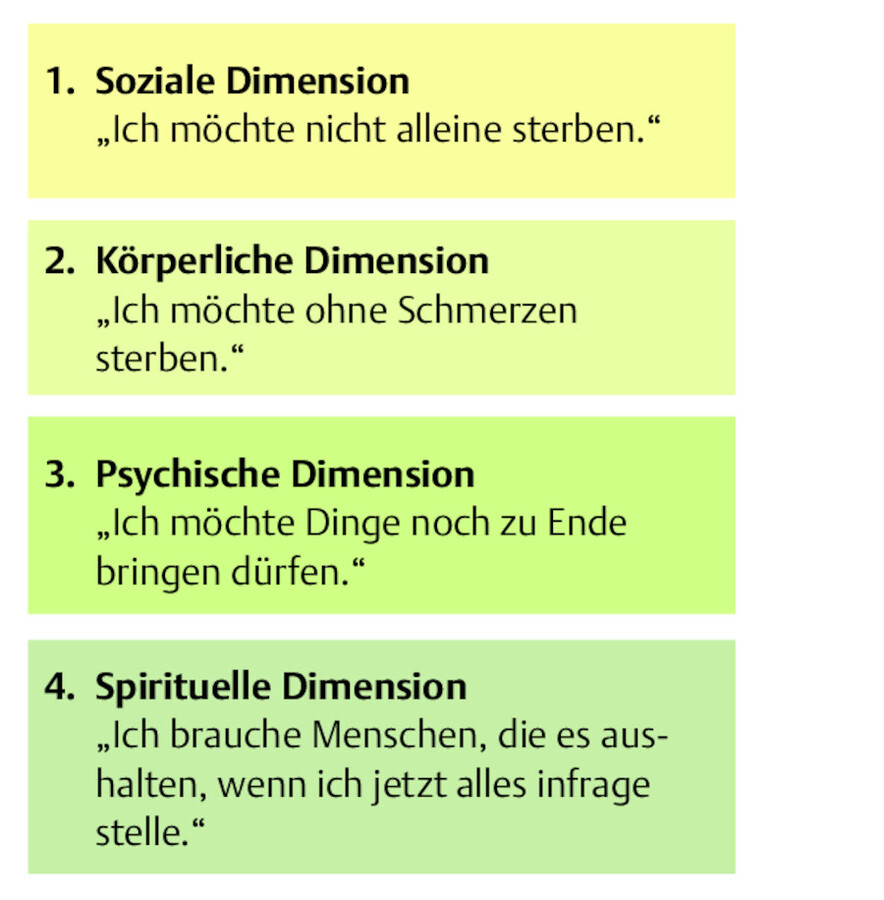
-
Soziale Dimension: „Ich möchte nicht allein sterben.“ Das bedeutet den Wunsch, im Sterben umgeben zu sein von denen, die einem nahestehen. Verbunden ist dieser Wunsch oft mit der Hoffnung, in vertrauter Umgebung, am liebsten zu Hause sterben zu dürfen, dort, wo man sich ein Leben lang geborgen gefühlt hat.
-
Körperliche Dimension: „Ich möchte ohne Schmerzen sterben.“ Dies schließt die Hoffnung ein, ohne körperliche Belastungen, aber auch ohne Entstellungen und geistige Störungen sterben zu dürfen.
-
Psychische Dimension: „Ich möchte Dinge noch zu Ende bringen dürfen.“ Es ist der Wunsch, genug Zeit und Raum zu haben, um letzte Dinge noch regeln zu können, Beziehungen klären zu können und dann schließlich loslassen zu können.
-
Spirituelle Dimension (die Frage nach dem Sinn): „Ich brauche Menschen, die es aushalten, wenn ich jetzt alles infrage stelle.“ Dieser Wunsch richtet sich an Menschen, die das „Sich-Infrage-Stellen“ aushalten können, ohne voreilige Antworten geben zu müssen oder davonzulaufen.
Es liegt nahe, dass sich all diese Wünsche am ehesten in der vertrauten Umgebung der eigenen 4 Wände realisieren lassen. So wundert es nicht, dass bei den verschiedenartigsten Umfragen 80 – 90 % aller Befragten den Wunsch äußern, zu Hause sterben zu dürfen. Deshalb realisieren sich die meisten Hospizangebote weltweit als ambulant arbeitende Dienste. Die Zeiten sind lange vorbei, in denen man mit dem Begriff „Hospiz“ zu Recht in erster Linie ein konkretes Gebäude für Sterbenskranke verband. In der Hospizarbeit entwickelte sich im aufmerksamen Begleiten von sterbenden Menschen mit ihren Angehörigen ein gemeinsames, inhaltliches Handlungskonzept, das als Palliative Care bezeichnet wird und unabhängig von einem konkreten Ort realisiert werden kann:
21.4.3 5 Kennzeichen von Palliative Care
Das Handlungskonzept lässt sich durch 5 Kennzeichen konkret fassen (Student 1999) ( ▶ Abb. 21.5).
5 Kennzeichen, die allen Hospizangeboten weltweit gemeinsam sind.
Abb. 21.5
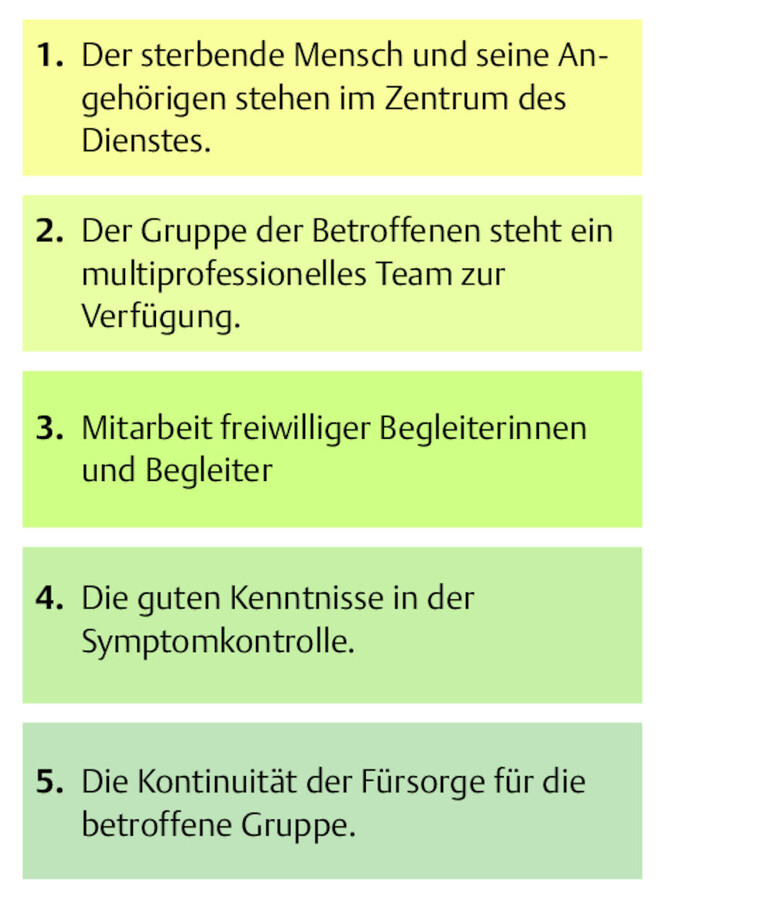
1. Kennzeichen: Der sterbende Mensch und seine Angehörigen (i. w. S.) stehen im Zentrum des Dienstes Das bedeutet, dass die Kontrolle über die Situation ganz bei den Betroffenen liegt. Das ist ein entscheidender Unterschied zu herkömmlichen Institutionen des Gesundheitswesens, die viel eher das Handeln nach abstrakten Therapiekonzepten oder Krankheitsvorstellungen ausrichten. Nicht weniger wichtig ist jedoch (und auch das ist ungewöhnlich für unser Gesundheitswesen), dass die Angehörigen in gleicher Weise mitbedacht werden in dem Wissen, dass sie oftmals mehr leiden als die sterbenden Menschen selbst.
2. Kennzeichen: Der Gruppe der Betroffenen steht ein multiprofessionelles Team zur Verfügung Das Team besteht nicht nur aus medizinischem Personal wie Pflegekräften und Arzt, sondern bezieht weitere Berufsgruppen, insbesondere Sozialarbeiter und Seelsorger, mit ein. Sterben ist keine Krankheit, sondern eine kritische Lebensphase – die allerdings oftmals mit Krankheit verbunden ist. Hieraus entstehen vielfältige Lebensbedürfnisse, denen nur durch ein multiprofessionell arbeitendes Team von Fachleuten begegnet werden kann, das hierfür ausgerüstet ist. Die Teammitglieder haben aber nicht nur Aufgaben gegenüber der betroffenen Gruppe, sondern auch untereinander. Sie sollen sich gegenseitig so unterstützen, dass sie inneres Wachstum aller Teammitglieder fördern und auf diese Weise dem Burn-out entgegenwirken.
3. Kennzeichen: Mitarbeit freiwilliger Begleiterinnen und Begleiter Die „Ehrenamtlichen“ werden in der Palliative Care nicht als Lückenbüßer missbraucht. Die freiwilligen Helfer haben ganz eigenständige Aufgaben. Sie tun Alltägliches wie Kochen, Einkaufen, Kinderhüten, Am-Bett-Sitzen, Reden, Sich–zur-Verfügung-Stellen. Aber sie tun das alles im Angesicht des Todes. Ihr Ziel ist es, Sterbebegleitung zu einem Teil alltäglicher mitmenschlicher Begegnungen zu machen und damit der Integration des Sterbens in den Alltag zu dienen, Sterbenden und Trauernden die Teilhabe an der Gesellschaft (wieder) zu ermöglichen.
4. Kennzeichen: Gute Kenntnisse in der Symptomkontrolle Hier geht es insbesondere (aber nicht nur) um die Schmerztherapie. Auf dem Gebiet der Symptomkontrolle hat die Hospizbewegung in den Jahrzehnten ihres Bestehens Bemerkenswertes geleistet und erhebliche Verbesserungen herbeigeführt. Sie hat damit der Tatsache Rechnung getragen, dass es zu den größten Ängsten sterbender Menschen gehört, z. B. unter Schmerzen, Atemnot und Verdauungsstörungen leiden zu müssen. Dabei geht es keineswegs in erster Linie um medikamentöse Maßnahmen. Solche Beschwerden betreffen stets den ganzen Menschen. Deshalb muss auch der Umgang mit ihnen alle 4 Dimensionen unserer menschlichen Existenz berücksichtigen. Hier geht es entscheidend um Lebensqualität, nicht um Lebensquantität.
5. Kennzeichen eines Hospizkonzeptes ist die Kontinuität der Fürsorge für die betroffene Gruppe Das bedeutet v. a., dass ein Hospizdienst rund um die Uhr erreichbar sein muss. Krisen im körperlichen und seelischen Bereich sind nicht an Dienstzeiten gebunden! Nicht selten fühlen sich Familien gerade in den frühen Morgenstunden oder nachts mit ihren Problemen derart alleingelassen, dass sie keinen anderen Ausweg mehr wissen, als einer Einweisung der Sterbenden in die Klinik zuzustimmen. Dem kann ein Palliative-Care-Dienst, der rund um die Uhr erreichbar ist, oftmals schon mit geringem Aufwand per Telefon entgegenwirken. Kontinuität der Fürsorge hat aber noch einen weiteren Aspekt: Sie bedeutet, dass die Begleitung einer Familie nicht mit dem Tod eines Angehörigen beendet wird. Gerade diejenige Person des Teams, die besonders enge Kontakte zur Familie hatte, sollte den Hinterbliebenen auch in der Zeit der Trauer weiterhin zur Verfügung stehen. Trauer ist eine besonders krankheitsbelastete Phase des Lebens. Gute Trauerbegleitung kann die gesundheitlichen Risiken mindern und dazu beitragen, dass die Hinterbliebenen ohne zusätzliche körperliche und seelische Schäden die Zeit nach dem Tod eines Menschen überstehen.
Palliative Care heißt also nicht weniger pflegerischer Einsatz, sondern im Gegenteil, Pflege mit höherem Aufwand, mit größerer Intensität – wenngleich mit neuen, mit den kranken Menschen sorgsam abgestimmten Zielen! Wenn Pflegende hier Missstände wahrnehmen, hat es sich bewährt, wenn sie in diesen Fällen mehrere Personen auf der nächsten Hierarchieebene gleichzeitig und schriftlich ansprechen.
21.4.4 Wer erhält wo Palliative Care?
In Deutschland realisiert sich Palliative Care bislang in erster Linie in folgenden Spezialinstitutionen:
-
ambulant tätige Palliative-Care-Dienste:
-
ambulante Hospizdienste, Palliative-Care-Beratungsdienste und spezialisierte ambulante Palliativ-Versorgung (SAPV gem. § 37 b SGB V)
-
-
stationäre Palliative-Care-Angebote:
-
stationäre Hospize als kleine, unabhängige Betteneinheiten unter pflegerischer Leitung mit speziell geschulten Pflegekräften
-
Palliativstationen als Palliative-Care-Spezialstationen innerhalb von Krankenhäusern
-
Die Zahl der Palliative-Care-Angebote ist in Deutschland in den letzten 20 Jahren gestiegen. Zurzeit (2016) gibt es nach Angaben der entsprechenden Fachgesellschaften ca. 1500 ambulante Palliative-Care-Angebote und rund 539 stationäre Einrichtungen der Hospiz- und Palliativ-Versorgung. In den letzten Jahren hat v.a. die stationäre palliative Begleitung zugenommen. Das Krankenhaus stellt mit über 50% den häufigsten Sterbeort dar. Nur jeder 4. stirbt zu Hause. Dies entspricht nicht dem Wunsch der Betroffenen, die möglichst daheim in vertrauter Umgebung sterben möchten. Daraus ergibt sich, dass die ambulante Begleitung gestärkt werden muss.
Die entscheidende Frage ist also, wie auch diesen sterbenskranken Menschen ein angemessenes Palliative-Care-Angebot gemacht werden kann.
Palliative-Care-Beratungs-Teams Um innerhalb einer Institution den Palliative-Care-Gedanken intensiv zu verbreiten und möglichst vielen schwer kranken Menschen zugute kommen zu lassen, hat sich das aus dem angelsächsischen Bereich stammende Konzept der Palliative-Care-Beratungs-Teams bewährt (Keay u. Schonwetter 1998). Darunter versteht man ein Team von speziell im Bereich der Palliative Care geschulten und erfahrenen Pflegekräften, die andere Dienste und die Betroffenen beraten: Sie leiten die Angehörigen ebenso wie die Pflegedienste dabei an, mit schwerwiegenden Symptomen kundig umzugehen und vermitteln damit nachhaltige Lernerfahrungen.
Palliative Care für Menschen mit nichtonkologischen Erkrankungen In Deutschland wird Palliative Care in erster Linie als Angebot Menschen mit Krebs vorbehalten. Tatsächlich aber stirbt die Mehrzahl der Menschen an nichtonkologischen Erkrankungen (NOE) wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nieren-, Leber- und Lungenerkrankungen; also Erkrankungen des höheren Alters. Die Ausweitung des Palliative-Care-Angebotes auf diese Betroffenengruppe ist dadurch erschwert, das die Einschätzung der Lebensprognose bei Menschen mit NOE nicht so leicht „intuitiv“ möglich ist wie bei onkologischen Erkrankungen. Das Maß des palliativen Bedarfs erscheint weniger gesichert. Dem könnte abgeholfen werden, wenn auch in Deutschland die in den USA erarbeiteten Prognosemarker (Student u. Napiwotzky 2011) stärker beachtet würden. Dann würde es leichterfallen, das in der Hospizarbeit erworbene Wissen auch für Menschen mit NOE verfügbar zu machen.
Lebensphase Kind
Hospizarbeit
Palliative Care kann in jeder Lebensphase, in jedem Lebensalter sinnvoll sein. In der Kinder- und Jugendhospizarbeit steht die Entlastung der Familie im Vordergrund, da die lebensbegrenzende Erkrankung häufig viele Jahre besteht. Eine frühe Kontaktaufnahme zu den Hospizberatungsdiensten hilft, die Lebensqualität der Kranken und ihrer Familien zu erhöhen.
21.4.5 Dialog-Leitfaden für die Kranken und ihre Angehörigen
Palliative Care ist mittlerweile keineswegs nur ein Konzept der liebevoll-fürsorglichen Betreuung von Menschen am Lebensende. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO 2002) betont, profitieren Kranke und ihre Angehörigen von Palliative Care bereits zu einem frühen Zeitpunkt ihrer lebensbedrohlichen Erkrankung, wenn durchaus noch Heilungschancen gesehen werden können und eine kurative Therapie durchgeführt wird.
Der Dialog-Leitfaden (2015) gibt Kranken und ihren Angehörigen eine Orientierung bei aufkommenden Fragen. So früh wie möglich sollte dieser Flyer übergeben werden. Er stärkt die Betroffenen in ihrer Entscheidungsfähigkeit. Den Dialog-Leitfaden können Sie über die Elisabeth-Kübler-Ross-Akademie (www.hospiz-stuttgart.de/akademie.html; Stand 25.11.2016) oder die Themenwelt Pflegepädagogik (www.thieme.de/de/pflegepaedagogik/lehrbuecher-95961.htm; Stand 25.11.2016) abrufen.
Merke
Eine Pflege auf der Basis einer Beziehung, eine fürsorgliche Haltung der Pflegenden sollte nicht auf schwer kranke und sterbende Menschen beschränkt bleiben. Wichtig ist, dass Pflegende ihre Zuständigkeit, ihren Standort erkennen und einnehmen. Das gegenwärtige Interesse an der Palliative Care sollte genutzt werden, eine palliative Haltung von Pflegenden als grundsätzliche berufliche Aufgabe zu verankern und auch finanziell zu ermöglichen.
21.5 Begleitung Sterbender
21.5.1 Besonderheiten der Kommunikation
Voraussetzung einer individuellen und patientenorientierten Betreuung in den letzten Lebenstagen ist das Kennenlernen von Patienten und Angehörigen. Das bedeutet,
-
das Gespräch zu suchen und Gesprächsbereitschaft zu signalisieren,
-
Patienten und Angehörigen von ihrer Lebens- und Krankheitserfahrung erzählen zu lassen,
-
die Haltung des Gegenübers zu akzeptieren und
-
eine Beziehung nicht durch allgemeines, abstraktes Wissen, auf alle Beteiligten gleichermaßen umgesetzt, unpersönlich und distanziert erleben zu lassen.
Praxistipp
Kommunikation in der Sterbephase ist eine originäre Pflegetätigkeit und wesentliche Pflegeintervention.
21.5.1.1 Symbolsprache
Während der Begleitung Kranker und Sterbender ist es möglich, dass die Betroffenen über Träume und Halluzinationen berichten.
Definition
Eine Halluzination ist eine Wahrnehmung einzelner bzw. mehrerer Sinne, ohne dass ein Außenreiz vorhanden ist. Für den Halluzinierenden hat sie Realitätscharakter oder kann von realen Wahrnehmungen nicht unterschieden werden.
So kann sich der Kranke die Frage stellen: „Habe ich wirklich einen schwarzen Raben an meinem Fußende sitzen gesehen?“ In diesem Dialog gilt es sehr einfühlsam und äußerst behutsam auf den Patienten einzugehen.
Begegnen wir einem Menschen, der sich uns gegenüber in einer Symbolsprache mitteilen will, reagieren wir unter Umständen irritiert.
Fallbeispiel
Der sonst sehr zurückhaltende, doppelseitig unterschenkelamputierte alte Herr fordert Gesundheits- und Krankenpflegerin Maria Pflüger im Nachtdienst mit barschem Ton auf, ihm den schwarzen Anzug und das weiße Hemd rauszulegen. Auch die guten Schuhe soll sie ihm bereitstellen. Trotz ihrer Bedenken zur Desorientiertheit legt sie ihm schließlich die Sachen zurecht. Im ruhig verlaufenden Nachtdienst findet die Pflegende den Mann in der letzten Runde am frühen Morgen tot im Bett.
An diesem Beispiel kann die äußerst komplexe und anspruchsvolle Aufgabe einer Kommunikation mit Sterbenden deutlich werden. Mitten im Trubel des Alltags, ohne Vorbereitung unter oft unwirklich erscheinenden Bedingungen ist eine kommunikative Kompetenz der ruhigen Akzeptanz gefordert.
Reisemotiv Ein weiteres Beispiel für Symbolsprache ist das Reisemotiv, ein bei Sterbenden häufig vorkommendes Symbol (Sitzmann 1998c). Trotz der schweren Erkrankung und des schlechten Zustands äußert der Betroffene plötzlich den Wunsch, auf eine Reise zu gehen, und bestellt Reisekataloge oder lässt sich den Koffer packen. Vermutlich befindet sich der Sterbende bereits in der Phase des „Loslassens“, der Ablösung von Familie und Freunden.
21.5.1.2 Abschied gestalten
Wünsche von Patienten, noch mal von Orten, Angehörigen und Freunden individuell Abschied nehmen zu können, werden immer wieder von Pflegenden aus der Sterbebegleitung geschildert. Eine Einrichtung des Arbeiter-Samariter-Bunds Ruhr ermöglicht es schwerstkranken Menschen jeden Alters, letzte Lebenswünsche zu erfüllen. Der speziell ausgestattete Wünschewagen, ein optimierter Krankentransportwagen, fährt an besondere Orte oder z.B. zu Familienfeiern (Wanke 2016).
21.5.2 An Sinneswahrnehmungen und Symptomen orientierte pflegerische Interventionen
Sinneswahrnehmung Wenn ein Mensch stirbt, stellen sich Pflegende und Angehörige oft die Frage: „Was geschieht während des Sterbens und was nimmt der Sterbende wahr?“ Darauf lässt sich keine allgemeingültige Antwort geben, der Weg des Sterbens ist für jeden Menschen sehr persönlich. Sterbende nehmen in der terminalen Phase durch ein verstärktes Feingefühl oft sehr sensibel und intensiv ihre Umgebung wahr.
Definition
In der terminalen Phase (Finalphase) ist der Patient sehr schwach, zumeist bettlägerig, für lange Perioden schläfrig mit stark limitierter Konzentrationszeit. Es besteht zunehmendes Desinteresse an Nahrung und Flüssigkeit.
Rudolf Steiner, Begründer der Anthroposophie, teilte Wahrnehmung und Sinne in verschiedene Bereiche ein. Seine Ansichten entsprechen modernen Erkenntnissen der Physiologie und beschreiben verschiedene, sehr sensible und intensive Wahrnehmungen:
-
physische Wahrnehmungen (z. B. Lebenssinn: „Ich fühle mich wohl“, Gleichgewichts-, Tast-, Bewegungs- und Lagesinn)
-
sensuelle (emotionale) Wahrnehmungen (d. h. Sinne, die das Gefühlsleben berühren, z. B. Seh-, Geschmacks-, Geruchs- und Wärmesinn)
-
soziale Wahrnehmung (d. h. auf das Geistige gerichtete Sinne, z. B. Hör-, Sprach- oder Wortsinn, die Wahrnehmung eines gesprochenen Lautes, die Wahrnehmung des vom anderen mitgeteilten Gedankens und ein Sinn, der als Ich-Sinn bezeichnet wird, wenn wir fühlen, dass ein „Ich“ hinter dem Gesprochenen steht)
Für den Aufbau einer zwischenmenschlichen Beziehung ist auch das Wahrnehmen nonverbaler Mitteilungen wie Körperhaltung, Gesichtsausdruck, Finger- und Handbewegung wichtig (Sitzmann 1995).
21.5.2.1 Veränderung der physischen Wahrnehmung
Tastsinn
Symptome Krankheits-, schmerz-, schwäche- oder bewusstseinsbedingte Bewegungslosigkeit und Reizabschwächung (Habituation) führen dazu, dass Menschen ihren Körper nicht mehr spüren („Ich fühle meinen Rücken nicht mehr“).
Pflegerische Intervention Manchmal hilft dem Sterbenden eine sanfte Berührung, vielleicht möchte er gehalten werden ( ▶ Abb. 21.6). Zu anderen Zeiten wünscht er, nicht berührt zu werden. Bei der Körperpflege und bei äußeren Anwendungen (z. B. Einreibungen) werden die Gliedmaßen in bewussten, ruhig geführten Aktionen bewegt. Das Ausstreichen von Händen und Füßen löst Verspannungen. Hilfreich sind oft geringe Veränderungen der Position.
Berührungen sind wichtig, auch wenn der Patient keine wahrnehmbare Reaktion mehr zeigt.
Abb. 21.6
(Foto: K. Oborny, Thieme)

Praxistipp
Achten Sie darauf, dass Sie bei körperlichem Kontakt den Patienten bewusst berühren. Sie können über die Sinnesempfindung ein Erlebnis von Schutz und menschlicher Wärme vermitteln.
Vielfach können Sterbende, aber auch demente Personen, in der nonverbalen Kommunikation, z. B. mit einem Therapiehund (Sitzmann 2007a), Beruhigung, Wärme, Angenommensein, Geborgenheit und Zärtlichkeit erleben.
Aktivierende Pflege In der unterschiedlich langen Sterbephase kommt es darauf an, nicht in eine passiv abwartende Haltung zu geraten. Eine derartige Haltung reduziert Gesprächsthemen auf Krankheiten. Kleidung wird nur noch selten gewechselt, der Patient liegt ständig im Bett, obwohl er noch mobilisiert werden könnte. Der Lebenssinn verkümmert.
Praxistipp
Das Wohlbefinden eines Menschen kann gesteigert werden, wenn man ihm z. B. ermöglicht, sein gewohntes gepflegtes Äußeres durch regelmäßiges Haarewaschen oder -schneiden zu erhalten. Seelisch kräftigend wirkt Lob. Körperlicher Schwäche kann neben medizinischen Hilfen mitunter durch aktivierende Pflege und Physiotherapie entgegengewirkt werden.
Oft besteht die Auffassung, dass der Patient v. a. Ruhe braucht. Übliche pflegerische Maßnahmen werden nicht mehr ausgeführt, da man sie als Belastung für den Sterbenden ansieht. Eine solche eingeschränkte Sichtweise führt zu einer ebenfalls eingeschränkten Pflege. Sie fördert Sekundärschäden wie Druckgeschwüre.
Wichtig ist, sich zu fragen: Was nützt dem Patienten und womit fügen wir ihm Schaden zu? Gemeinsame Zielvereinbarungen können z. B. verhindern, dass durch regelmäßige Veränderungen der Position ein Sterbender einen Dekubitus erleidet. Andererseits resultieren aus dem fortwährenden Drehen zum Schutz vor Wundliegen bei einem Menschen mit Knochenmetastasen massive Schmerzen. In diesem Fall würde die Prophylaxe eher schaden als nutzen.
Merke
Sterbende haben ein hohes Dekubitusrisiko. Oft ist trotz der Durchführung sorgfältigster Prophylaxemaßnahmen ein Dekubitus nicht vermeidbar.
21.5.2.2 Veränderung der sensuellen Wahrnehmung
Geschmacks- und Geruchssinn
Die Essgewohnheiten des Sterbenden ändern sich. Das Bedürfnis zu essen und zu trinken ist meist sehr gering. Er weist es oft ab. Nicht mehr essen und trinken zu können stellt jedoch für manche Patienten, besonders aber die Angehörigen, eine unmittelbare Bedrohung für das Leben dar. Zwangsernährung ist unbedingt abzulehnen, die Basisbetreuung in der Sterbephase, die für jeden Menschen gewährleistet sein muss, umfasst nicht die Verpflichtung zur Ernährung, sondern das „Stillen von Hunger und Durst“.
Symptome Oft schmeckt nichts mehr, auch wenn zunächst der Wunsch nach einer bestimmten Speise oder einem Getränk geäußert wurde. Zunächst wird Flüssiges fester Nahrung vorgezogen. Auf Gerüche, z. B. den Geruch exulzerierender Wunden, können Sterbende sehr sensibel reagieren. Auch kaum wahrnehmbare Speisegerüche oder Duftstoffe können Widerwillen oder Übelkeit hervorrufen.
Pflegerische Interventionen Trinken kann sich anregend auf die Funktion des Geschmacks- und Geruchssinns auswirken ( ▶ Abb. 21.7). Andererseits kann das Durstgefühl fehlen. Sehr erfrischend wirkt sich eine im Zimmer aufgeschnittene Zitrone aus, der Duft wird meist als angenehm und erfrischend erlebt. Es empfiehlt sich, dass Begleiter sorgfältig beobachten, ob der Patient auf Düfte von Duftlampen oder ätherischen Ölen bei der Körperpflege mit An- oder Entspannung reagiert. Es sollte nur so viel Nahrung gegeben werden, wie der Sterbende will. Es kann auch angebracht sein, kleine Häppchen der Lieblingsspeise anzubieten, die nach Kauen und Schmecken wieder ausgespuckt werden dürfen.
Dem Patienten sollte immer wieder etwas zu trinken angeboten werden.
Abb. 21.7
(Foto: P. Blåfield, Thieme)

Aspekte zur Flüssigkeitsgabe bei Sterbenden Auch professionelle Betreuer können keine Antwort auf die Frage geben, ob sterbende Menschen mehr oder weniger Flüssigkeit brauchen. Oft wird Flüssigkeit aus dem Bedürfnis heraus infundiert, den Betroffenen nicht verdursten zu lassen. Trotzdem sollten vor der ▶ subkutanen Infusion bei Sterbenden grundsätzliche Überlegungen angestellt werden:
-
Wer wünscht die Infusion?
-
Warum?
-
Was sind die Vorteile und Risiken für den Sterbenden?
-
Wann wird die Flüssigkeitszufuhr mit Subkutantherapie in Betracht gezogen?
-
Ist die Dehydratation die Folge einer Krise, einer Komplikation (z. B. Diarrhö) oder ist es der Beginn des Sterbeprozesses?
Merke
In Fachkreisen wird kontrovers diskutiert, ob und inwiefern Menschen in der Terminalphase von einer künstlichen Flüssigkeitszufuhr profitieren. Bislang gibt es keine Evidenz für einen positiven Effekt (Sitzmann 2007b).
Der Sterbende sollte selbst entscheiden dürfen, wann und wie viel er isst oder trinkt (Sitzmann 2007b).
Bei der Mehrzahl der sterbenden Patienten liegt eine Dehydratation vor. Doch kann das bewusste und rechtzeitige Reduzieren von Infusionen (terminale Dehydratation) ermöglichen, die bei den meisten Sterbenden auftretende, atemsynchrone terminale Rasselatmung zu vermindern. Es ist eine edukative Aufgabe von Pflegenden, den Angehörigen die Angst vor der geräuschvollen Rasselatmung zu nehmen. Sie befürchten, dass der Sterbende an der vermehrten Sekret- und Schleimproduktion ersticken könnte.
Es ist bislang unklar, ob die für Angehörige und Betreuer oft sehr belastende Rasselatmung vom Sterbenden überhaupt wahrgenommen wird.
Mundtrockenheit
Mundtrockenheit kann medikamenteninduziert und/oder durch die typische Mundatmung bedingt auftreten.
Pflegerische Interventionen Um eine Austrocknung zu verhindern, ist eine kompetente Mundpflege und kreative Munderfrischung angebracht. Die Mundpflege ist möglichst nach jeder Mahlzeit sowie nach den Bedürfnissen und Gewohnheiten des Patienten mehrmals täglich durchzuführen.
Nicht der zu dokumentierende Befund steht im Vordergrund, sondern das individuelle Wohlbefinden des Sterbenden. Auch für Angehörige ist es wichtig zu wissen, dass der Sterbende bei nachlassender Flüssigkeitsaufnahme nicht verdurstet. Mit sorgsamer, einfallsreicher Mundpflege und -erfrischung kann Mundtrockenheit deutlich gelindert und das individuelle Wohlbefinden des Sterbenden verbessert werden. Angehörige lassen sich in diese Aufgabe gut einbinden, es ist entlastend für sie, wenn sie für den Sterbenden etwas tun können, vor allem dann, wenn das Ernähren nicht mehr möglich ist:
-
sorgfältige und häufige Mundpflege
-
minimale Flüssigkeitsmengen sprühen oder pipettieren
-
Lieblingsgetränk (Apfelsaft, Bier, Sekt) in Eiswürfelbeutel einfrieren: Achten Sie auf die Reaktion des Patienten, kaltes Wasser oder stark säurehaltige Obstsäfte können wegen der Kälte oder Geschmacksintensität als zu intensiv erlebt werden.
-
Warmer Tee, ein kleines mundgerechtes Stück frisches Obst oder auch gedämpftes Gemüse können, in ein Mullsäckchen eingewickelt, belebend auf die Speichelsekretion wirken. Achten Sie dabei darauf, dass bei der Gabe das Mullsäckchen gut festgehalten wird, damit sich der Sterbende nicht daran verschluckt!
Lippenpflege Welches Produkt für die Lippenpflege bei aufgesprungenen Lippen, Rhagaden, Ulzerationen, Schwellungen und Rötungen am besten ist, kann nicht allgemein gesagt werden. Wichtig bei der Auswahl der Lippenpflege ist, dass diese für eine ausreichende Befettung der Lippen sorgt. Pflanzliches Wachs wie Sheabutter oder Öle wie Jojoba- oder Aprikosenkernöl eignen sich z.B. gut, da sie den hauteigenen Fetten in ihrer Struktur sehr ähnlich sind. Auch Olivenbutter oder Bienenwachs werden empfohlen, keinesfalls jedoch mineralölhaltige Produkte. Sie fördern einen Gewöhnungseffekt.
Sehen
Symptome Auch die Farbwahrnehmung des sterbenden Menschen wird intensiver. Kunsttherapeuten berichten, dass Farben, die der Gesunde wegen ihrer Zartheit kaum noch sehen kann, vom Sterbenden als unerträglich intensiv erlebt werden.
Pflegerische Interventionen Blumen und Pflanzen, die der Sterbende ja vielleicht nie wieder in der Natur sehen wird, können erfreuen. Das Fenster, und wenn es auch nur ein Stückchen Himmel oder ein Hausdach zeigt, sollte sich im Blickfeld des Liegenden befinden. Je nach Wunsch können Bilder in der Nähe des Bettes platziert werden, z. B. ein lieb gewordenes Gemälde, ein religiöses Motiv oder das Bild eines geliebten Menschen.
Wärme empfinden
Wärme spielt eine wichtige Rolle, da meist die eigene Wärmeproduktion abnimmt. Eine natürliche Folge des Sterbeprozesses ist, dass der Kreislauf sich immer mehr auf die lebenswichtigen Organe beschränkt. Aufgrund der mangelnden Kreislauffunktion hat der Sterbende – sofern er nicht hohes Fieber hat – kalte Füße und Finger, sein ganzer Körper fühlt sich kühler an. Ist der Mensch von Wärme umgeben, entwickelt er Vertrauen und fühlt sich geborgen.
Pflegerische Interventionen Durch Einreibung mit warmen Händen (z. B. mit Lavendelöl), warme Socken und eine zusätzliche leichte Decke kann der Körper warm gehalten werden. Erstreckt sich die Zentralisation des Kreislaufs über längere Zeit, sorgen ein warmes Fußbad im Bett oder Hand- und Armbäder für eine Durchwärmung des Körpers und können so eine beruhigende Wirkung ausüben. Schwitzt der Patient, ist eine dünne Decke oder ein Leinentuch angenehmer.
Praxistipp
Anstelle von kaltem Wasser sollte lieber warmer Tee gegeben werden. Es ist sinnvoll, immer eine Thermoskanne mit warmem Tee auf dem Nachttisch bereit zu haben.
21.5.2.3 Veränderung der sozialen Wahrnehmung
Aufrichtigkeit ist wichtig
Ganz deutlich erleben Schwerkranke und Sterbende unsere Wahrhaftigkeit oder Unwahrhaftigkeit. Aufrichtigkeit ist gefordert, wenn der auf den Tod Zugehende fragt, wie lange er noch zu leben hat, oder schildert, wie er sich seine Begleitung vorstellt und welche Wünsche er nach dem Todeseintritt hat.
Die in ein Gespräch einfließende Mitteilung über das bevorstehende Sterben ist für den Todkranken vielfach eine Erlösung. Sicher können Augenblicke danach erschütternd sein, aber es kann auch der Zwang weichen, am Leben festhalten zu müssen. Sorgen erscheinen weniger bedrückend und eine Entspannung kann einsetzen. Oft weiß der Patient auch selbst, dass er dicht vor dem Tode steht. Er ist feinfühliger als in gesunden Tagen und weiß die Zeichen seiner Umgebung auch ohne Worte zu deuten. Seltener durch Worte, viel öfter in Symbol- oder Traumsprache (Sitzmann 1998c), teilt er uns mit, was er über seinen Zustand weiß oder ahnt.
Praxistipp
Andeutungen des Patienten zu Todesahnungen mit Redewendungen wie „Das dürfen Sie jetzt aber nicht denken, Sie werden bestimmt wieder gesund“ abzuwehren, machen ihn einsam, da er sich unverstanden fühlt.
Hannich (1996) berichtet über das Erleben komatöser Patienten: „Nach dem Aufwachen aus der Bewusstlosigkeit waren die ersten Äußerungen der Patientin zur Pflegeperson: ,Sie sprachen mit mir. Die anderen, sie dachten, ich sei dick und hässlich. Dass ich tot sei. Nicht hören könnte. Nicht Sie. Sie sprachen und ich hörte. ‘“
Das Gespräch mit sterbenden Menschen muss geübt werden. Unsere eigenen Gedanken und Vorstellungen dürfen das Gehörte nicht prägen. Wir sollen nicht über und für den Sterbenden denken, sondern mit ihm. Keiner außer dem Sterbenden kann wirklich wissen, wie er sich fühlt.
Hör- und Wortsinn
Die „Sprache der Sterbenden“ umfasst eine Vielzahl verbaler und nonverbaler Kommunikationsformen. Hierzu ist weniger die bestimmte Technik einer Gesprächsmethode erforderlich als vielmehr, aktives Zuhören zu üben.
Pflegerische Interventionen Eine Voraussetzung besteht in der Fähigkeit zum Schweigen, in unserer kommunikativen Welt eine schwer auszuhaltende Form zwischenmenschlicher Verständigung. Zuhören, Anhören, Hinhören ist aufmerksame Anteilnahme. Im Gespräch sollte die Pflegende mit eigenen Worten wiedergeben, was sie vom anderen gehört hat, und somit noch einmal aussprechen, was der andere meint (Spiegelung). Wer über das Sterben, den Lebensinhalt und Lebenssinn nichts sagen kann, sollte es auch nicht tun.
Praxistipp
Zur nonverbalen Kommunikation gehört ein Kontakt, der die unmittelbare Nähe zum Sterbenden erfordert, keineswegs sollte man an der Tür stehen – mit der Klinke in der Hand – oder am Fußende des Bettes.
Meist wird der Grad der Ansprechbarkeit auf äußere Reize als Hinweis für die Bewusstseinslage des Patienten genommen. Wir dürfen auf keinen Fall aus der Tatsache, dass er nicht „reagiert“, schließen, er könne nichts mehr wahrnehmen. Er nimmt mehr wahr, als wir von außen vermuten. Insbesondere hören sehr schwache und bewusstseinseingeschränkte Menschen durchaus länger, als es ihnen gelingt zu sprechen. Flüstern in seiner Umgebung lässt den Sterbenden sich ausgeschlossen fühlen.
Merke
Der Hörsinn des Sterbenden ist meist sehr fein ausgeprägt, er ist der letzte Sinn, der schwindet.
Bewusstsein und Orientierung
Der sterbende Mensch verliert das Zeitgefühl und den Bezug zur Realität, schläft tagsüber und ist nachts wach, erkennt anwesende Personen evtl. nicht mehr. Die Augen sind ganz oder halb geschlossen und die Hände tasten unruhig über die Bettdecke. Er zupft an den Betttüchern, macht ziellose Armbewegungen, schüttelt die Finger ohne ersichtlichen Grund usw.
Praxistipp
Für Sie oder die Angehörigen als Begleiter sind Phasen der Erholung wichtig. Als Sterbebegleiter kommen wir an die Grenzen der Belastbarkeit. Sie sollten das Zimmer immer wieder verlassen, um Kraft zu sammeln und sich mit anderen auszutauschen.
Bewusstseinseintrübung Obwohl manche Sterbende bis zuletzt wach und orientiert bleiben, ist doch oft durch Organversagen ein Eintrüben des Bewusstseins bis zum Koma zu beobachten. Der Patient
-
kann sich nicht mehr so lange konzentrieren,
-
wirkt schläfrig, dann wieder besonders leicht irritierbar,
-
schläft viel; die letzte Zeit vor dem Tode gleicht einem tiefschlaf- oder ohnmachtsähnlichen Zustand.
Das Stadium der Bewusstseinseintrübung schwankt erheblich: Menschen, die schon seit Tagen im Koma liegen, werden in seltenen Fällen sogar noch einmal wach und sind fähig, noch ein paar Worte zu sagen. Manche Menschen mit Demenz werden Tage oder Stunden vor dem Sterben auffallend klar. Bei zunehmender Bewusstseinstrübung wirkt der Sterbende dann wie im Tiefschlaf. Es gelingt immer weniger, ihn aufzuwecken, bis er schließlich im Koma liegt und nicht mehr aufzuwecken ist.
Merke
Bewusstlose Menschen sollen mit dem Respekt behandelt werden, der ihnen auch im Wachen geschuldet wird (Artikel 1 GG „Die Würde des Menschen ist unantastbar“).
Pflegerische Interventionen Wenn Pflegende, Angehörige, Freunde und Nachbarn ruhig am Bett des Sterbenden sitzen, vermitteln sie ihm, dass er nicht allein ist ( ▶ Abb. 21.8). Das wirkt beruhigend. Starke Unruhe ist evtl. dadurch bedingt, dass der Sterbende nicht gut liegt, Blase oder Darm entleeren möchte, aber zu schwach ist oder sich schämt, das auszusprechen.
Kontakt.
Abb. 21.8 Angehörigen sollte ein Kontakt in unmittelbarer Nähe zum Patienten ermöglicht werden.
(Foto: A. Fischer, Thieme)

Praxistipp
Kann niemand längerfristig bei dem Sterbenden bleiben, versuchen Sie immer wieder, auch kurzfristig, Signale Ihrer Begleitung zu geben. Halten Sie ihm die Hand, sprechen Sie ihn an, auch wenn Sie keine wahrnehmbare Reaktion erleben. Das bedarf des Mutes, vielleicht haben Sie das Gefühl: „Es missfällt mir, so gesehen zu werden – am Bett sitzend, händehaltend.“ Bedenken Sie, was für Sie selbst beim eigenen Sterben wichtig wäre.
Die Pflegende kann Nähe zum Sterbenden aufbauen, indem sie sich fragt: „Wer ist er?“, „Wo ist er?“, „Was will er?“. Oder noch konkreter: „Was ist seine Frage?“, „Was beschäftigt ihn?“.
Merke
Was sich in der letzten Lebensphase des sterbenden Menschen um ihn ereignet, kann sich für den Begleiter entweder als belastendes und oft schwer zu überwindendes Trauma manifestieren oder als heilende Quelle für den anschließenden Trauerprozess entwickeln (Knipping 2007).
21.5.3 Phasen des Sterbens
Jeder Mensch durchläuft den letzten Abschnitt seines Lebens auf seine eigene Weise. Dennoch lassen sich aufgrund vieler Gespräche mit Sterbenden typische Abfolgen erkennen. Menschliche Reaktionen auf Leiden sind sehr ähnlich und in der Grundsicherheit erschütternd. Elisabeth Kübler-Ross hat als Erste die Phasen des Sterbens erforscht. Sie beobachtete, dass sich die Gemütsverfassung Sterbender schrittweise ändert und dabei typische Stadien durchläuft.
Der psychische Sterbeprozess vollzieht sich nach Elisabeth Kübler-Ross (2011) in 5 Phasen, auf die Pflegende auf unterschiedliche Weise reagieren können ( ▶ Tab. 21.2 ).
|
Kennzeichen |
Was kann man als Begleiter tun? |
|
1. Phase: Nicht-wahrhaben-Wollen |
|
|
Hoffnung auf Genesung und Angst streiten vor dem Sterben miteinander. |
|
|
2. Phase: Zorn, Auflehnung, Depression, Protest |
|
|
Dies zeigt sich u. a. in aggressivem, wütendem Verhalten gegenüber Angehörigen und Helfern. |
|
|
3. Phase: Verhandeln mit dem Schicksal |
|
|
Eine vorübergehende Besserung oder Verlangsamung des Krankheitsverlaufs wird dazu benutzt, Pläne zu machen. Es wird versucht, mithilfe hoch spezialisierter Ärzte, religiöser Gelübde o.Ä. dem drohenden Schicksal zu entrinnen oder dieses herauszuzögern. |
|
|
4. Phase: Depression |
|
|
Auf die Enttäuschung der Hoffnung folgt oft eine schwere Depression mit Traurigkeit, vielleicht Schuldgefühlen wegen begangener „Fehler“, Vereinsamung und großem Bedürfnis nach Kontakt und Nähe eines verständnisvollen Menschen. |
|
|
5. Phase: innere Ruhe |
|
|
Es kann dazu kommen, dass der Sterbende zu innerer Ruhe findet, den Tod annimmt und die unabwendbare Realität bejaht. |
|
Merke
Das Phasenmodell des Sterbens darf keineswegs als starre Abfolge von Phasen verstanden werden. Die Individualität des Menschen ist in seiner letzten Lebensphase besonders ausgeprägt. Die Phasen können übersprungen werden, sich wiederholen und/oder überschneiden.
21.5.4 Körperliche Symptome des Sterbens
Die körperlichen Symptome des Sterbens sind sehr vielfältig. Die Agonie als Multiorganversagen wird als „Schwerstarbeit“ empfunden, die Symptome können sich ständig ändern ( ▶ Tab. 21.3 ).
|
Körperliche Zeichen |
Mögliche pflegerische Interventionen |
|
Veränderung der Atmung |
|
|
|
|
evtl. Schmerzen |
|
|
|
|
reduzierte Körpertemperatur |
|
|
|
|
Blutdruck und Puls |
|
|
|
|
Orientierung |
|
|
|
|
Bewusstsein |
|
|
|
|
Schleimhaut |
|
|
|
|
Haut |
|
|
|
Definition
Als Agonie (griech. „Qual, Kampf“) wird ein sich über wenige Minuten bis hin zu mehreren Stunden erstreckender Todeskampf bezeichnet. Er ist begleitet von Erscheinungen, die das allmähliche Erlöschen der Nerventätigkeit anzeigen und dem unmittelbaren Todeseintritt vorausgehen.
21.5.4.1 Aspekte zur Rasselatmung
Die geräuschvolle Rasselatmung in den letzten Lebenstagen oder -stunden kann für die Angehörigen und Pflegenden eine schwere Belastung darstellen. Berichtet wird, dass es ihnen nur schwer gelingt, die geräuschvolle, rasselnde Atmung des Sterbenden zu vergessen.
Praxistipp
Eine wesentliche pflegerische Aufgabe ist es, Angehörigen die körperliche Veränderung zu erläutern. Es soll auch versucht werden, ihnen die Angst zu nehmen, dass der ihnen Nahestehende „qualvoll erstickt“ sei.
Pflegerische Interventionen Die pathophysiologische Begründung der Rasselatmung liegt im Unvermögen des Patienten, in den letzten Lebenstagen das produzierte Atemwegssekret oder den sich ansammelnden Speichel wie üblich zu schlucken oder abzuhusten. Neben einer positionsverändernden Lagerung, z. B. einer leichten Oberkörperhochlagerung mit unterstützten Armen und leicht abgesenktem Fußende, kann eine Medikamentengabe erwogen werden. Hilfreich sind evtl. Diuretika oder eine die bronchiale Schleim- und Sekretproduktion reduzierende Anticholinergikagabe, z. B. Buscopan. Die Applikation von Sauerstoff erscheint hier nicht angebracht. Psychologisch entlastend kann ein in niedriger Drehzahl eingestellter (Hand-)Ventilator wirken sowie ein möglichst weit geöffnetes Fenster mit frischer Luft. Nur wenn unvermeidlich ist bei Behinderung der Atmung das Absaugen des Mundes und des oberen Atemtraktes angebracht. Tieferes endotracheales Absaugen erhöht das Leid des Sterbenden durch die Reizungen und evtl. Verletzung der Schleimhaut sowie weiterer Anregung der Schleimproduktion.
21.5.4.2 Aspekte zur Dyspnoe
Atemnot in der Sterbephase kann sehr vielschichtig begründet sein. Wichtig ist hier, rechtzeitig und differenziert zu erfassen, ob pathophysiologische Ursachen medizinischer Komplikationen vorliegen (z. B. Pneumonie, Sepsis, Pleuraerguss, Herzinsuffizienz) oder im Zusammenhang mit Angst, Trauer, Unruhe oder Panik stehen.
Pflegerische Interventionen Die Reaktion auf eine beobachtete Dyspnoe in der Sterbephase darf nicht automatisch die Gabe von Sauerstoff sein. Sauerstoff sollte als Medikament betrachtet werden, das nur bei entsprechender Indikation eingesetzt wird (Simon u. Müller-Busch 2011). Vielfach ist zur Behandlung einer Dyspnoe in der Sterbephase ärztlich verordnetes Morphin das wichtigste und wirksamste Medikament. Es wird damit eine Toleranzerhöhung des Atemzentrums beim Anstieg des arteriellen CO2-Partialdruckes erreicht. Durch Abnahme der Atemfrequenz kommt es zu einer verbesserten Ausnutzung (Ökonomisierung) der angestrengten Atmung.
21.5.4.3 Der Tod
Als klinischer Tod wird der völlige Kreislaufstillstand mit Fehlen von Puls, Herzaktion und Atmung erlebt, nach etwa 20 Sekunden schwinden Hörvermögen und Bewusstsein ( ▶ Tab. 21.4 ). Wenige Minuten nach dem Kreislaufstillstand kommt es zur Lähmung, der Sterbende lässt die Hand los, sie kann aber noch zucken. Der klinisch Tote ist für einige Minuten durch Reanimation wiederbelebungsfähig (Wiederbelebungszeit). In dieser Reanimationszeit sind Nahtoderlebnisse und Tastempfindungen möglich. Danach führt der durch den Kreislaufstillstand hervorgerufene Sauerstoffmangel (Hypoxie in den Geweben des Körpers) unweigerlich zu irreversiblen Schäden.
|
sichere Todeszeichen |
unsichere Todeszeichen |
|
frühe Veränderungen:
späte Veränderungen:
|
|
21.5.5 Grenzbereiche Sterben und Tod
Das Thema „Sterben“ wirft einige Fragen auf, die sehr persönlich geprägt sind und dennoch gesellschaftlich diskutiert werden. Dazu gehören Nahtoderfahrung, Auseinandersetzung mit Sterbehilfe, Hirntod und Organtransplantation.
21.5.5.1 Nahtoderfahrung
Nahtoderlebnisse oder „Out-of-body-Erfahrungen“ schildern Menschen, die ganz nah an der Schwelle des Todes gestanden haben, z.B. während einer Operation, nach einem Verkehrsunfall oder in einem Zustand kurz vor dem Ertrinken (van Lommel 2013). Sie treten auf in einem Zeitfenster, wo sie für klinisch tot befunden wurden oder während der Reanimation. Die Erlebnisse können sehr verschieden sein. Manche Betroffenen berichten von Momenten, in denen sie ein helles Licht sehen, auf andere strömen Erinnerungen ein, ein Gefühl von Freude und Hoffnung, eine Rückschau auf ihr Leben oder sie fühlen sich losgelöst von ihrem Körper. Seltener werden negative Erfahrungen wie Angst- und Panikzustände geschildert.
Weiterleben nach der Nahtoderfahrung Als Auswirkung lässt sich nach einer Nahtoderfahrung häufig eine starke Veränderung der Lebensgestaltung beobachten. Die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross veröffentlichte in ihrem Buch „Interviews mit Sterbenden“ 1969 erstmals derartige Berichte.
Normalerweise beginnt das Gehirn 20–30 Sekunden nach Aussetzen des Herzschlages seine Funktion einzustellen. Wahrnehmung und Bewusstsein der befragten Personen haben sich jedoch über eine längere Zeit erstreckt, deutlich über den Herzstillstand hinaus. So findet es durchaus seine Berechtigung, folgende Fragen zu stellen:
-
Wann beginnt eigentlich der Tod?
-
Was ist der Tod?
-
Kann man den Tod klar definieren, im Sinne von: Hier ist eine Grenze, und wer diese überschreitet, der kommt nicht wieder?
-
Ist die Grenze zwischen Leben und Tod eher fließend?
-
Was passiert mit den Menschen, mit ihren Seelen und mit dem „Ich“ nach dem Tod?
Die Antworten auf diese Fragen werden natürlich sehr unterschiedlich ausfallen, je nach religiöser Orientierung oder je nachdem, welche Lebensphilosophie ein Mensch vertritt.
Praxistipp
Wichtig ist, dass Pflegende sich mit solchen Erfahrungen auseinandersetzen und Betroffene darüber berichten dürfen, damit sie mit dieser emotionalen Erfahrung zurechtkommen können; in unserer Anteilnahme können sie Beruhigung und Frieden finden.
21.5.5.2 Auseinandersetzung mit Sterbebegleitung und Sterbehilfe
Pflegende sind an der Debatte über Sterbehilfe oder Sterbebegleitung beteiligt, denn pflegerisches Handeln ist in gesellschaftliche Wertehaltungen eingebunden. Wichtiges Kriterium zur Unterscheidung ist das Motiv des Handelnden.
Definition
Unter Sterbebegleitung (Sterbebeistand) versteht man die bestmögliche Hilfestellung beim Sterben. Sie ist eine kontinuierliche Begleitung des Sterbenden, die über Wochen und Monate dauern kann. Demgegenüber ist deutlich der Begriff Sterbehilfe ( ▶ Tab. 21.5 ) abzugrenzen.
|
Differenzierung der Begrifflichkeiten |
|
|
1. Tötung auf Verlangen |
|
|
Definition: gezielte Tötung; Ziel der Handlung ist Lebensverkürzung durch Tötung des Patienten. |
|
|
Motiv |
|
|
Problem |
|
|
2. Indirekte Sterbehilfe (Therapien am Lebensende) |
|
|
Definition: im Ausnahmefall unbeabsichtigte, aber als unvermeidliche Nebenfolge in Kauf genommene Beschleunigung des Todeseintrittes durch medikamentöse Therapie (z.B. bei Schmerzen, Atemnot oder palliativer Sedierung als Symptomlinderung). |
|
|
Motiv |
|
|
Problem |
|
|
Konsequenz |
|
|
3. Sterbebegleitung |
|
|
Definition: pflegerischer Beistand bei Sterbenden mit Unterstützung bei Durst, Schmerzen, Übelkeit, Angst |
|
|
Motiv |
|
|
Konsequenz |
|
|
4. Behandlungsabbruch = Sterbenlassen |
|
|
Definition: Verzicht auf technisch mögliche Lebens- und Leidensverlängerung, die nicht (mehr) indiziert sind oder für die keine Einwilligung (mehr) besteht. |
|
|
Motiv |
|
|
Problem |
|
|
Konsequenz |
|
|
5. Beihilfe zum Suizid |
|
|
Definition: Hilfe zur Selbsttötung, z. B. durch Beschaffen entsprechender Medikamente. Eigentliche Tötungshandlung erfolgt durch den Patienten (Selbsttötungswilligen) selbst. |
|
|
Motiv |
|
|
Problem |
|
|
Konsequenz |
|
Definition
Der heute in Deutschland gebräuchliche Ausdruck der Sterbehilfe leitet sich ursprünglich her aus dem Wort Euthanasie (aus dem altgriechischen: „eu“ = schön, angenehm; „thanatos“ = Tod). Man verstand darunter einen leichten Tod ohne große Schmerzen, ohne verzweifelten Todeskampf, also eine würdige Bewältigung des Sterbens. Der Begriff Euthanasie ist in Deutschland, bedingt durch die missbräuchliche Nutzung in der NS-Zeit für das Tötungsprogramm Behinderter und Kranker, negativ belegt und durch den Begriff der Sterbehilfe ersetzt worden.
21.5.5.3 Hirntod und Organtransplantation
Die Möglichkeiten der Transplantationsmedizin eröffnen vielen Schwerkranken neue Perspektiven. Um Organe transplantieren zu können, muss bei einem Sterbenden (z. B. durch Schlaganfall, Vergiftung, Unfall) vorab der Hirntod festgestellt werden. Neben der Lebendspende können Organe hirntot erklärter Menschen das Leben anderer retten. Der Begriff „Hirntod“ wurde nach den weltweit ersten Herztransplantationen 1968 formuliert.
Definition
Der Hirntod wird entsprechend naturwissenschaftlich-medizinischer Kriterien definiert als der vollständige und irreversible Ausfall aller Hirnfunktionen bei noch aufrechterhaltener Kreislauffunktion im übrigen Körper, d. h., das Herz schlägt noch. Dabei wird der Patient kontrolliert beatmet. Der Tod wird nach Prüfung einer Reihe neurologisch-klinischer und apparativer Untersuchungen festgestellt.
Hoffnung der Kranken Tausende von Menschen stehen auf den Wartelisten der Transplantationszentren und hoffen auf ein neues Organ, das ihnen das Weiterleben mit neuer Lebensqualität ermöglichen soll.
Problem aus Sicht der Gesunden Vielen Menschen fällt es schwer, sich zu Lebzeiten mit dem Thema Organspende und damit auch mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Hilfreich wäre es, wenn jeder das Selbstbestimmungsrecht für oder gegen die Organspende in Anspruch nehmen würde und seine Entscheidung kundtut. Wer diese Entscheidung für sich selbst trifft, erspart Angehörigen und Mitarbeitern des Krankenhauses erhebliche Belastungen.
Fallbeispiel
In diesem Zusammenhang wird häufig der Fall des „Erlanger Babys“ zitiert, in dem bei einer in der 15. Woche schwangeren Frau 1992 nach einem schweren Verkehrsunfall der Hirntod festgestellt wurde. In der Hoffnung, den Fötus Monate später gesund zur Welt zu bringen, wurde die Frau weiter lebenserhaltend therapiert. 5 Wochen nach dem diagnostizierten Hirntod führte jedoch eine Infektion zum Ende der Schwangerschaft.
Doch bereits 1991 wurde eine 33-jährige Patientin mit der gleichen Symptomatik in der Filderklinik (Bavastro 1994) behandelt. Sie war bei ihrem Zusammenbrechen aus nicht geklärter Ursache in einer Stuttgarter Parkanlage in der 17. Woche schwanger. Nach 84 Behandlungstagen wurde die als hirntot erklärte Mutter von ihrem Kind in der 29. Schwangerschaftswoche wegen Uteruskontraktionen durch Kaiserschnitt entbunden. Es entwickelte sich vollkommen normal. Die Frau überlebte noch 2 Tage und starb im Beisein ihres Mannes. Der Ehemann bekräftigte während der gesamten intensivmedizinischen Behandlung den Wunsch, dass die Schwangerschaft weitergeführt werden solle.
Probleme aus Sicht der Pflegenden Für Pflegende ist es oft schwer, hirntote Patienten zu pflegen, bis die Organe entnommen werden. Sie pflegen den Körper, der mithilfe des Beatmungsgerätes weiteratmet, leeren Urinbeutel und infundieren Flüssigkeit. Reize beim Absaugen oder bei der Mundpflege können Hirnstammreflexe des Patienten auslösen, er gähnt – und wirkt so lebendig. Sie ertappen sich dabei, dass sie den Patienten weiter informieren, ihn ansprechen – aber hört er diese Worte? Ist er wirklich tot oder ist noch etwas von ihm da? Wenn man einen hirntoten Patienten pflegt, ist es wichtig, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
21.5.6 Bedeutung und Bräuche in verschiedenen Konfessionen
Die Nähe des Todes ist für viele Menschen, jedoch keineswegs für alle, der Moment, über religiöse Themen zu sprechen. Vielen Menschen ist es wichtig, religiös geprägte Handlungen und Rituale zu praktizieren oder religiöse Vorschriften einzuhalten.
Praxistipp
Religiöse Symbole wie Kreuz oder Rosenkranz und religiöse Rituale wie Krankensalbung und Kommunion dürfen dem Sterbenden nicht aufgedrängt werden, können aber Gläubigen Trost spenden.
Nachfolgend werden Beispiele für die Gestaltung religiöser Praxis in der Sterbebegleitung geschildert. Sind Pflegende über die kulturellen Bedürfnisse und persönlichen Einstellungen des Patienten informiert, wirkt sich das positiv auf die Pflege am Lebensende aus.
21.5.6.1 Römisch-katholische Kirche
Was bedeutet der Tod? Nach der Auferstehung wird der Mensch in einen neuen, heilen Menschen, zu neuem Leben in Vollendung, Unverweslichkeit, Kraft, Freude und Gemeinschaft verwandelt (1. Kor. 15,42 – 43) „Er, Christus, wird unseren hinfälligen Leib seinem verherrlichten Leibe gleich gestalten“ (Phil. 3,21).
Religiöse Vorschriften/Bräuche Auf Wunsch sollen ernstlich Kranke die Krankensalbung erhalten (Kranken- und Heilsakrament). Erhofft wird, dass sich die geistige innere Erneuerung (zum Ritus der Krankensalbung gehört auch die Vergebung von Schuld) durch innere Ruhe und Gelassenheit positiv auf das Gesamtbefinden auswirkt. Beichtgespräch und/oder Kommunion im Angesicht des Todes gelten als Wegzehrung (Sterbesakrament). Bei Neugeborenen kann in Lebensgefahr jeder die Nottaufe übernehmen.
Anforderungen an die Pflege Der Seelsorger sollte möglichst frühzeitig benachrichtigt und Patienten und Angehörigen vorgestellt werden. Nach Eintritt des Todes sollte der Seelsorger nur nach Absprache mit den Angehörigen gerufen werden.
Gebete Die wichtigsten Gebete sind in der Bibel enthalten. Weiteres findet sich im katholischen Gebet- und Gesangbuch „Gotteslob“.
21.5.6.2 Protestantische Kirche
Was bedeutet der Tod? Die Haltung zum Tod ist stark durch die persönliche Einstellung geprägt. Nach dem Tod wird der Mensch auferweckt (Jüngstes Gericht). Gott wird durch den Tod hindurch das, was er selbst schon im irdischen Leben geschaffen hat, vollenden, d. h. den Toten selbst zur Vollendung führen. Das Wichtigste wird die volle Gemeinschaft mit Gott sein „...ihn sehen, wie er ist“ (1. Joh. 3,2).
Religiöse Vorschriften/Bräuche Im Protestantismus werden Rituale jedweder Art abgelehnt, wobei die Haltung dazu gespalten ist. Auf Wunsch feiert der Pfarrer das Abendmahl mit dem Sterbenden, das den Charakter eines Geleits zum Sterben bekommen kann.
Anforderungen an die Pflege Menschliche Anteilnahme und Nähe stehen im Vordergrund der Pflege. Es sollte entsprechend der Bedürfnisse des Sterbenden gehandelt werden. Eventuell können dem Sterbenden vertraute Bibelabschnitte oder Kirchenlieder vorgelesen oder vorgesungen werden: z. B. Psalm 23 („Der Herr ist mein Hirte“ in verschiedenen Übersetzungsvarianten, das Lied „So nimm denn meine Hände“, das Glaubensbekenntnis oder das „Vaterunser“. Im Internet können Sie die entsprechenden Texte finden. So z.B. unter: www.kirchenkreis-aachen.de. Nach dem Tod sollen Angehörige im Sterbezimmer Abschied nehmen können. Falls die Angehörigen es wünschen, Verbindung zum Gemeindepfarrer ermöglichen, um Bestattung besprechen zu können.
Gebete Die wichtigsten Gebete sind in der Bibel und im Evangelischen Gesangbuch enthalten.
21.5.6.3 Orthodoxe Kirche
Dazu gehören die russisch-, griechisch-, serbisch-, syrisch-, orientalisch- und koptisch-orthodoxe Kirche. Sie sind einig im Glauben, dass Christus Gott und Erlöser ist. Die kirchliche Lehre fußt auf Bibel und Tradition. Zur Lehre der römisch-katholischen Kirche bestehen Unterschiede. Bilder (Ikonen) sind irdische Verkörperungen der himmlischen Welt. Wichtigstes Buch ist die Bibel.
Religiöse Vorschriften/Bräuche Der orthodoxe Glaube verpflichtet zu einem engen familiären Zusammenhalt. Das hat zur Folge, dass Angehörige z. B. selbst die Körperpflege ausführen oder das Essen reichen wollen.
Anforderungen an die Pflege Angehörige und ggf. die Glaubensgemeinschaft sollten verständigt werden. Ein Priester wird gerufen, um zu beichten, die Krankensalbung und die Kommunion zu erhalten. Das Aufstellen einer Ikone spendet Trost. Nach Eintritt des Todes Seelsorger nach Absprache mit den Angehörigen rufen.
Gebete Gebete sind u.a. auf der Internetseite der bulgarisch-orthodoxen Kirchengemeinde zu finden (www.bulgarische-kirche.de; Stand 17.11.16).
21.5.6.4 Jehovas Zeugen
Was bedeutet der Tod? Gottes Wort lehrt, dass wir selbst, mit all unseren physischen und geistigen Fähigkeiten, die Seele sind. Die Seele des Menschen (der Mensch selbst) lebt nach seinem Tod nicht weiter. Aufgrund der Hoffnung auf eine Auferstehung ist Trost gegeben. Wichtigstes Buch ist die Bibel.
Religiöse Vorschriften/Bräuche Für einen im Sterben Liegenden bedarf es keinerlei Zeremonien. Meist wird seelischer Beistand im Familien- und Freundeskreis gewünscht. Der Glaube an die Auferstehung ist die tragende Kraft in der Sterbestunde.
Anforderungen an die Pflege Zeugen Jehovas erwarten, dass auch im Sterben ihr Glaube respektiert wird. Die Organspende ist eine persönliche Entscheidung des Einzelnen (Rudtke 2013). Es wird nur eine fremdblutfreie Therapie akzeptiert. Kinder, denen gegen den Willen ihrer Eltern Bluttransfusionen verabreicht wurden, erfahren Trost und Zuwendung innerhalb ihrer Familie und in der Glaubensgemeinschaft. Besuche von Geistlichen anderer Religionsgemeinschaften werden nicht gewünscht.
Maßnahmen nach Eintritt des Todes Die Glaubens- und Gewissensfreiheit nach Art. 4 GG ist von großer Bedeutung, Zeugen Jehovas entscheiden sich individuell für oder gegen eine Obduktion.
Gebete und Glaubensansichten Informationen zu Gebeten und Glaubensansichten finden Sie unter: www.jw.org/de/publikationen; Stand 17.11.2016.
21.5.6.5 Christengemeinschaft
Was bedeutet der Tod? Das Ich (individueller Geist) kehrt in die geistige Welt zurück, um auf der Basis seiner Erfahrungen des vergangenen Erdenlebens das Schicksal für ein Leben nach neuer Wiedergeburt vorzubereiten. In der Zeit lebt der Verstorbene im ruhigen Rückblick auf sein Erdenleben, bis auch diese Bilder verdämmern und die seelische Verarbeitung beginnt.
Religiöse Vorschriften/Bräuche Der sterbende Mensch wird sorgfältig begleitet: Beichtgespräch, Kommunion und Letzte Ölung können den Tod würdig vorbereiten, Aussegnung und Bestattungsfeier leiten die Seele aus dem Leibe in die Geisteswelt. Die Menschenweihehandlung bezieht die Verstorbenen in den Kreis der versammelten Gemeinde ein. Die Bestattungsfeier ist nicht an die Mitgliedschaft gebunden.
Anforderungen an die Pflege Pflegende sollten versuchen, die bildhafte Sprache des Sterbenden zu verstehen. Ruhig brennende Kerzen, duftende Blumen und Vorlesen aus dem Evangelium geben die nötige Unterstützung. Unmittelbar nach Eintritt des Todes lebt die Seele noch in einem gewissen Zusammenhang mit dem Leib. Kontakt mit Angehörigen und Seelsorger wird aufgenommen, evtl. eine 3-tägige Aufbahrung ermöglicht. Es erfolgt eine Aussegnung am Ort der Aufbahrung, evtl. auch erst unmittelbar vor der Bestattung/Kremation.
Gebete Das wichtigste Buch ist das Neue Testament, wichtigste Gebete sind das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser. Informationen zur Christengemeinschaft finden Sie unter: www.christengemeinschaft.org/; Stand 17.11.2016.
21.5.6.6 Judentum
Juden glauben an Gott als Schöpfer. Der Gesetzestext der Juden ist in der Thora (Pentateuch) niedergeschrieben. Die Ankunft des Messias wird als Heilsbringer erwartet.
Religiöse Vorschriften/Bräuche Das religiöse Judentum ist in sich äußerst vielgestaltig und reicht von der Orthodoxie über das konservative Judentum bis hin zu liberalen und reformierten Gläubigen. Da man nicht wissen kann, wann der Tod an einen herantritt, lehrt der Talmud, so zu leben, dass man jeden Augenblick mit gutem Gewissen für einen und ohne Schande für andere sterben könnte. Den Mitmenschen obliegt die ethische und „heilige“ Pflicht des Krankenbesuchs („Bikkur cholim“) als Ausdruck der Nächstenliebe. Jede praktische Hilfe in der Einhaltung der Speisegesetze und der Achtung des Sabbat wird hoch geschätzt und ist auch von psychischem Wert. Familie, jüdische Gemeinde, Rabbiner geben Auskunft über Vorschriften und konkrete Unterstützungsmöglichkeit.
Es ist verboten, dem Todkranken die Wahrheit über seinen Zustand zu verheimlichen, ansonsten beraubt man ihn einer Vorbereitung auf den Tod und der Versöhnung mit einem Mitmenschen.
Pflegemaßnahmen nach Eintritt des Todes Es gibt (z. T. abergläubisch fundierte) Bräuche beim Eintritt des Todes: z. B. alle Spiegel im Trauerhaus zu verhängen und alle stehenden Wasser auszuschütten. Der Familie soll Gelegenheit zur Totenwache gegeben werden. Dem Verstorbenen werden die Augen geschlossen, da der Tod dem Schlaf entspricht. In Anlehnung an 1. Mose 46,4 führt diese Handlung der älteste Sohn durch. Die Hände des Verstorbenen müssen seitlich am Körper anliegen (nicht auf der Brust gekreuzt oder gefaltet). Für orthodox praktizierende Juden gilt, dass Nichtjuden den Körper eines gestorbenen Juden nicht berühren dürfen. Das progressive Judentum akzeptiert, dass diese Regel bei Ärzten und Pflegepersonen nicht berücksichtigt werden kann.
Gebete Das Kaddisch ist eines der wichtigsten Gebete im Judentum. Es ist ein Heiligungsgebet und wird außerdem zum Totengedenken gesprochen. Weitere Gebete finden Sie unter: http://www.hagalil.com/judentum/gebet/sidur.htm (Stand 1.11.2016).
21.5.6.7 Islam
Der Islam ist nicht allein eine Religion, sondern zugleich ein in sich geschlossenes, für Muslime verbindliches rechtlich-politisches Wertesystem. Als politische Religion fasst er Glaube und Staat zusammen. Er gründet auf dem Koran, der für die Gläubigen das unverfälschte Wort Gottes ist und in Übereinstimmung mit der Tradition des Propheten Mohammed steht.
Das nachfolgende Fallbeispiel zeigt eindrücklich die Sterbebegleitung bei einem muslimischen Patienten auf, wie sie in einem Hospiz in Berlin stattgefunden hat.
Fallbeispiel
Martina Vollbrecht
Ein Sterben
Es ist Dienstag 21.45 Uhr. Wir übernehmen den Patienten Herrn E. Er ist Jahrgang 1964, verheiratet, getrennt lebend, 4 Kinder, 2 in Deutschland, 2 aus erster Ehe in seiner Heimat lebend. Er ist groß und schlank und kommt mit der Diagnose Bronchialkarzinom. Bisher hat er es allein in seiner Wohnung geschafft. Nun wird er immer schwächer. Die Atemnot nimmt täglich zu. Er schafft es nicht mehr allein. Jemand anderes ist wohl nicht da.
Seit dem Morgen ist er bei uns, bekommt Sauerstoff, sein Arzt sagt, er habe mit allen ihm noch verbliebenen Kräften ausgehalten, wollte zu Hause sterben. Nun geht es schnell. Der Atem rasselt in seinen Bronchien. Er sitzt aufrecht im Bett, seine Augen suchen, uns? Hilfe? Gott?
Er bittet um den Toilettenstuhl, wir helfen ihm, werden dann weggeschickt. Es ist undenkbar, dass er sich von uns 2 Pflegenden bei diesen Verrichtungen helfen lässt. Er braucht Zeit. Schafft es und dann dürfen wir ihm wieder ins Bett helfen.
Nun bittet er um Hilfe. Schaut uns an, reicht uns seine Hände, ruft Allah, Allah.
Wir wissen, wir müssen uns an die muslimischen Regeln halten. Die Kollegin ruft in der nächstgelegenen Moschee an, bekommt einige Verhaltenshinweise. Wir überlegen, wie wir sie am besten umsetzen.
Wir dürfen ihn nach seinem Tod nicht mehr berühren, allenfalls mit Handschuhen. Er soll auf dem Rücken liegen, den Kopf nach rechts in Richtung Mekka gedreht haben.
Und nur Muslime, seine eigene Familie, der Imam dürfen die dann vorgesehenen Verrichtungen ausführen.
Da er trotz des Sauerstoffs weiter nach Luft ringt, seine Augen angstvoll geweitet, bekommt er Morphin gespritzt. Er wird ruhiger. Niemand soll unter seinen Symptomen leiden, ein wichtiger Punkt des Hospizkonzeptes. Wir sind meist bei ihm, in seinem Zimmer und die Tür bleibt offen, wenn wir zwischendurch beide an anderem Ort gefragt sind.
Gegen 0.15 Uhr ruft er, möchte aufstehen, wir helfen ihm, an jeder Seite eine. Er steht auf, was eigentlich schon gar nicht mehr geht, beugt sich dann nieder, kniet, legt den Kopf auf die Hände und verharrt in dieser Haltung, betet, ein paar Minuten noch … Dann dreht er den Kopf nach rechts und stirbt. Es ist 0.40 Uhr.
Der Körper entspannt sich, liegt auf dem Fußboden, bäuchlings. Wir sind unglaublich berührt von diesem tapferen, starken, zutiefst gläubigen Menschen.
Ziehen uns Handschuhe an, legen eine Matratze auf den Fußboden, tun das, was jetzt getan werden muss – demütig – still.
Und dann liegt er, keine 5 Minuten später, so wie der Imam es uns sagte, auf dem Rücken, sein Kopf schaut ganz von selbst nach rechts. Ein leises Lächeln auf dem Gesicht.
Gott verbindet.
Was bedeutet der Tod? Der Tod gehört zum Leben. Gott gibt das Leben und nimmt es auch wieder. Der Tod trennt die Seele vom Körper. Die Seele kommt vor das Jüngste Gericht. Der gläubige Moslem, der sich seines Todes gewiss ist, bereitet sich durch das Gebet auf seinen Tod vor, er legt Rechenschaft über sein Leben ab und will im Angesicht des Todes „rein“ werden. Für die Angehörigen ist es die letzte Möglichkeit, dem Sterbenden die Ehre zu erweisen und von ihm Vergebung für das zu erhalten, was sie ihm angetan haben.
Religiöse Vorschriften/Bräuche Pflichtgebete sind nicht eine Zwiesprache zwischen dem Geschöpf und seinem Schöpfer, sondern ein Akt der Ergebenheit. Beim Essen gilt: ▶ nichts vom Schwein, keinen Alkohol. Krankenbesuche gehören zu den heiligen Pflichten eines gläubigen Muslims, der Besucher tut damit etwas Gutes und dem Kranken wird Ehre und Beistand gewährt. Je mehr Besucher, desto größer die Ehre! Der Tod wird in Gegenwart anderer, auch des Sterbenden, i. d. R. eher nicht erwähnt. Daher wird dem Sterbenden sein nahes Ende nicht mitgeteilt. Jüngere Generationen weichen z.T. davon ab.
Anforderungen an die Pflege Äußere Sauberkeit (Kontinenz, Bettwäsche) ist Symbol für innere Sauberkeit: Alles, was mit Urin und Exkrementen in Berührung gekommen ist, muss penibel sauber gewaschen werden (Hände des Patienten, der Pflegenden, Utensilien, Wäsche u. a.). Sorgen Sie für eine vorbildliche Mundpflege. ▶ Ein Moslem akzeptiert zum Waschen nur fließendes Wasser, auch abgekochtes Wasser wird als reinigend gebilligt. Das Schamgefühl ist untrennbar mit der Ehrbarkeit verbunden. Es ist verboten, das andere Geschlecht nackt zu sehen, auch wenn der Mensch bereits tot ist. Die Pflege der Frauen durch Männer ist verboten (insbesondere bei älteren Patientinnen), der Arzt ist von dieser Regelung ausgenommen.
Pflegemaßnahmen nach Eintritt des Todes Tote Muslime dürfen i. d. R. nicht von „Ungläubigen“ (Nichtmuslimen) berührt werden. Sollte das nicht zu verhindern sein, sollten sie auf jeden Fall Schutzhandschuhe tragen, um direkten Kontakt mit der bloßen Haut zu verhindern! Die Augen werden vom nächsten Angehörigen geschlossen. Das Waschritual ist klar vorgeschrieben (männliche Verstorbene von Männern, weibliche Verstorbene von Frauen).
Weitere Maßnahmen sind: Lesen im Koran, bis der Tod eingetreten ist (Glaubensbekenntnis), evtl. mit Tonträger, das Fenster öffnen („öffne das Fenster, damit die Seele den Weg nach draußen findet“), den Verstorbenen betten (Arme an der Körperseite, Kopf nach rechts und Gesicht nach Südosten – Mekka – wenden), eine Kerze anzünden, eine würdige und angemessene Atmosphäre schaffen. Gebote des Islam finden Sie im u.a. im Internet unter: http://www.islam.de/27.php; Stand 17.11.2016.
Entsprechend der jeweiligen islamischen Rechtsschule trauern Muslime auf unterschiedliche Weise. Entweder übt man Zurückhaltung und verbirgt Trauer, andere Muslime trauern mit lautstarken Klagen. Anteilnahme jedoch ist religiöse Pflicht.
Immer häufiger lassen sich in Deutschland verstorbene Muslime auch hier begraben. In Berlin besteht seit 2011 keine Sargpflicht mehr, ein Muslim darf auf dem islamischen Teil eines Friedhofs in ein Tuch gehüllt beerdigt werden.
21.5.7 Pflege nach Eintritt des Todes (Exitus)
Nach Eintritt des Todes verändert sich der Körper des Verstorbenen und zur Beurteilung können sichere von unsicheren Todeszeichen abgegrenzt werden ( ▶ Tab. 21.4 ).
21.5.7.1 Pflegemaßnahmen im Krankenhaus
Dokumentation und Information
Todeseintritt dokumentieren Der Tod wird mit genauer Uhrzeit in der Patientendokumentation eingetragen. Je nach hausinterner Regelung werden der zuständige Arzt, die pflegerische Leitung der Abteilung o. a. benachrichtigt.
Todesbescheinigung ausstellen Der Arzt hat unverzüglich nach Erhalt der Nachricht über den Todesfall die Untersuchung des Verstorbenen vorzunehmen. Die Todesbescheinigung darf erst nach persönlicher Untersuchung ausgestellt werden. Grundsätzlich sollen dabei, neben der Feststellung des sicheren Todes anhand mindestens eines sicheren Todeszeichens ( ▶ Tab. 21.4 ), Todeszeit, Todesart (natürlich oder unnatürlich), die zum Tode führenden Erkrankungen und die Todesursache dokumentiert werden. Die Vorschrift, die Leichenschau unverzüglich durchzuführen, hat den Sinn, bei Scheintod noch Reanimationsmaßnahmen veranlassen zu können.
Angehörige informieren Mit dem Arzt wird abgesprochen, wer die Angehörigen benachrichtigt.
Versorgung des Gestorbenen
Praxistipp
Nach dem Eintritt des Todes können die letzten Pflegemaßnahmen in Ruhe ausgeführt werden. Sie können auch, unmittelbar nachdem der Patient gestorben ist, kurz innehalten. Vielleicht denken Sie an den Verstorbenen und seine Angehörigen, sprechen ein Gebet oder einen Spruch aus. Sie können mit den versorgenden Arbeiten 30 – 60 Min. warten.
Materialien entsorgen Es wird alles entfernt, was nicht mehr benötigt wird: technische Geräte, Sonden, Katheter, Infusionen, Kissen, Decken, Hilfsmittel zur Lagerung, Bettseitenschutz, Patientenruf, Utensilien aus dem Nachttisch. Decken Sie Wunden flüssigkeitsdicht ab, wechseln Sie evtl. den Stomabeutel.
Waschung Die Aussage „Jeder Verstorbene muss gewaschen werden“ ist falsch. Abhängig davon, wie die letzte Lebensphase ablief, wird der Verstorbene gewaschen und eine Intimpflege durchgeführt:
-
Hat der Patient in der Sterbephase stark geschwitzt?
-
Sind Spuren der Reanimation zu beseitigen?
-
Hat er Urin oder Stuhl ausgeschieden?
-
Hat er erbrochen?
Die Haare werden gekämmt und ggf. eine Zahnprothese eingesetzt. Falls erforderlich, sind die Augenlider mit feuchten Tupfern geschlossen zu halten.
Praxistipp
Angehörige werden, wenn sie es wünschen, in die Maßnahmen miteinbezogen. Vielleicht haben Angehörige den Wunsch, sich mit diesem letzten Dienst von dem Verstorbenen zu verabschieden (Sitzmann 2005c).
Lagerung Verstorbene werden i. d. R. flach auf dem Rücken gelagert. Aus hygienischen Gründen sollte kein Federkissen unterliegen, eine Packung Zellstoff in einem Kopfkissenbezug genügt, damit der Kopf korrekt liegt. Um den Unterkiefer zu stützen, sollte möglichst keine feuchte Binde um den Kopf gelegt werden, sie führt zu strangulationsähnlichen Malen an Hals und Wangen. Besser ist es, nur das Kinn mit einer Plastikkinnstütze ( ▶ Abb. 21.9) oder mit einer Zellstoffrolle so zu stützen, dass der Mund geschlossen bleibt. Die Kinnstütze kann mit einer Mullbinde um den Hals leicht fixiert werden. Ein Identifikationsetikett wird an einem Fuß des Verstorbenen angebracht. Er wird mit einem frischen Laken zugedeckt und zwar so, dass das Gesicht frei ist und die Arme mit übereinandergelegten oder gefalteten Händen über der Brust liegen.
Kinnstütze für Verstorbene.
Abb. 21.9 Plastikkinnstützen sind über den Fachhandel zu beziehen.
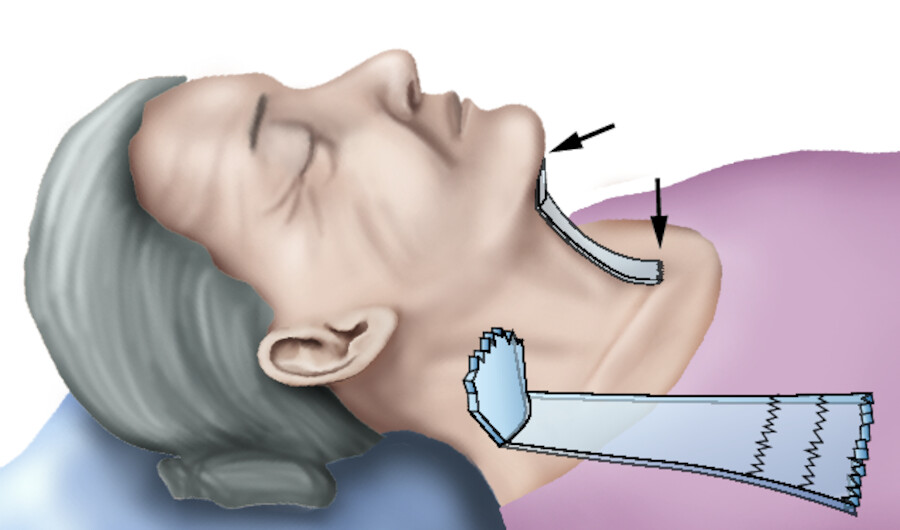
Praxistipp
Zünden Sie eine Kerze (Teelicht oder Schwimmkerze) im Zimmer des Verstorbenen an (Beachten Sie dabei hausinterne Standards zum Brandschutz! Nicht in allen Kliniken ist offenes Licht erlaubt!). Alternativ können Sie z.B. auf LED-Kerzen ausweichen oder eine Blume in die gefalteten Hände des Verstorbenen legen.
Kleidung und Schmuck Nach Absprache erhält der Verstorbene eigene Kleidung (Bluse, Kleid, Rock oder Hemd mit Krawatte und Anzug) oder ein frisches langärmeliges Hemd des Krankenhauses. Schmuck inklusive Ehering sollte grundsätzlich entfernt werden, es sei denn, es bestehen andere Verabredungen mit dem Verstorbenen oder seinen Angehörigen. Weiteres Eigentum des Verstorbenen ist, am besten zu zweit, zu inventarisieren und je nach Krankenhausvereinbarung den Angehörigen oder der Verwaltung gegen Unterschrift zu übergeben.
Hygiene Eine Vergiftungsgefahr durch Eiweißfäulnisprodukte (Ptomaine, sog. Leichengifte) beim Berühren von Verstorbenen besteht nicht (Sitzmann 2005a; 2013).
Praxistipp
Beachten Sie bei septischen Wunden und Verstorbenen mit Infektionen dieselben Vorschriften der Hygiene wie bei lebenden Patienten. Schützen Sie Ihre Hände vor Kontaminationen mit Stuhl, Urin, Blut und Erbrochenem und tragen Sie eine Schutzschürze. Sterbezimmer und Krankenbett sind wie bei der Entlassung eines lebenden Patienten hygienisch aufzubereiten.
Transport Der Verstorbene verbleibt meist noch einige Stunden im Zimmer, bis die Angehörigen sich verabschiedet haben. Danach wird er – je nach Klinik – mit verdecktem Gesicht in einen Aufbahrungsraum ( ▶ Abb. 21.10) gebracht. Das soll keine „Tarnung“ sein, um die Mitpatienten zu „schonen“, sondern eine Maßnahme, um die Intimsphäre des Toten zu wahren.
Abschied nehmen.
Abb. 21.10 In eigens dafür gestalteten Räumen können sich die Angehörigen von den Verstorbenen bis zu 3 Tage lang würdevoll verabschieden.
(Foto: F. Sitzmann)

Lebensphase Kind
Mechthild Hoehl
Tod und Sterben
Umgang mit sterbenden Kindern
Das Thema „Sterben“ scheint sich im Umgang mit Kindern völlig auszuschließen. Wenn ein Kind vor oder während der Geburt, durch eine schwere Erkrankung, ein akutes Ereignis wie z.B. einen Unfall oder gar durch Suizid stirbt, macht das betroffen und belastet auch das ▶ Pflegepersonal stark.
Ein Kind erlebt ab dem Kindergartenalter und je nach Erkrankung seinen Krankheits- und Sterbeprozess bewusst mit. Hier muss das Personal gemeinsam mit den Eltern einen Weg finden, mit dem Kind über seine Erkrankung und seinen Tod zu reden. Bei konkreten Fragen ist Ehrlichkeit das oberste Gebot. Auf keinen Fall sollte das Kind „vertröstet“ werden. Ganz besonders wichtig ist es, dem Kind zu signalisieren, dass vom Team alles getan wird, um ggf. Schmerzen oder Leiden zu lindern, realisierbare Wünsche zu erfüllen und das Kind nicht alleinzulassen.
Wenn möglich und gewünscht, sollte ein Kind, das einer palliativen Pflege bedarf, in die von ihm und seinen Eltern gewünschte Umgebung verlegt bzw. entlassen werden. Die häusliche Betreuung eines sterbenden Kindes erfordert ein hohes persönliches Engagement des ambulant tätigen Pflegepersonals. Der enge und intensive Kontakt mit den Familien in ihrem Umfeld macht eine „Abgrenzung“ häufig schwer. Außerdem stehen auch für Kinder extra ansprechend gestaltete Kinderhospize zur Verfügung.
Ein Supervisionsangebot für die begleitenden Teams ist unerlässlich.
Patientenverfügungen von Minderjährigen
Unmittelbar rechtsverbindlich ist eine Patientenverfügung nur dann, wenn sie von einem/einer einwilligungsfähigen Volljährigen erstellt wurde. Eltern können eine Patientenverfügung als Sorgeberechtigte nur schwer verfügen. Hierbei muss der (mutmaßliche) Wille der Minderjährigen berücksichtigt werden. Sobald bei einem Minderjährigen für eine Behandlungssituation und das jeweilige Krankheitsbild Einwilligungsfähigkeit besteht, sind Entscheidungen Dritter unerheblich; es kommt nach richterlicher Ansicht dann allein auf die Einwilligung des Minderjährigen an, hinter die auch das in Art. 6 Abs. 2 des Grundgesetzes garantierte Sorge- und Stellvertretungsrecht der Eltern zurücktritt. In diesem Fall haben die Minderjährigen ein Vetorecht in Bezug auf Eingriffe oder Behandlungen.
Die Volljährigkeit ist Voraussetzung, damit eine Patientenverfügung wirksam ist. Das kann dazu führen, dass ein einsichtsfähiger Minderjähriger zwar in eine konkrete gegenwärtige Maßnahme einwilligen oder diese Einwilligung auch versagen kann, aber wenn seine Einwilligungsfähigkeit eingeschränkt ist, werden die Eltern die Entscheidungsträger. Hierzu wird schon seit Längerem von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin eine Gesetzesänderung angestrebt (DAKJ 2015).
Häusliche Pflege im Fokus
Tod und Sterben im ambulanten Umfeld
Abschied nehmen
Nach dem Eintritt des Todes geben Sie den Angehörigen und sich selbst die Zeit zum Abschiednehmen, die sie brauchen. Meist ist es für die Angehörigen hilfreich, sich vom Toten zu verabschieden. Der Einstieg in die Trauer ist leichter und es findet ein gewisser Abschluss der meist sehr belastenden Pflege statt. Hilfreich sind auch Gespräche in der Familie über das gemeinsame Leben – die Erinnerungen. Vielleicht zünden Sie eine Kerze an.
Totenschein
Mit dem Hausarzt ist vorab zu klären, wann die Benachrichtigung erfolgen soll, falls der Tod nachts eintritt. Formal ist der Arzt verpflichtet, die „Leichenschau unverzüglich“ vorzunehmen. Mit dem Ausstellen eines Totenscheines kann aber i. d. R. bis zum nächsten Morgen gewartet werden. Auch das Bestattungsunternehmen muss erst am nächsten Morgen benachrichtigt werden.
Aufbahrung
Stirbt jemand zu Hause, kann der Verstorbene je nach Landesrecht bis zu 36 Std. zu Hause aufgebahrt werden. Nach Antrag eines Angehörigen bei der örtlichen Ordnungsbehörde kann die Frist verlängert werden, wenn ein Arzt bescheinigt, dass dagegen keine (hygienischen) Bedenken bestehen. Oft wird der Verstorbene vom Bestatter sofort abgeholt, obwohl die Angehörigen mehr Zeit gebraucht hätten, um Abschied zu nehmen (Sitzmann 2007a).
Fallbeispiel: „Ich habe Vater nach seinem Tod 3 Tage in seiner Wohnung behalten können. Ich habe mit ihm diese 3 Tage gesprochen. Ich war dankbar, dass sich mein Bruder um das Begräbnis der körperlichen Hülle kümmerte.“ (Tausch u. Tausch 1985)
21.5.8 Verabschiedungs- und Aufbahrungskultur
Fragen nach dem Abschluss des eigenen Selbst sowie Grenzerfahrungen des Lebens haben dazu geführt, dass sich der Umgang mit dem Tod verändert. Neue Formen des Abschieds existieren in immer mehr Gesundheitseinrichtungen.
Eine Verabschiedungs- und Aufbahrungskultur spiegelt das allgemeine Bewusstsein und das Verhältnis einer Gesellschaft zum Tod wider. Perikles, der 500 v. Chr. geboren wurde, formulierte: „Die Kultur eines Volkes erkennt man daran, wie sie mit ihren Toten umgeht.“ Pflegende sollten Aufbahrung und Verabschiedung Verstorbener wieder als pflegebezogene Kulturaufgabe anerkennen.
Unterstützt durch Hospize und professionelle Begleitdienste nimmt die Zahl von Hausaufbahrungen zu. Eine Aufbahrungskultur pflegt die Würde eines Menschen über den Tod hinaus. In eigens dafür gestalteten Räumen können die Angehörigen den Verstorbenen bis zu 3 Tage lang würdevoll verabschieden ( ▶ Abb. 21.10).
Lebensphase Kind
Ute Nerge
Abschied nehmen im Kinder-Hospiz Sternenbrücke (Hamburg)
Mit kleinen Hilfen versuchen wir jüngeren Geschwisterkindern näherzubringen, was Tod bedeutet. Mit einem Stethoskop lasse ich die 5-jährige Lena hören, wie ihr Herz pocht und wie das Herz ihres Bruders nun schweigt; sehe mit ihr gemeinsam, dass keine Atmung mehr den kleinen Spiegel vor seinen Lippen beschlägt. Ich spreche mit ihr, offen und ehrlich. Die Tage der Aufbahrung in dem liebevoll gestalteten Abschiedsraum der Sternenbrücke geben Zeit, bange Fragen zu hören und mit ihnen umzugehen – so, dass jüngere Kinder ein Lebensende verstehen können und keine Zweifel bestehen.
21.5.8.1 3 Thesen
Sicher wird Ihnen die Aufbahrung Verstorbener als pflegebezogene Aufgabe zunächst fremd – weil ungewohnt – vorkommen. Sie können sich fragen, welche Aufgabe eine Pflegende denn noch bei einem Verstorbenen erfüllen soll. Ist es nicht normal, dass mit dem Tod alles aufhört, auch die pflegerische Betreuung? Mithilfe einiger erläuterter Thesen können Sie versuchen, Antworten auf Fragen nach dem richtigen Umgang mit dem Tod zu finden.
These 1
„Eine Aufbahrungskultur pflegt die Würde eines Menschen über den Tod hinaus.“
Hier geht es um Hilfe beim Trösten. Verstorbene verändern ihren Gesichtsausdruck. Oft verschwinden die Spuren von Qual und Schmerz. Stattdessen strahlt das Gesicht Ruhe und Gelassenheit aus. Diese Veränderung kann nach Abschluss einer Totenwache oder bei häufigen Besuchen beim Verstorbenen dazu führen, dass der Leichnam wirklich nur noch als die Hülle des Verstorbenen wahrgenommen wird. Kann das nicht ein Trost für manche Angehörigen und eine Hilfe für betreuende Mitarbeiter sein, die Vorstellung vom Tod als Feind und Gegner alles Lebendigen zu überwinden?
These 2
„Die menschenwürdige Aufbahrung eines Verstorbenen ist eine wichtige Station bei der Trauerarbeit der nahen Angehörigen und der professionellen Helfer.“
Fallbeispiel
Äußerung eines Pflegers: „Wir bemühen uns, jeden Toten, unabhängig von seiner Weltanschauung und Konfession, 3 Tage lang aufzubahren, wobei es natürlich auch von den Angehörigen abhängt, ob sie mit diesen 3 Tagen überhaupt etwas verbinden können. Für viele Menschen ist ja das Leben mit dem Tode abgeschlossen, also auch für viele Angehörige, sodass sie alles daransetzen, den Verstorbenen möglichst rasch aus dem Krankenhaus zu holen.“
Pflegende u. a. therapeutisch Tätige können sich von dem Verstorbenen verabschieden. Manchmal haben sie vor dieser Begegnung Angst. Wenn sie aber den Verstorbenen trotzdem aufsuchen, so nehmen sie oft starke Wandlungen im Antlitz des Toten wahr und lernen, seine Gegenwart in diesen ersten 3 Tagen zu ahnen. Das nimmt Pflegenden wie Angehörigen meist die Scheu vor dem Verstorbenen und ihrer eigenen Auseinandersetzung mit dem Tod.
Aufgabe der Pflegenden ist es auch, an die eigene Gesundheit zu denken. Zur gelungenen Selbstpflege gehört die Frage: „Wie nehme ich Abschied von Patienten, die bei uns auf der Station gestorben sind? Gibt es einen Stationsritus? Hat jeder die Möglichkeit, bewusst Abschied zu nehmen, oder lassen wir uns die gestorbenen Patienten ‚nehmen‘, indem sie einfach weg sind, bis wir wieder Dienst haben?“
These 3
„Strukturen in Einrichtungen, die eine menschliche Verabschiedung von Verstorbenen unterstützen, können Gewalt und Aggressionen gegenüber Sterbenden mindern.“
Es ist wissenschaftlich belegt, dass der Mensch im Umgang mit Sterbenden und bei der Betreuung von kranken und alten Menschen nicht unbegrenzt belastbar und nicht unbegrenzt zu Mitgefühl fähig ist. Der Umgang mit Sterben, Tod und Trauer zwingt auch den Helfer zu ständiger Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit und kann zur persönlichen Überforderung führen.
Unter bestimmten Bedingungen kann daraus Gewalt gegenüber Patienten bis hin zu Patientenmisshandlungen und -tötungen (Beine 2003; 2017; Sitzmann 1989) resultieren. Fördern bestimmte Verhältnisse am Arbeitsplatz, z. B. Meinungsverschiedenheiten am Krankenbett, Kompetenzstreitigkeiten, Arbeitsklima und unzureichende personelle Besetzung die Gewalt gegenüber Patienten? Gehören dazu auch die Lebensbedingungen für Sterbende, die Gestaltungsfreiräume für Angehörige nach dem Sterben, z. B. die fehlende Ausgestaltung des Abschiedes?
Merke
Eine Verabschiedungskultur kann dazu beitragen, Abschied im Alltag bewusster zu erfahren, Trauer zuzulassen und das Ende einer Beziehung auch als Chance für einen Neubeginn unmittelbar kennenzulernen.
Praxistipp
Eine Nachbesprechung im Team ist wichtig, um mögliche Schuldgefühle aussprechen zu können („Haben wir alles Mögliche gemacht?“, „Hätten wir anders auf den Patienten reagieren können?“). Ebenso ist sie wichtig, um Fragen zur Qualität der Arbeit im Sinne einer ▶ Fehlerkultur (Sitzmann 2008a) zu beantworten („War die Reanimation entsprechend koordiniert?“).
21.6 Trauer
21.6.1 Zuwendung zum Angehörigen
21.6.1.1 Betreuung bei plötzlichem Tod
Es hat sich bewährt, den Angehörigen mit klaren und eindeutigen Worten im persönlichen Gespräch den Tod mitzuteilen: „Ihr Vater ist tot“, „Ihre Ehefrau lebt nicht mehr“; aber nicht: „Die Reanimation hat nicht angeschlagen.“ Sprechen Sie ruhig und langsam. Oft sind Wiederholungen nötig, Pausen sind zur Orientierung wichtig.
Praxistipp
Unbedingt sollten Sie Sätze, die die Gefühle der Angehörigen beurteilen, vermeiden, z. B.: „Ich weiß, wie es Ihnen jetzt geht.“ Wissen Sie das wirklich? Ihre Fassungslosigkeit, Sprachlosigkeit und Irritation müssen Sie hingegen nicht verbergen. Sie können sie ansprechen und ausdrücken.
Auf beruhigende Medikamente sollte möglichst verzichtet werden, der Abschied von dem Verstorbenen muss, um den Trauerverlauf günstig zu beeinflussen, uneingeschränkt wahrgenommen werden. Für den Trauerverlauf ist es auch wichtig, Angehörigen den Kontakt zum Verstorbenen zu ermöglichen. Einerseits haben sie vielfach den dringenden Wunsch danach, scheuen aber gleichzeitig die Berührung.
Praxistipp
Raten Sie mit ruhigen Worten, dass sie den Verstorbenen streicheln, ihn nochmals in den Arm nehmen oder mit einem Kuss verabschieden können. Versuchen Sie, bestimmte Aufgaben gegenüber den Angehörigen (Begleitung zur Verabschiedung, zum Aufbewahrungs- oder Aufbahrungsraum) selbst zu übernehmen und nicht an pflegefremde Mitarbeiter des Krankenhauses abzugeben, die den Verstorbenen nicht kannten.
Trauer nach einem Suizid Das Thema Suizidtrauer ist in der Fachwelt spät entdeckt worden. Seit einigen Jahren treten Menschen aus dem bedrückenden Schweigen um den Tod eines ihrer Lieben heraus und halten sich zum Gespräch bereit. „Mir ging es und geht es wie dir. Können wir versuchen, uns gegenseitig zu helfen?“ Im Internet wird unter: https://www.agus-selbsthilfe.de/startseite/ (Stand 18.11.2016) für Angehörige ein gegenseitiges Beistandsangebot für Beratung unter Trauernden nach Selbsttötung angeboten.
Praxistipp
Bedenken Sie, wenn Sie von „Selbstmord“ sprechen: Selbstmord ist ein weit verbreitetes Un-Wort! Mörder ist laut Strafgesetzbuch, wer aus ...-Lust, ...-Trieb, Habgier oder sonstigen niedrigen Beweggründen ... tötet. Wie steht es mit dem Menschen in oft ausweglos erscheinender Lage, der als „Selbstmörder“ tituliert wird? Wer kann einem Menschen, der sich selbst tötet, niedrige Beweggründe zusprechen?
Es ist besser, von Suizidpatienten, von Selbsttötung, von Tod durch eigene Handlung zu sprechen. Auch die eher alte Form des „entleibens“ ist treffend. „Selbstmord“ wirkt sozial stigmatisierend (Sitzmann 2005b).
21.6.1.2 Unterstützung im Trauerprozess
Unterstützende Maßnahmen in der Trauer sind sehr individuell. Dennoch gibt es Erfahrungen, die viele Menschen gleichermaßen machen, z. B.:
-
Trauer ist keine Krankheit, sondern ein Prozess.
-
Trauer braucht Zeit.
-
Es hilft, Tränen, Schmerz, Angst und Wut zuzulassen.
-
Es ist gut, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Seelsorger oder andere Trauernde in geführten Trauergruppen zu finden, die zuhören und damit ein Stück begleiten können.
Beratung der Trauernden Gespräche über den Tod und die Trauerarbeit, das Erledigen administrativ notwendiger Angelegenheiten, das Vorbereiten der Bestattungsfeierlichkeiten usw. fällt im Krankenhaus üblicherweise nicht mehr in den Aufgabenbereich der Pflegenden. Pflegende in der ambulanten Pflege haben hingegen oft die Aufgabe, die trauernde Familie noch über den Tod hinaus zu begleiten.
Beziehungen zum Verstorbenen aufbauen Manchen Menschen ist es ein Bedürfnis, eine Verbindung zu dem Verstorbenen aufzubauen. Doch vielfach besteht die Auffassung, dass sich über den Zustand nach dem Tod wenig sagen lässt. Der Verstorbene sei nicht mehr da, das gelte es zu akzeptieren. Sicher ist es notwendig, dass Angehörige und Pflegende die Realität des Todes akzeptieren, aber damit sind noch nicht die vielfach tief verwurzelten Gefühle und Beziehungen tot, die den Hinterbliebenen mit dem Verstorbenen verbinden. Der Verstorbene existiert für den Trauernden in einer inneren Form weiter. Ob der Trauerprozess gelingt, hängt davon ab, wie der Trauernde die Beziehung gestaltet, welches Verhältnis er zum Toten gewinnt.
Trauerbewältigung Unterschiedlich in Maß und Dauer kann das Erleben nach dem Verlust eines lieben Menschen geprägt sein von starkem Trennungsschmerz, Sehnsucht, Traurigkeit, schmerzvollen, aber auch positiven Erinnerungen an die verstorbene Person und gemeinsam Erlebtes. Möglich sind auch fehlende oder verzögerte Trauerreaktionen. Im normalen Trauerprozess zeigt sich eine Dynamik des fortwährenden Pendelns zwischen Gedanken des Verlustes und der Zukunftsorientierung. Jeder Trauerprozess ist individuell. Im Modell ( ▶ Abb. 21.11) werden Momente der Integration des Verlustes wie auch eine Orientierung auf neue Lebensziele deutlich.
Dynamik der Trauerbewältigung (mod. nach Steinig u. Kersting 2015).
Abb. 21.11
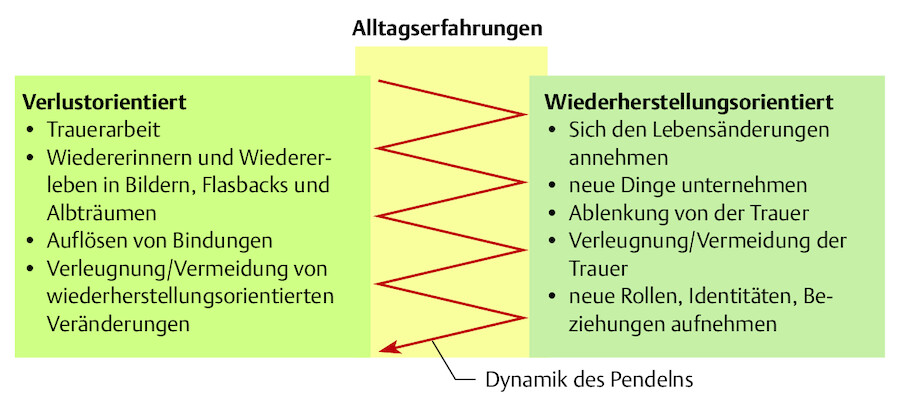
Gelungene Trauerarbeit Meist nimmt die Intensität der Trauer im Verlauf der Zeit ab und es gelingt den trauernden Personen, sich allmählich an neue veränderte Lebensumstände ohne die verstorbene Person anzupassen. Der „normale“ Trauerprozess geht seinem Ende entgegen, wenn es dem Trauernden gelingt, seine innere und äußere Welt wiederaufzubauen, eine Welt, in die der Verstorbene integriert ist und und in der er weder völlig verstoßen ist, noch ein „Schattendasein“ führen muss.
Dabei wird der Blick wieder in die Zukunft gerichtet und der Mensch wird sich neuen Aufgaben, Aktivitäten und Orientierungen zuwenden.
Dies gelingt jedoch nicht allen Menschen – psychotherapeutische Hilfe ist erforderlich, wenn sich Symptome einer anhaltenden komplexen Trauerreaktion zeigen (Steinig 2015).
Lebensphase Kind
Ute Nerge
Trauerarbeit im Kinder-Hospiz Sternenbrücke (Hamburg)
Einmal im Jahr laden wir unsere verwaisten Familien zum „Tag der Erinnerung“ ein, an dem wir gemeinsam mit ihnen der verstorbenen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gedenken. Jeder Mensch trauert anders. Es gilt jede Art, Form und Dauer des Trauerweges zu achten, ohne ihn zu bewerten. Eine liebevoll gelebte Erinnerungskultur respektiert und unterstützt die Suche nach dem eigenen Weg, nach einem Lebensweg, auf den irgendwann „die Sonne wieder scheinen darf“ mit dem verstorbenen „Kind im Herzen“, wie „unsere“ Eltern es immer wieder benennen.
21.6.2 Psychohygiene für Pflegende
Um den Tod zu akzeptieren und zu verarbeiten, ist es normal, dass man im Team darüber spricht, trauert, vielleicht sogar gemeinsam weint.
Wenn Sie eine innige Verbindung zu dem Verstorbenen hatten und zunächst keinen Abstand gewinnen können, müssen Sie darauf achten, dass Ihre eigenen Lebenskräfte nicht reduziert werden. Wer ständig hohen Anforderungen in der Pflege ausgesetzt ist, kann an seine persönlichen Grenzen stoßen. Charakteristische Symptome können z.B. Müdigkeit, Schlaflosigkeit, lange krankheitsbedingte Ausfälle, Reizbarkeit oder gar die Kündigung des Arbeitsplatzes sein (Engelke 2013). Der enge Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung im Team sind die Grundvoraussetzungen für eine langfristige, gute Pflege.
Praxistipp
Lassen Sie das Weinen zu. Tränen sind Ausdruck Ihrer Emotionalität, Sensibilität und Ihres Mitgefühls. Nehmen Sie vom aufgebahrten Verstorbenen Abschied, gönnen Sie sich genügend Schlaf und versuchen Sie, regelmäßig zu essen. Vor allem sind Ansprechpartner wichtig, jemand, der zuhören kann – Sie sollten mit dem unverarbeiteten Schmerz nicht allein bleiben.
Prävention und Gesundheitsförderung
Interventionsschritte der Pflege
Christoph S. Nies
Die Frage nach dem Sinn des Daseins ist eine der schwierigsten Fragen, der sich ein Mensch in seinem Leben gegenübersieht. Die Art, in der ein Mensch sich dann auf den Weg macht, die Frage für sein Leben zu beantworten, hat entscheidenden Einfluss auf sein Handeln anderen Menschen, aber auch sich selbst gegenüber. Sein Handeln gegenüber sich selbst schließt auch das Handeln gegenüber der eigenen ▶ Gesundheit – bzw. das Handeln zur Gesunderhaltung – mit ein. Damit ist z. B. die Entwicklung eines individuellen Lebensstils mit den resultierenden Verhaltensweisen (z. B. genussgeprägter Lebensstil, Rauchen als Verhaltensweise) gemeint, die Einfluss auf Gesundheit oder Krankheitsverlauf eines Menschen nehmen.
Hier zeigt sich eine wichtige Verbindung dieser ATL mit den Inhalten der Gesundheitsförderung und Prävention. Pflegerische Gesundheitsförderung kann über Information, Beratung und Unterstützung in Bezug auf bereits vorhandene, dem Menschen Sinn gebende und zudem gesundheitsförderliche Lebensaspekte wesentlichen Einfluss nehmen (z. B. Förderung eines spirituell gefestigten Lebensstils).
Gerade in extremen Situationen eines Lebens, oftmals ausgelöst durch Krankheit und Pflegebedürftigkeit, wird die Sinnfrage im Leben eines Menschen erneut bzw. überhaupt erst in dieser Deutlichkeit aufgeworfen. Durch den intensiven Kontakt zum Pflegeempfänger ist an diesem Punkt im Besonderen die Pflege im Rahmen präventiv ausgerichteter Pflegehandlung gefordert, Risikofaktoren oder vorhandene Defizite für ein gestörtes Sinnerleben (z. B. Gefühl der Sinnlosigkeit eines Leidens bis hin zur Selbstaufgabe) bei einem Menschen zu erkennen und diesen präventiv zu begegnen. Das geschieht auf den verschiedenen ▶ Ebenen der Prävention.
Es ist selbstverständlich, dass gerade in der ATL „Sinn finden im Werden – Sein – Vergehen“ die Individualität des Menschen und seines ganz persönlichen Sinnerlebens Bezugspunkt der konkreten Interventionen darstellt und diese somit höchst unterschiedlich sein können. In ▶ Tab. 21.6 werden einige Interventionen der pflegerischen Gesundheitsförderung und Prävention dargestellt.
|
Gesundheitsförderung |
Primärprävention |
Sekundärprävention |
Tertiärprävention |
|
Interventionen |
|||
|
|
|
|
|
Interventionszeitpunkt |
|||
|
Gesundheitszustand (kein Selbstpflegedefizit hinsichtlich des Sinnerlebens vorhanden) |
erkennbare Risikofaktoren (Gefahr der Entstehung eines Selbstpflegedefizits im Bereich des Sinnerlebens) |
beginnende pathologische Veränderungen (Selbstpflegedefizit im Bereich des Sinnerlebens vorhanden) |
ausgeprägte pathologische Veränderungen (ausgeprägtes Selbstpflegedefizit im Bereich des Sinnerlebens vorhanden) |
|
Zielgruppe |
|||
|
|
|
|
|
Interventionsorientierung |
|||
|
salutogenetische Ausrichtung (Förderung) |
pathogenetische Ausrichtung (Vorbeugung) |
pathogenetische Ausrichtung (Korrektur) |
pathogenetische Ausrichtung (Kompensation) |
|
Zielsetzung |
|||
|
|
|
|
21.7 Lern- und Leseservice
21.7.1 Literatur
21.7.1.1 Sterben und Tod
[1276] Bavastro P. Anthroposophische Medizin auf der Intensivstation. Dornach: Verlag am Goetheanum; 1994
[1277] Beine KH. Homicides of patients in hospitals and nursing homes: a comparative analysis of case series. International Journal of Law and Psychiatry. 26 (2003) 373-386
[1278] Beine KH, Turczinski J. Tatort Krankenhaus – Wie ein kaputtes System Misshandlungen und Morde an Kranken fördert. München: Droemer; 2017
[1279] BGH, Beschl. vom 17. 9.2014, AZ: XII ZB 202/13. Im Internet: https://openjur.de/u/740963.html; Stand: 30.04.2017
[1280] Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DAKJ 2015). Patientenverfügungen von Minderjährigen. Im Internet: http://dakj.de/stellungnahmen/ethische-fragen/patientenverfuegungen-minderjaehrige/; Stand: 23.04.2017
[1281] Domin H. Gesammelte Gedichte. Frankfurt: Fischer; 1987
[1282] Engelke E. Die Arbeitswelt der Pflegenden - Zwischen Erwartungshaltung und eigenen Idealen. CNE.fortbildung 5.2013. Im Internet: https://cne.thieme.de/cne-webapp/r/training/learningunits/details/10.1055_s-0033-1360821; Stand: 01.05.2016
[1283] Erbguth FJ, Erbguth I. Therapieentscheidung am Ende des Lebens. Akt Neurol 2016; 102-112, DOI: 10.1055/s-0042-100902
[1284] Galtung J. Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung. Reinbek bei Hamburg: Rororo; 1982
[1285] Hannich HJ, Dierkes B. Ist Erleben im Koma möglich? Intensiv 1996; 4: 4
[1286] Hardinghaus W. Die Situation ist da. Klinikarzt 2016; 107, DOI: 10.1055/s-0042-103266
[1287] Hoehl M, Kullick P. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. 4. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2012
[1288] Kipfer S, Koppitz A. Häufige Symptome bei sterbenden Menschen mit Demenz. NOVAcura 2014; 10: 46-49
[1289] Kindertrauer. Informationen für Betroffene, Angehörige und Einsatzkräfte. Im Intenet: www.kindertrauer.info; Stand: 16.12.2016
[1290] Knipping C. Lehrbuch Palliative Care. 2. Aufl. Bern: Huber; 2007
[1291] Koch T. Tod und Sterben auf der Intensivstation. Im Internet: https://cne.thieme.de/cne-webapp/r/science/details/science_kompakt_2D1BB7C29CEF44FD8DF2F28EE8DCD6CB?update=true; Stand: 01.05.2016
[1292] Kübler-Ross, E. Interviews mit Sterbenden, 3. Aufl. Stuttgart: Kreuz; 2011
[1293] Langer S et al. Umgang mit Patientenverfügungen in Deutschland. Dtsch med Wochenschr 2016; e73-e79, DOI: 10.1055/s-0042-104038
[1294] Meinighaus F. Ein Fußballspiel und ein Todesfall. TAZ. Die Tageszeitung vom 15.3.2016, Seite 19
[1295] Moody RA. Leben nach dem Tod. 35. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt; 2011
[1296] Parnia S et al. AWARE—AWAreness during REsuscitation—A prospective study. Resuscitation 2014; 1799–1805, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2014.09.004
[1297] Putz W. Sterbehilfe: juristische Grundlagen. Dtsch med Wochenschr 2016; 389-393, DOI: 10.1055/s-0041-108083
[1298] Röseberg F, Müller M, Hrsg. Handbuch Kindertrauer. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG; 2014
[1299] Rudtke W. Hinweise zu Jehovas Zeugen. Schriftverkehr vom 02.04.2013
[1300] Rupp M, Rauwald C. Von der Aggressivität zur Eskalation – Klärung einiger Grundbegriffe. In: Ketelsen R, Schulz M, Zechert C, Hrsg. Seelische Krise und Aggressivität – Der Umgang mit Deeskalation und Zwang (12–26). Bonn: Psychiatrie Verlag; 2004
[1301] Schmidt-Richter R. Lippenpflege. THIEME CNE.online. Im Internet: https://cne.thieme.de/cne-webapp/r/experts/archive/d1e4ddc5-fd3c-41d5-99cd-a5359d6364da/-/d3eba0ab-9034-4093-8577-e96a5620f084/1; Stand: 21.04.2016
[1302] Simon S. T, Müller-Busch C, Bausewein C. Symptomatische Behandlung von Schmerzen und Atemnot. Der Internist 2011 52 (1): 28–35
[1303] Sitzmann F. Recht in Pflege und Betreuung. Melsungen: Bibliomed; 1986
[1304] Sitzmann F. Notstand einer Pflegenden? Recom-Monitor 1989; 2: 26–28
[1305] Sitzmann F. Mit wachen Sinnen wahrnehmen und beobachten, Teil 1. Basel: RECOM; 1995
[1306] Sitzmann F. Mit wachen Sinnen wahrnehmen und beobachten, Teil 2. Baunatal: RECOM; 1996
[1307] Sitzmann F. Aufbahrung und Abschiednehmen – Aufgabe der Pflegenden gegenüber den Verstorbenen. Die Schwester/Der Pfleger 1997a; 2: 157
[1308] Sitzmann F. Praktiken der Behandlung Verstorbener. In: Sitzmann F, Hrsg. Pflegehandbuch Herdecke. 3. Aufl. Berlin: Springer; 1998b
[1309] Sitzmann F. Die Symbolsprache des Sterbenden. In: Bienstein C, Zegelin-Abt A, Georg J, Hrsg. Take Care – Pflegekalender 1999. Wiesbaden: Ullstein Medical; 1998c
[1310] Sitzmann F. Würdevolles Sterben im Intensivpflegebereich. Intensiv 2001; 202-210, DOI: 10.1055/s-2001-17254
[1311] Sitzmann F. Sind Verstorbene giftig? Zum Risiko von Infektionskrankheiten durch Tote. Intensiv 2005a; 63–65, DOI: 10.1055/s-2005-857925
[1312] Sitzmann F. Reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist? Plädoyer für eine Sprachkultur in Pflege, Medizin und Gesellschaft. In: Schnell M, Abt-Zegelin A. Sprache und Pflege. 2. Aufl. Bern: Huber; 2005b
[1313] Sitzmann F. Umgang mit Verstorbenen und ihren Angehörigen. In: Burgheim W. Qualifizierte Begleitung von Sterbenden und Trauernden: Medizinische, rechtliche, psycho-soziale und spirituelle Hilfestellungen (Loseblattsammlung). Merching: FORUM; 2005c
[1314] Sitzmann F, Zegelin A. „So viel Wortmüll war nie“. Sprachkultur in Ausbildung und beruflicher Bildungsarbeit – ABC der denk-würdigen Begriffe. In: Abt-Zegelin A., Schnell MW, Hrsg. Die Sprachen der Pflege. Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft; 2006
[1315] Sitzmann F. Gerade noch ein Mensch – jetzt nicht mehr? Den Abschied würdig gestalten – Aufbahrung unserer Toten. In: Burgheim W. Qualifizierte Begleitung von Sterbenden und Trauernden: Medizinische, rechtliche, psycho-soziale und spirituelle Hilfestellungen (Loseblattsammlung). 18. Aufl. Merching: FORUM-Verlag; 2006
[1316] Sitzmann F. Hygiene daheim. Bern: Huber; 2007a
[1317] Sitzmann F. Müssen Sterbende verdursten? Pro und Kontra der Flüssigkeitsgabe während des Sterbens. In: Burgheim W. Qualifizierte Begleitung von Sterbenden und Trauernden: Medizinische, rechtliche, psycho-soziale und spirituelle Hilfestellungen (Loseblattsammlung). Merching: FORUM; 2007b
[1318] Sitzmann F. Ich habe ihr einen Backenzahn herausgebrochen und fühle mich miserabel – aber meine Schuld verschweige ich. In: Aktionsbündnis Patientensicherheit, Hrsg. Aus Fehlern lernen. Witten/Herdecke; 2008a
[1319] Sitzmann F. Stille Geburt. In: Burgheim W. Qualifizierte Begleitung von Sterbenden und Trauernden: Medizinische, rechtliche, psycho-soziale und spirituelle Hilfestellungen (Loseblattsammlung). Merching: FORUM; 2008b
[1320] Sitzmann F. Aufbahrung Verstorbener in Klinik und Daheim – Gewinn einer Station auf dem Weg der Trauer. NOVAcura - Das Fachmagazin für Pflege und Betreuung 44 (2013) 2:49-51
[1321] Sitzmann F. Sind Verstorbene giftig? Zum Risiko von Infektionskrankheiten durch Tote. In: Burgheim, W. Qualifizierte Begleitung von Sterbenden und Trauernden: Medizinische, rechtliche, psycho-soziale und spirituelle Hilfestellungen (Loseblattsammlung). Forum GesundheitsMedien, Merching (August 2013)
[1322] Sitzmann F. Therapiebegrenzung. Haben Sie sich schon Gedanken zu Futility gemacht? In: Burgheim W.Qualifizierte Begleitung von Sterbenden und Trauernden: Medizinische, rechtliche, psycho-soziale und spirituelle Hilfestellungen (Loseblattsammlung). Forum GesundheitsMedien, Merching (Mai und August 2014a)
[1323] Sitzmann F. Das Schweigen brechen – zur Suizidgefahr älterer Menschen. NOVAcura – Das Fachmagazin für Pflege und Betreuung 2014b; 9:40-42
[1324] Sitzmann F. Flüssigkeitsversorgung von Senioren: Wann ist wie viel genug? Novacura 2014c; 45: 48-51
[1325] Sitzmann F. Menschenwürdiges Sterben auf Intensivstation. abstract zum 25. Internationalen Symposium für Intensivmedizin und Intensivpflege, Bremen 2015. Journal für Anästhesie und Intensivbehandlung (2015) II:196-198
[1326] Sitzmann F. Sterben und Tod. In: Pflegeassistenz. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2016
[1327] Statista 2017. Statistiken zum Thema Selbstmord/Suizid. Im Internet: http://de.statista.com/themen/40/selbstmord/; Stand: 22.04.2017
[1328] Steiner R. Vortragszyklus: Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes. Steiner, Dornach GA 134; 1911/12
[1329] Steinig J, Kersting A. Anhaltende komplexe Trauerreaktion – ein neues Krankheitsbild? PSYCH up2date 2015; 281-295, DOI: http://dx.doi.org/10.1055/s-0041-102927
[1330] Tausch AM, Tausch R. Sanftes Sterben. Reinbek: Rowohlt; 1985
[1331] Uebach B, Kern M. Begleitung in der Finalphase. CNE.fortbildung 4. 2011, DOI: 10.1055/s-0033-1353519
[1332] Van Lommel P. Endloses Bewusstsein: Neue medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung. München: Knaur MensSana; 2013
[1333] Vollbrecht M. Fallbeispiele aus dem Hospiz. Persönliche Mitteilung 2013/2016
[1334] Wanke S. Ein letztes Mal ans Meer. Die Schwester/Der Pfleger 2016; 3: 48-49
21.7.1.2 Palliative Care
[1335] Achterberg J. Die Frau als Heilerin. Die schöpferische Rolle der heilkundigen Frau in Geschichte und Gegenwart. München: Scherz; 1991
[1336] Deutsches Ärzteblatt 2007; 104: A2976
[1337] Davy J, Ellis S. Palliativ pflegen. Sterbende verstehen, beraten und begleiten. Bern: Huber; 2003
[1338] Keay TJ, Schonwetter RS. Hospice Care in the Nursing Home. American Family Physician 1998; 57: 3, 5
[1339] Mladek P. Palliative Care/Palliativmedizin – eine Alternative zur aktiven Sterbehilfe? Ausschnitt aus einem Fallbeispiel aus einer unveröffentlichten Abschlussarbeit im Palliative Care Kontaktstudiengang V, 2004 an der Elisabeth-Kübler-Ross-Akademie für Bildung und Forschung im Hospiz Stuttgart. In: Student JC, Napiwotzky A. Palliative Care: wahrnehmen – verstehen – schützen. Stuttgart: Thieme; 2011
[1340] Rogers CR. Die Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie. 4. Aufl. Frankfurt/M.: Fischer; 1983
[1341] Student JC, Zippel S. AIDS und Sterben. In: Jäger H, Hrsg. AIDS – psychosoziale Betreuung von AIDS- und AIDS-Vorfeldpatienten. Stuttgart: Thieme; 1987
[1342] Student JC, Hrsg. Das Hospiz-Buch. 4. Aufl. Freiburg: Lambertus; 1999
[1343] Student JC, Napiwotzky A. Palliative Care: wahrnehmen – verstehen – schützen. Stuttgart: Thieme; 2011
[1344] WHO. Cancer pain relief and palliative care. Report of a WHO Expert Committee. World Health Organization, Geneva 1990
[1345] WHO. National Cancer Control Programmes: Policies and Managerial Guidelines. World Health Organization, Geneva 2002; 84
21.7.1.3 Prävention und Gesundheitsförderung
[1346] Hurrelmann K, Razum O, Hrsg. Handbuch Gesundheitswissenschaften. Weinheim: Beltz Juventa; 2016
21.7.2 Weiterführende Literatur
21.7.2.1 Sterben und Tod
[1347] Engelke E. Die Situation Sterbenskranker und ihrer Angehörigen. CNE.fortbildung 5.2013, Lerneinheit 19. DOI: 10.1055/s-0033-1360820
[1348] Uebach B, Kern M. Schwerstkranke und Sterbende betreuen. CNE.fortbildung 4.2011, Lerneinheit 14. DOI: 10.1055/s-0033-1353517
21.7.3 Kontakt- und Internetadressen
[1349] IGSL – Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand (IGSL-Hospiz) e.V., Amtsstraße 1, 55411 Bingen. Im Internet: http://www.igsl-hospiz.de/; Stand: 16.12.2016
[1350] Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V. (DHPV), Aachener Straße 5, 10713 Berlin. Im Internet: http://www.hospiz.net; Stand: 16.12.2016
[1351] Deutsche Stiftung Patientenschutz, Europaplatz 7, 44269 Dortmund, Telefon: 0231 738 073–0, Fax: 0231/738 073–1. Im Internet: https://www.stiftung-patientenschutz.de; Stand: 07.03.2017
21.7.3.1 Anschriften für Patientenverfügungen
[1352] http://www.bundesanzeiger-verlag.de/betreuung/vorsorgevollmacht/formulare-und-muster.html; Stand: 30.04.2017
[1353] https://www.patientenverfuegung.de/meine-patientenverfuegung; Stand: 30.04.2017
[1354] http://www.bmjv.de/DE/Themen/VorsorgeUndPatientenrechte/Betreuungsrecht/Betreuungsrecht_node.html; Stand: 30.04.2017
[1355] http://www.igsl.de/; Stand: 30.04.2017