Spaziergang
Inhaltsverzeichnis
Länge ca. 4,6 km, Dauer ca. 2:30 Std.,
Ausgangspunkt des Spaziergangs ist der Rosa-Luxemburg-Platz am gleichnamigen U-Bahnhof. Den Platz beherrscht, einer Trutzburg gleich, die Volksbühne - vorne hui, an den Seiten pfui, was dem Wiederaufbau nach dem Krieg geschuldet ist. Intendant Frank Castorf machte die Bühne zu einer der innovativsten der Stadt (→ Kultur, S. 63). Vor der Volksbühne sind auf Gehwegen und Fahrbahnen dunkle Betonbalken mit Zitaten Rosa Luxemburgs eingelassen - ein Denkzeichen des Künstlers Hans Haacke.
Zur Spitze des dreieckigen Platzes hin befindet sich das Kino Babylon, eines der schönsten Filmtheater Berlins und eine der Spielstätten der Berlinale (→ Kultur, S. 68).
Scheunenviertel
Die Rosa-Luxemburg-Straße führt hinein ins Scheunenviertel, das sich von hier gen Westen bis zur Rosenthaler Straße zieht. Das Viertel erhielt seinen Namen im 17. Jh., als aufgrund eines Brandschutz-Erlasses Scheunen innerhalb des Stadtgebietes untersagt wurden und hier - damals lag das Gebiet noch außerhalb der Stadtmauern - neu errichtet wurden. Scheunen gibt es heute keine mehr, es dominiert die mittetypische Mischung aus Altbau und Platte. Darin: schicke Läden, darunter auch viele Stores Berliner Modelabels. Außerdem: viele Touristen. Der erste Abschnitt des Spaziergangs ist dem Shoppen oder Windowshoppen gewidmet. Er verläuft über die Rosa-Luxemburg-Straße, die Münzstraße (mit einem Denkmal für Deutschlands Säulenheiligen Ernst Litfaß), die Alte Schönhauser Straße, die Mulackstraße und die Rosenthaler Straße in die Gipsstraße.
Die Sophie-Gips-Höfe stecken voller Kunst
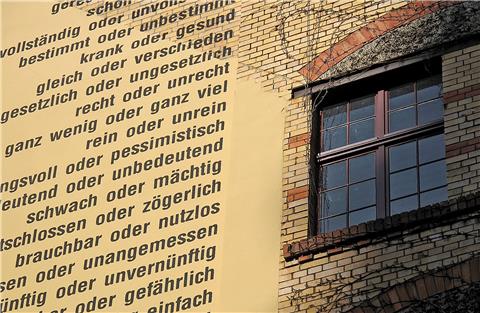
Nun lernen wir Hinterhöfe und geheimnisvolle Durchfahrten kennen, die die Spandauer Vorstadt ebenfalls prägen. Von der Gipsstraße 12 führt eine schmale Passage in die Sophie-Gips-Höfe. Der Komplex drum herum entstand für einen Nähmaschinenfabrikanten in der zweiten Hälfte des 19. Jh. Das heutige Aussehen der liebevoll restaurierten Höfe ist dem Ehepaar Erika und Rolf Hoffmann zu verdanken. Sie richteten Loftbüros und Wohnungen in dem Ensemble ein und schufen sich selbst ein sagenhaftes Penthouse obenauf. In einem Teil ihrer Privaträume (!) macht Erika Hoffmann heute jeden Samstag ihre Kunstsammlung, die → Sammlung Hoffmann, der Öffentlichkeit zugänglich - sehenswert. Ohnehin wimmelt es in den Höfen nur so vor Kunst, schauen Sie sich um.
Die Höfe münden in die Sophienstraße. Die Sophienkirche (s. u.) und die stuckverzierten Häuser entlang der Straße verströmen Kleinstadtatmosphäre - einst befand sich hier das Handwerkerviertel der Spandauer Vorstadt. Das ehemalige Handwerkervereinshaus schräg gegenüber der Kirche, das ein repräsentatives Terrakotta-Doppelportal besitzt, erinnert daran. Im Inneren befindet sich das Theater sophiensaele (→ Kultur, S. 63).
Durch die Hackeschen Höfe
Von der Sophienstraße 6 führt ein unauffälliger Durchgang hinein in die → Hackeschen Höfe, ein städtebauliches Juwel, das jeder Berlin-Tourist einmal gesehen haben sollte. Folgt man in den Höfen der Beschilderung zu Hof I, verlässt man die Hackeschen Höfe zur Rosenthaler Straße hin. Rechts voraus liegt der S-Bahnhof Hackescher Markt. Doch bevor wir uns dorthin aufmachen, werfen wir noch einen Blick linker Hand in den nächsten Durchgang (Hnr. 39) und damit in den schrabbelig-charmanten, schlauchförmigen Hof des → Hauses Schwarzenberg - das Gegenprogramm zum aufgeputzten, kommerzialisierten Nachbarn.

In den Hackeschen Höfen
Der 1880 errichtete S-Bahnhof Hackescher Markt ist ein kleines Schmuckstück mit Pilastern, Bögen, Gesimsen und Mosaiken. Die Terrassenlokale auf dem gleichnamigen Platz davor haben an lauen Sommerabenden eine magische Anziehungskraft auf Touristen, die hier den Straßenmusikanten lauschen. Donnerstags und samstags findet hier zudem ein kleiner Wochenmarkt statt, auf dem auch Souvenirs verkauft werden.
Oranienburger Straße
Spaziert man mit den S-Bahngleisen zur Linken weiter und hält sich bei der ersten Möglichkeit rechts, bei der folgenden Gabelung aber links, gelangt man auf die Oranienburger Straße. Dort versteckt sich rechter Hand hinter Hausnummer 18 die → Galerie Sprüth Magers, eine der führenden Galerien der Stadt. Linker Hand, wo sich heute der Monbijoupark erstreckt, stand einst das gleichnamige Schloss, das 1960 als Kriegsruine gesprengt wurde. Gen Westen schließt an den Monbijoupark Berlins einstiges Haupttelegrafenamt an. Anfang des 20. Jh. wurde es erbaut, die dazugehörige Rohrpostanlage war bis 1986 in Betrieb. Zusammen mit sieben weiteren denkmalgeschützten Gebäuden wird der Komplex, der bis zur Spree reicht, in moderne Lofts, Büros und Wohnungen umgewandelt. Das Projekt nennt sich Forum Museumsinsel, im Telegrafenamt selbst soll ein Spa-Hotel entstehen.
Die Straße, die gegenüber dem Telegrafenamt abzweigt, ist die Krausnickstraße, an der das kleine → Ramones-Museum liegt, eine Pilgerstätte für Punkrocker. Lässt man den Abstecher außer Acht, passiert man als nächstes die
| Übernachten | |
|---|---|
| 1 | Reisemobilstation |
| 5 | Honigmond Garden Hotel |
| 9 | Pension Mädchenkammer |
| 17 | St. Oberholz Apartments |
| 18 | Miniloft Mitte |
| 26 | Amano Hotel |
| 57 | Casa Camper |
| 70 | Baxpax downtown |
| Essen & Trinken | |
|---|---|
| 4 | Papà Pane di Sorrento |
| 10 | Reinstoff |
| 19 | Bandol sur Mer |
| 21 | Kopps |
| 25 | Themrock |
| 28 | Rutz |
| 29 | Yam Yam |
| 34 | Muret la barba |
| 35 | Bötzow-Privat |
| 37 | Kantine der Volksbühne |
| 40 | Kuchi |
| 46 | Monsieur Vuong |
| 48 | Pauly Saal |
| 68 | Lebensmittel in Mitte |
| 69 | Àtame |
| Café | |
|---|---|
| 3 | Nola's am Weinberg |
| 17 | St. Oberholz |
| 32 | Strandbad Mitte |
| 45 | Altes Europa |
| 49 | Barcomi's Deli |
| 50 | Keyser Soze |
| 63 | Tadshikische Teestube |
| 67 | Eschschloraque Rümschrümp |
| 73 | Strandbar Mitte |
| Bars & Clubs | |
|---|---|
| 11 | Mein Haus am See |
| 13 | Neue Odessa Bar |
| 14 | White Trash Fast Food |
| 16 | Kultur- und Schankwirtschaft Baiz |
| 24 | Kaffee Burger |
| 27 | Reingold |
| 31 | b-flat |
| 37 | Roter Salon und Grüner Salon |
| 44 | Bar 3 |
| 47 | Clärchens Ballhaus |
| 51 | Zosch |
| 56 | King Size Bar |
| 61 | Anna Koschke |
| 62 | Fire Bar |
| 65 | Bierstube Alt Berlin |
| 71 | Bohannon |
| Einkaufen | |
|---|---|
| 6 | Kaviar Gauche Vintage |
| 7 | Record Store |
| 8 | Bibliotheka Culinaria |
| 15 | Grober Unfug |
| 20 | Sabrina Dehoff |
| 22 | Bagjack-Store |
| 23 | Kaviar Gauche |
| 30 | Butterflysoulfire |
| 32 | Konk |
| 33 | LaLa Berlin |
| 36 | Firma |
| 38 | C'est tout |
| 41 | Do you read me? |
| 42 | pro qm |
| 43 | Herr von Eden |
| 50 | Penthesileia |
| 52 | o.k. |
| 53 | adddress |
| 54 | Soma |
| 55 | Langhein Berlin |
| 58 | Rike Feuerstein |
| 59 | Absinth Depot Berlin |
| 60 | Waahnsinn Berlin |
| 64 | Trippen Flagshipstore |
| 66 | Made in Berlin |
| 72 | Mykita |
| Sonstiges | |
|---|---|
| 2 | FC Magnet Bar (Fußballkneipe) |
| 12 | Kinderinsel (Kinderhotel) |
| 39 | Fahrradstation (Radverleih) |
| 67 | Chamäleon (Theater) |

Barockes Überbleibsel: die Sophienkirche
Ein paar Schritte dahinter liegt der Zugang (Hnr. 32) zu den hübschen Heckmannhöfen, die die Oranienburger Straße mit der Auguststraße (s. u.) verbinden. In den restaurierten Remisen haben sich u. a. Restaurants und Boutiquen niedergelassen. Nächster Eyecatcher an der Oranienburger Straße/Ecke Tucholskystraße ist das ehemalige Postfuhramt rechter Hand. Der zwischen 1876 und 1881 errichtete repräsentative Ziegelbau mit achteckiger Kuppel galt als aufwendigster Behördenbau seiner Zeit. 1995 wurde der Postbetrieb eingestellt. Bis 2013 zeigte hier die Galerie C/O(→ S. 197) hochkarätige Fotoausstellungen, mittlerweile gehört das Gebäude dem „Herzschrittmacher-Macher“ Biotronik.
Die Galerie C/O war zusammen mit dem Tacheles 200 m weiter linker Hand eines der Aushängeschilder der Oranienburger Straße in Sachen hipper Kunst in abgewrackten Immobilien. Das Tacheles, die imposante Kriegsruine eines Kaufhauses aus dem frühen 20. Jh., wurde nach der Wende von Künstlern besetzt und avancierte zu einem Hotspot der Off-Kultur Berlins. 2013 wurde das Tacheles zwangsgeräumt. Die Zukunft des Gebäudes, das - falls nicht eingerüstet - zuletzt noch an dem Mural How long is now zu erkennen war, ist ungewiss.
Das Verschwinden beider Institutionen ist ein weiterer Schritt hin zur kommerziellen Verödung der Oranienburger Straße. Alltagsläden und die witzigen Kneipen der Wendezeit sind längst verschwunden. Gesichtslose 08/15-Lokale mit aufdringlichen Kellnern und grölende Touristengruppen haben den Mythos Oranienburger Straße zum Berliner Ballermann degradiert. Nur eines hat sich auf der schon in den Goldenen Zwanzigern „Geile Meile“ genannten Straße nicht verändert: Ab Sonnenuntergang schwenken spacig aufgetakelte Bordsteinschwalben ihr Handtäschchen.
Kunst und jüdisches Berlin
Die Linienstraße aber ist noch immer eine der Galerienmeilen Berlins. Hier hat u. a. die → Galerie Neugerriemschneider, eine Institution in der Berliner Kunstlandschaft, ihren Sitz. Wir spazieren die Straße aber nicht bis zu ihrem Ende, sondern zweigen nach rechts in die Tucholskystraße und dann nach links in die Auguststraße ab, eine weitere wichtige Galerienstraße.
Gleich rechter Hand steht dort die ehemalige Jüdische Mädchenschule (Hnr. 11-13), ein eleganter Klinkerbau der Neuen Sachlichkeit, 1927/28 von Alexander Beer entworfen. Heute erfreuen darin „Pauly Saal“ und „M ogg & Melzer“ den Gaumen (→ Essen & Trinken), die Galerien Michael Fuchs und CWC (→ S. 197) das Auge. Zudem beherbergt das Haus die Ausstellung → The Kennedys.
Spannende zeitgenössische Kunst präsentieren u. a. auch das → KW Institute for Contemporary Art und der benachbarte → me Collectors Room auf der Straßenseite gegenüber. Etwas weiter wieder rechter Hand lohnt noch die Galerie → Eigen + Art einen Besuch.
Die Große Hamburger Straße (hier rechts abbiegen) führt wieder zurück in Richtung Hackescher Markt. Auf dem Weg passiert man das katholische St.-Hedwig-Krankenhaus, einen neogotischen Klinkerbau vom Ende des 19. Jh., und etwas weiter die Sophienkirche aus der ersten Hälfte des 18. Jh. Sie besitzt den einzigen noch erhaltenen barocken Kirchturm Berlins.
Die Große Hamburger Straße steht für eines der schrecklichsten Kapitel in der Geschichte des Berliner Judentums. Zwei Häuser hinter dem Zugang zur Sophienkirche befindet sich die Jüdische Oberschule (Hnr. 27), 1863 als Jüdische Knabenschule erbaut. Daneben stand einst das im Krieg zerstörte Jüdische Altersheim. 1942 wurden beide Gebäude in ein „Sammellager“ umfunktioniert: 55.000 Berliner Juden wurden von hier in die Konzentrationslager deportiert. Ein Mahnmal von Will Lammert erinnert daran. Kunst auch in der Häuserlücke gegenüber: das Mahnmal The Missing House von Christian Boltanski.
Im Hof des Altersheims lag der Alte jüdische Friedhof, heute eine efeubewachsene Fläche. Er wurde von 1671-1827 genutzt und 1943 von den Nazis zerstört. Ein einziges symbolisches Grabmal gedenkt hier des Philosophen Moses Mendelssohn (1729-1786). Ephraim Lessing machte ihn als Nathan der Weise unsterblich.