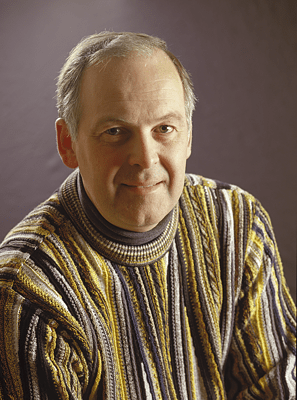9 Foto- und Bildrecht in Österreich und der Schweiz
Ein Blick über die Grenzen
Inwieweit lassen sich die Ausführungen zum deutschen Urheberrecht auf unsere Nachbarländer Österreich und Schweiz übertragen? In diesem Kapitel gehe ich auf die Abweichungen ein, die es in beiden Ländern gegenüber den deutschen Regelungen gibt.
Haben wir uns bislang – außer im Zusammenhang mit der Panoramafreiheit in Kapitel 2, »Natur, Architektur, Sachen und Tiere« – ausschließlich mit der rechtlichen Situation und dem Urheberrecht in Deutschland befasst, so werde ich mich in diesem Kapitel mit der Rechtslage in unseren deutschsprachigen Nachbarländern Österreich und Schweiz befassen. Dabei werde ich mich im Folgenden allerdings darauf beschränken müssen, die wesentlichen Unterschiede in beiden Ländern gegenüber der Rechtslage in Deutschland darzustellen. Es ist mir schon aus Platzgründen hier nicht möglich, mich mit allen Aspekten und Feinheiten des Bild- und Fotorechts in diesen beiden Ländern zu befassen und mich insbesondere mit der jeweils umfangreichen Rechtsprechung zum Thema Bild- und Fotorecht bis ins Detail auseinanderzusetzen. Eine solche Ausführlichkeit würde sicherlich den Umfang eines eigenen Buches annehmen.
[+] Konsultieren Sie im Streitfall einen Anwalt
Im Bewusstsein der zwangsläufigen Lückenhaftigkeit empfehle ich meinen Lesern aus Österreich und der Schweiz, im Streitfall unbedingt anwaltlichen Rat vor Ort einzuholen.
Die gesetzlichen Regeln in unseren Nachbarländern sind zu großen Teilen gleich oder sehr ähnlich, allerdings gibt es auch Abweichungen in beiden Ländern – sie sollen in diesem Kapitel näher dargestellt werden.
Die wichtigsten Paragrafen und ihre Regelungsinhalte werden in Anhang A in einer Tabelle einander gegenübergestellt, sodass Sie anhand der bisher zitierten Paragrafen des deutschen Urhebergesetzes herausfinden können, welche Paragrafen in den beiden Nachbarländern der deutschen Regelung entsprechen – soweit es eine Entsprechung gibt, was aufgrund unterschiedlicher Gesetzeskonzeptionen nicht immer der Fall ist, wie Sie im Folgenden erfahren.
9.1 Österreich
 Wie in Deutschland ist auch in Österreich die Basis des Bild- und Fotorechts das Österreichische Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (UrhG – im Wortlaut unter www.jusline.at zu finden, ebenso andere österreichische Gesetze). Da für dieses Gesetz üblicherweise die gleiche Abkürzung wie für das deutsche Urheberrechtsgesetz, nämlich UrhG, verwendet wird, werde ich das österreichische Gesetz zur besseren Unterscheidung im Folgenden mit »ÖUrhG« bezeichnen, betone jedoch, dass dies nicht die amtliche Abkürzung ist.
Wie in Deutschland ist auch in Österreich die Basis des Bild- und Fotorechts das Österreichische Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (UrhG – im Wortlaut unter www.jusline.at zu finden, ebenso andere österreichische Gesetze). Da für dieses Gesetz üblicherweise die gleiche Abkürzung wie für das deutsche Urheberrechtsgesetz, nämlich UrhG, verwendet wird, werde ich das österreichische Gesetz zur besseren Unterscheidung im Folgenden mit »ÖUrhG« bezeichnen, betone jedoch, dass dies nicht die amtliche Abkürzung ist.
Das ÖUrhG stammt aus dem Jahr 1936 und wurde seitdem mehrfach geändert, ergänzt und an EU-Richtlinien angepasst, zuletzt im Jahr 2015 vor allem durch Umsetzung weiterer EU-Richtlinien in nationales Recht. Davon war eine ganze Reihe von Vorschriften im ÖUrhG betroffen, ohne dass dadurch allerdings – jedenfalls bezüglich der in diesem Buch behandelten Themen – eine grundsätzliche Änderung der Rechtslage gegenüber der Rechtslage in Deutschland eingetreten ist. Aus diesem Grunde wird auf die Gesetzesänderungen in diesem Buch nur soweit eingegangen, als sich Abweichungen gegenüber der Vorauflage ergeben haben, da hier keine vollständige Darstellung der Rechtslage in Österreich erfolgen kann.
Viele Regelungen in Österreich sind mit denen im deutschen UrhG identisch, teilweise stimmen die Regelungen sogar im Wortlaut überein. Allerdings enthält das ÖUrhG zum Teil Definitionen, für die man in Deutschland den Gesetzeskommentar zurate ziehen muss, wie etwa zur Frage der Abgrenzung vom Lichtbildwerk zum Lichtbild, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde.
9.1.1 Grundlagen des Urheberrechts
In den urheberrechtlichen Grundlagen unterscheiden sich die Regelungen in beiden Ländern nicht. Der Ansatz im österreichischen Gesetz, wonach der Urheber der Schöpfer des Werkes ist (§ 10 ÖUrhG), zeitlebens auch Urheber bleibt und an seinem Werk nur Nutzungsrechte einräumen, das Urheberrecht jedoch nicht übertragen, wohl aber vererben kann (§ 23 ÖUrhG), entspricht exakt dem deutschen Grundansatz.
Dies gilt auch für den Schutzbereich des Gesetzes, der sich hier wie dort sowohl auf Lichtbildwerke als auch auf Lichtbilder erstreckt, mit dem aus dem deutschen Recht bekannten Unterschied in der Schutzdauer (70 Jahre ab dem Tod des Herstellers bei Lichtbildwerken, 50 Jahre ab Erscheinen bzw. Herstellung, siehe Abschnitt 1.1.10. Allerdings findet man im ÖUrhG – wie gerade bereits erwähnt – eine gesetzliche Definition, was ein Lichtbild ist, während es in § 72 des deutschen UrhG nur heißt:
[§] »Lichtbilder und Erzeugnisse, die ähnlich wie Lichtbilder hergestellt werden, werden in entsprechender Anwendung der für Lichtbildwerke geltenden Vorschriften des Teils 1 geschützt.«
Die Frage, was ein Lichtbild überhaupt ist, ergibt sich in Deutschland aus der Rechtsprechung. In § 73 Abs. 1 ÖUrhG heißt es:
[§] »Lichtbilder im Sinne dieses Gesetzes sind durch ein photographisches Verfahren hergestellte Abbildungen. Als photographisches Verfahren ist auch ein der Photographie ähnliches Verfahren anzusehen.«
Das ÖUrhG wiederholt dann in § 74 die für das Lichtbild geltenden Regelungen, während sich das deutsche UrhG in § 72 auf einen Verweis auf die Regelungen zu Lichtbildwerken beschränkt und auf Wiederholungen verzichtet. Inhaltliche Änderungen ergeben sich nicht, es handelt sich lediglich um eine andere Systematik im Gesetzesaufbau. Auch an anderen Stellen treten derartige Unterschiede auf. Darauf werde ich jedoch nicht näher eingehen, da sie keine inhaltlichen Auswirkungen haben.
Abbildung 9.1 Wie in Deutschland genießt auch dieser aus der Wartehalle des Moskauer Flughafens Scheremetjewo durch die Scheibe gemachte Schnappschuss in Österreich vollen Urheberrechtsschutz.
Auch in Österreich sind amtliche Werke vom Urheberschutz ausgenommen. Die dem § 5 UrhG entsprechende Regel des § 7 ÖUrhG nimmt jedoch in Absatz 2 ausdrücklich vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen hergestellte oder bearbeitete und zur Verbreitung bestimmte Landkartenwerke aus, die im Gegensatz zu den sonstigen amtlichen Werken keine freien Werke sind.
[ ! ] Amtliche Landkartenwerke teilweise geschützt
In Österreich sind Landkartenwerke nicht in jedem Fall freie Werke.
Für die Praxis bedeutet dies, dass das Abfotografieren von Landkartenwerken und die anschließende Veröffentlichung der genannten amtlichen Kartenwerke einen Urheberverstoß darstellen. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass durch einen Verkauf der Landkarten die hohen Aufwendungen für Erstellung und regelmäßige Aktualisierung ausgeglichen werden können. Ein freies Abfotografieren und zum Beispiel ein anschließendes Einstellen der Fotos der Kartenwerke im Internet würden dem natürlich zuwiderlaufen.
9.1.2 Urheberpersönlichkeitsrechte und Verwertungsrechte des Urhebers
Die Verwertungsrechte des Urhebers sind in beiden Ländern gleich geregelt, wenn auch teilweise an anderen Stellen im Gesetz verortet. Bezüglich der sogenannten Urheberpersönlichkeitsrechte gibt es allerdings insoweit einen Unterschied, als in Österreich das Veröffentlichungsrecht (§ 18a ÖUrhG) im Gegensatz zum deutschen UrhG (§ 12 UrhG) nicht zu den Urheberpersönlichkeitsrechten gehört. In beiden Ländern sind jedoch sowohl das Recht auf Namensnennung (§ 13 UrhG bzw. § 20 ÖUrhG) als auch das Recht des Verbots von Entstellungen und Beeinträchtigungen (§ 14 UrhG bzw. § 21 ÖUrhG) ein Urheberpersönlichkeitsrecht.
Anstelle des Veröffentlichungsrechts, das in Österreich kein Urheberpersönlichkeitsrecht ist, gibt es dort ein weiteres Urheberpersönlichkeitsrecht, das sich »Schutz der Urheberschaft« nennt und in § 19 ÖUrhG geregelt ist. Dort heißt es:
[§] »Wird die Urheberschaft an einem Werke bestritten oder wird das Werk einem anderen als seinem Schöpfer zugeschrieben, so ist dieser berechtigt, die Urheberschaft für sich in Anspruch zu nehmen. Nach seinem Tod steht in diesen Fällen den Personen, auf die das Urheberrecht übergegangen ist, das Recht zu, die Urheberschaft des Schöpfers des Werkes zu wahren. Ein Verzicht auf dieses Recht ist unwirksam.«
Hinter dieser Regelung, die im deutschen UrhG keine Entsprechung hat, steckt die Überlegung, dass der Urheber, dessen Urheberschaft bestritten wird, jederzeit in der Lage sein soll, Fehlvorstellungen über die Urheberschaft seines Werkes zu beseitigen, die dadurch entstehen, dass ein anderer das Urheberrecht entweder leugnet oder ein anderer als Urheber ausgewiesen wird. Durch eine Unterlassungsklage, auf die hin das Gericht nicht nur eine Feststellung der Urheberschaft vornimmt, sondern gleichzeitig dazu verurteilt, anderslautende Behauptungen zu unterlassen, kann der wahre Urheber in solchen Fällen dieses Urheberpersönlichkeitsrecht durchsetzen. Dieses Recht berührt jedoch nicht das Recht des Urhebers auf seine Anonymität, das sich aus § 20 ÖUrhG ergibt, entsprechend § 13 UrhG.
Allerdings sind die genannten Urheberpersönlichkeitsrechte im ÖUrhG, anders als bei uns, nicht vor den Verwertungsrechten (ab § 14 ÖUrhG) geregelt, sondern erst danach in §§ 19 bis 21. Eine Wertung des Gesetzgebers dürfte damit aber wohl kaum zum Ausdruck kommen.
9.1.3 Übertragung und Übergang von Nutzungsrechten
Wie bereits angesprochen, können sowohl in Deutschland als auch in Österreich nur Nutzungsrechte (im ÖUrhG »Werknutzungsrechte«) übertragen werden (§ 29 UrhG bzw. § 27 ÖUrhG). Ansonsten ist das Urheberrecht nur vererblich (§ 28 UrhG bzw. § 27 ÖUrhG).
In beiden Ländern können vom Urheber erteilte Nutzungsrechte nur mit Zustimmung des Urhebers übertragen werden. Dies ergibt sich aus § 34 UrhG bzw. § 27, 28 ÖUrhG. Während in Deutschland die Zustimmung nicht wider Treu und Glauben verweigert werden darf (§ 34 UrhG), je nach Umständen also ein einfacher, nachvollziehbarer und sachlicher Grund ausreicht, um die Zustimmung verweigern zu dürfen, regelt § 27 ÖUrhG weitergehend, dass die Einwilligung nur aus wichtigem Grund verweigert werden darf. Sie gilt als erteilt, wenn der Urheber sie nicht binnen zwei Monaten nach dem Empfang der schriftlichen Aufforderung des Werknutzungsberechtigten oder dessen, auf den das Werknutzungsrecht übertragen werden soll, versagt.
9.1.4 Zweckübertragungsgrundsatz contra Zweifelsregel des OGH
Was dem österreichischen Gesetz fehlt, ist eine Entsprechung zu § 31 Abs. 5 UrhG, dem sogenannten Zweckübertragungsgrundsatz. Sie erinnern sich (Abschnitt 1.2.3):
[ ! ] Der Zweckübertragungsgrundsatz
Wenn es keine oder nur eine unklare Vereinbarung zwischen den Parteien gibt, so ist im Zweifel das Nutzungsrecht nur insoweit übertragen worden, als es der Vertragszweck unbedingt erfordert. Der Umfang des übertragenen Nutzungsrechts richtet sich im Zweifelsfall also nach dem mit der Rechteübertragung verfolgten Zweck, woraus sich der Name des Grundsatzes ableitet.
Da es eine vergleichbare Gesetzesregel im ÖUrhG nicht gibt, wird in den Fällen, in denen unklar ist, welche Rechte eingeräumt worden sind, die sogenannte Zweifelsregel angewandt, die die Rechtsprechung entwickelt hat. Letztlich führt dies jedoch in den allermeisten Fällen zum gleichen Ergebnis – denn auch die Zweifelsregel besagt, dass derjenige, dem aufgrund eines Vertrags ein Werknutzungsrecht vom Urheber übertragen wurde, dieses nur in dem Umfang ausüben darf, wie dies der von den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss zugrunde gelegte Zweck erfordert.
Damit kann festgehalten werden, dass es zwar in Österreich keine gesetzliche Regelung gibt, die dem Zweckübertragungsgrundsatz entspricht, diese Lücke jedoch durch die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs (OGH), dem Pendant zum BGH in Deutschland, geschlossen wird.
[ ! ] Zweifelsregel
Die Zweifelsregelung, die von der Rechtsprechung entwickelt wurde, ersetzt in Österreich eine fehlende, dem Zweckübertragungsgrundsatz in § 31 Abs. 5 UrhG entsprechende gesetzliche Regelung.
9.1.5 Ausschließliches Nutzungsrecht und Urhebervorbehalt
Paragraf 31 Abs. 3 UrhG regelt, dass das ausschließliche Nutzungsrecht den Inhaber berechtigt, das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen, einschließlich des Fotografen selbst, auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte einzuräumen. Es kann aber bestimmt, also vertraglich vereinbart, werden, dass die Nutzung durch den Urheber selbst vorbehalten bleibt. Nach § 35 ÖUrhG steht dem Urheber hingegen, also auch ohne entsprechende vertragliche Regelung, immer eine gewisse Eigennutzung zu. Dort ist unter der Überschrift »Vorbehalt bei Werken der bildenden Künste« geregelt:
[§] »Der Urheber, der einem anderen das ausschließliche Recht eingeräumt hat, ein Werk der bildenden Kunst zu vervielfältigen und zu verbreiten, behält gleichwohl das Recht, es in Aufsätzen über die künstlerische Tätigkeit des Schöpfers des Werkes oder als Probe seines Schaffens zu vervielfältigen und zu verbreiten.«
Für den Fotografen folgt daraus, dass bei der Übertragung eines ausschließlichen Nutzungsrechts an den Fotografien das Recht zur Verwendung der Fotos im Rahmen der Eigenwerbung nicht, wie in Deutschland, ausdrücklich vereinbart werden muss. Da dieses Recht auch im Voraus vertraglich nicht ausschließbar ist, ist der Fotograf in der Nutzung im Rahmen seiner Kundengewinnung nicht beschränkt. Obwohl sich dies aus § 35 ÖUrhG nicht unmittelbar ergibt, fällt unter diese Vorschrift auch das Recht zum Einstellen auf der eigenen Website.
[ ! ] Recht zur Eigenwerbung
Auch bei der Gewährung ausschließlicher Nutzungsrechte behält der Urheber in Österreich ein Nutzungsrecht im Rahmen der Eigenwerbung.
9.1.6 Panoramafreiheit
Im Rahmen der Erörterung zur Panoramafreiheit haben wir in Abschnitt 2.2.5 bereits eine kleine Rundreise durch Europa gemacht und festgestellt, ob und wie die Panoramafreiheit des § 59 UrhG in anderen Ländern geregelt ist. Dabei haben Sie schon erfahren, dass es in Österreich eine etwas erweiterte Panoramafreiheit im Vergleich zur deutschen Regelung gibt.
Das ÖUrhG regelt die Panorama- oder Straßenbildfreiheit in § 54 Abs. 1 Ziffer 5. Der entsprechende Gesetzestext lautet:
[§] »Es ist zulässig, (…) Werke der Baukunst nach einem ausgeführten Bau oder andere Werke der bildenden Künste nach Werkstücken, die dazu angefertigt wurden, sich bleibend an einem öffentlichen Ort zu befinden, zu vervielfältigen, zu verbreiten, durch optische Einrichtungen öffentlich vorzuführen und durch Rundfunk zu senden und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen; ausgenommen sind das Nachbauen von Werken der Baukunst, die Vervielfältigung eines Werkes der Malkunst oder der graphischen Künste zur bleibenden Anbringung an einem Orte der genannten Art sowie die Vervielfältigung von Werken der Plastik durch die Plastik.«
Entscheidend für unsere Betrachtung ist der erste Halbsatz dieser Gesetzesregelung, und da können wir zunächst feststellen, dass diese Regelung im Grundsatz in den entscheidenden Passagen der deutschen Regelung in § 59 UrhG entspricht. Also: Werke der Baukunst und andere Werke der bildenden Künste, die sich bleibend an einem öffentlichen Ort (öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen) befinden, dürfen fotografiert werden.
Nun gibt es aber zwei wichtige Abweichungen von der deutschen Regelung, die dazu führen, dass die Panoramafreiheit in Österreich wesentlich weiter gefasst ist.
Innenräume | Wie Sie wissen, erstreckt sich die Panoramafreiheit in Deutschland bei Bauwerken nur auf die äußere Ansicht, so steht es in § 59 Abs. 2 Satz 2 UrhG. In Österreich fehlt dieser Zusatz im Gesetz, sodass hier auch das Innere eines Bauwerkes unter die Panoramafreiheit fällt, was allerdings nicht bedeutet, dass damit ein Zutrittsrecht verbunden ist. Aber Treppenhäuser, Innenhöfe, einzelne Zimmer und deren Bestandteile, zum Beispiel Stuckdecken, dürfen fotografiert und die Fotos anschließend verwertet werden – natürlich unter der Voraussetzung, dass sie nicht unter Verletzung des Hausrechts entstanden sind.
[zB] Der OGH hat mehrmals die Panoramafreiheit präzisiert und ausgeführt, dass Bauwerke sich im Gegensatz zu anderen Werken der bildenden Künste nicht an einem dem öffentlichen Verkehr dienenden Ort befinden müssen und dass ihre Abbildung nicht auf die Außenansicht beschränkt ist (Urteil vom 12.09.1989 – 4 Ob106/89). Dies folge aus der Tatsache, dass Innenarchitekturteile ebenfalls Werke der Baukunst seien. Demnach fallen selbst Einrichtungsgegenstände unter die freie Werknutzung, sofern sie in Verbindung mit einem bestimmten Raum und nicht allein vervielfältigt werden (Urteil vom 12.07.1994 – 4 Ob80/94). Die ideellen Interessen des Urhebers dürfen jedoch nicht verletzt werden, Sinn und Wesen des Werkes dürfen also nicht entstellt werden. Bearbeitungen sind ebenso unzulässig (Urteil vom 26.04.1994 – 4 Ob 51/94, dem der Sachverhalt zugrunde lag, dass auf Weinflaschenetiketten das Hundertwasserhaus verzerrt dargestellt worden war). Der Abbildung in einem Gemälde oder in einer Grafik werde zwar ein relativ großer Spielraum eingeräumt, eine stilisierte Darstellung gelte jedoch nicht mehr als Abbildung (Urteil vom 26.04.1994 – 4 Ob51/94).
In einem weiteren Urteil hat der OGH festgestellt, dass ein Wahlkampfplakat dagegen nicht bleibend ist und damit nicht unter die Panoramafreiheit fällt (Urteil vom 31.05.1988 – 4 Ob 23/88). Das Fotografieren von Schaufenstern erscheint vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung – im Gegensatz zur Rechtslage in Deutschland – nicht als problematisch.
Allerdings und insoweit besteht eine Einschränkung gegenüber der deutschen Regelung: das Bauwerk muss errichtet (»ausgeführt«) sein. In der Regel wird dies jedoch ohnehin der Fall sein.
[ ! ] Innenansichten fallen unter die Panoramafreiheit
Im Gegensatz zur Rechtslage in Deutschland fallen in Österreich auch Innenaufnahmen und Aufnahmen von Einrichtungen unter die Panoramafreiheit.
Hilfsmittel | In Abschnitt 2.2.4 haben wir festgestellt, dass die Panoramafreiheit in Deutschland, ohne dass dies im Gesetzestext explizit erwähnt wird, nur für solche Vervielfältigungen gilt, die ohne Hilfsmittel hergestellt werden. Dieses Kriterium hat die Rechtsprechung zusätzlich entwickelt, weil sie von jeher die Straßenbildfreiheit so verstanden hat, dass darunter nur das fällt, was man sieht, wenn man mit beiden Beinen auf dem Boden steht, man also die Perspektive eines Fußgängers hat. Das Fotografieren von einer Leiter oder Hebebühne fällt nach deutschem Recht eindeutig nicht mehr unter die Panoramafreiheit des § 59 UrhG.
Anders ist das in Österreich. Hier hat die Rechtsprechung diese Einschränkung nicht vorgenommen – mit der Folge, dass auch Hilfsmittel verwendet werden dürfen oder ein erhöhter Standpunkt, etwa ein Balkon, eingenommen werden kann. Das Bild des Hundertwasserhauses, das vom Balkon des gegenüberliegenden Hauses aufgenommen wurde, entsprach somit in vollem Umfang dem § 54 Abs. 1 Nr. 5 ÖUrhG und war von der Panoramafreiheit gedeckt.
[ ! ] Hilfsmittel
Hilfsmittel dürfen in Österreich im Rahmen der Panoramafreiheit ebenso verwendet werden, wie es zulässig ist, von einem erhöhten Standpunkt aus zu fotografieren.
Damit hätten die Fotografen, die das Hundertwasserhaus vom gegenüberliegenden Haus fotografiert haben, das Bild in Österreich veröffentlichen dürfen.
Abbildung 9.2 Diese Aufnahme darf nach österreichischem Recht auch vom Balkon des hinter dem Fotografen befindlichen Hauses aufgenommen werden.
Anonyme und pseudonyme Werke | Bis zur Gesetzesnovelle 2015 gab es auch in Österreich ein Urheberregister beim Bundesministerium für Justiz, zu dem anonyme und pseudonyme Werke angemeldet werden konnten, entsprechend dem Register, das in Deutschland beim Bundespatentamt geführt wird (§ 138 UrhG). Dieses Register wurde durch die Gesetzesnovelle 2015 abgeschafft, nachdem man festgestellt hatte, dass ihm keine praktische Bedeutung zugekommen war. Die entsprechenden §§ 61a bis 61c ÖUrhG wurden aufgehoben.
Urheberpersönlichkeitsrechte nach Ablauf der Schutzfristen | Einen erwähnenswerten Unterschied zwischen den Regelungen in Deutschland und in Österreich gibt es jedoch bezüglich der Dauer der Urheberpersönlichkeitsrechte bei anonymen oder pseudonymen Werken, auch wenn die Fälle einer anonymen oder pseudonymen Veröffentlichung nicht unbedingt häufig sein werden:
Berücksichtigt man, dass die Schutzfrist für anonyme und pseudonyme Werke 70 Jahre nach der Veröffentlichung bzw. 70 Jahre nach der Schaffung des Werkes (sofern nicht innerhalb der Frist veröffentlicht) beträgt (§ 66 Abs. 1 UrhG bzw. § 61 ÖUrhG), so sind Fälle denkbar, dass noch zu Lebzeiten des Urhebers die Schutzfristen auslaufen, auch wenn es sich dabei zugegebenermaßen um seltene Fälle handeln dürfte.
Nach völlig einhelliger Meinung erlöschen nach deutschem Recht mit Ablauf der Schutzdauer von 70 Jahren alle Rechte am Werk und dieses wird »gemeinfrei«. Das bedeutet, dass es zum Beispiel auch entstellt und bearbeitet werden darf, weil auch die Urheberpersönlichkeitsrechte mit Ablauf der Schutzfrist untergehen. Hingegen sieht § 65 ÖUrhG vor, dass die Urheberpersönlichkeitsrechte bestehen bleiben:
[§] »Der Schöpfer kann die ihm nach den §§ 19 und 21 Abs. 3 zustehenden Rechte (Anmerkung des Autors: d. h. Inanspruchnahme der Urheberschaft und Verhinderung von Entstellungen) Zeit seines Lebens geltend machen, wenngleich die Schutzfrist schon abgelaufen ist.«
Der Fotograf, der seine Fotografie unter einem Pseudonym veröffentlicht hat, muss es nach österreichischem Recht also nicht dulden, dass sein Werk nach Ablauf der Schutzfrist entstellt oder entgegen § 21 Abs. 3 ÖUrhG bearbeitet wird und dass damit die geistigen Interessen an seinem Werk tangiert werden.
Nach der Gesetzeslage können in Österreich die Urheberpersönlichkeitsrechte nach §§ 19 und 21 Abs. 3 ÖUrhG auch nach dem Ablauf der Schutzfristen, also für ansonsten gemeinfreie und damit für Dritte nutzbare Werke, geltend gemacht werden, längstens jedoch bis zum Tod des Urhebers. Erst mit dem Tod des Urhebers erlöschen dessen Urheberpersönlichkeitsrechte. Eine entsprechende Regelung ist dem deutschen Urheberrecht fremd.
9.1.7 Abwehr von Urheberrechtsverletzungen
Auch bei der Durchsetzung der Rechte des Fotografen bei Vorliegen einer Verletzung seines Urheberrechts gibt es Unterschiede in beiden Ländern, die auch mit anderen prozessualen Vorschriften zusammenhängen, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. Diesbezüglich möchte ich Ihnen ohnehin, wie bereits ausgeführt, dringend empfehlen, bei der Einleitung rechtlicher oder gar gerichtlicher Schritte professionelle Hilfe durch örtliche Anwälte in Anspruch zu nehmen.
Sie haben bereits bei der Erörterung der prozessualen Möglichkeiten in Deutschland (Kapitel 6, »Rechte schützen«) gesehen, dass vor der Einleitung gerichtlicher Schritte eine Abmahnung erfolgen soll (§ 97a UrhG), wobei die Abgabe einer außergerichtlichen strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung die Wiederholungsgefahr beseitigt.
Auch nach der österreichischen Rechtslage wird zunächst die Wiederholungsgefahr vermutet, wenn ein rechtswidriges Verhalten vorliegt. Anders als in Deutschland beseitigt eine außergerichtliche Erklärung jedoch nicht die Wiederholungsgefahr, was nicht bedeutet, dass in der Praxis der Verletzte sich damit häufig zufrieden geben wird. Die Rechtsprechung in Österreich geht jedoch davon aus, dass eine Wiederholungsgefahr erst dann nicht mehr vorliegt, wenn vor Gericht ein sogenannter Unterlassungsvergleich abgeschlossen wurde, der einen vollstreckbaren Titel darstellt.
[ ! ] Wiederholungsgefahr nur durch Unterlassungsvergleich beseitigt
Zur Beseitigung der Wiederholungsgefahr genügt es in Österreich nicht, eine außergerichtliche Erklärung abzugeben, auch wenn sich der Verletzte in der Praxis oft damit zufriedengibt.
Somit wird derjenige, der in Österreich wegen einer Verletzung der Bildrechte in Anspruch genommen wird, zunächst eine außergerichtliche Unterlassungserklärung abgeben, die auch die Erklärung zum Schadensersatz enthält. Für den Fall, dass der Verletzte jedoch mitteilt, dass ihm diese Erklärung nicht ausreicht, sollte sinnvollerweise ein vor dem Gericht abzuschließender Unterlassungsvergleich angeboten werden.
Während in Deutschland bei einer Urheberrechtsverletzung nach § 98 Abs. 1 UrhG die Vernichtung des rechtswidrig hergestellten oder verbreiteten Vervielfältigungsstücks verlangt werden kann, soweit dies im Einzelfall nicht unverhältnismäßig ist, gibt es in § 83 Abs. 1 ÖUrhG für den Vernichtungsanspruch eine bedeutsame Einschränkung:
[§] »Ist ein Urstück eines Werkes der bildenden Kunst unbefugt geändert worden, so kann der Urheber, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, nur verlangen, daß die Änderung auf dem Urstück als nicht vom Schöpfer des Werkes herrührend gekennzeichnet oder daß eine darauf befindliche Urheberbezeichnung beseitigt oder berichtigt werde.«
Im Klartext heißt dies: Wenn ein Foto bereits verändert worden ist, dann kann der Fotograf auf rechtlichem Wege weder die Vernichtung des Fotos verlangen noch ist es im Regelfall möglich, die Wiederherstellung des Originals zu erreichen. Hat zum Beispiel der Fotograf jemandem das Nutzungsrecht an einem Foto übertragen, dieser jedoch das Foto einer Änderung unterzogen, mit der der Fotograf nicht einverstanden ist, kann der Fotograf – der nach wie vor das alleinige Recht zur Vornahme von Änderungen an seinem Foto hat – vom Verletzer verlangen, dass an dem Foto ein Hinweis angebracht wird, aus dem sich ergibt, dass die vorgenommenen Änderungen nicht vom Fotografen stammen.
Ist allerdings eine Wiederherstellung des ursprünglichen Werkzustands möglich, so steht dem Fotografen ein Wiederherstellungsanspruch zu. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Veränderungen mittels Bildbearbeitung wieder rückgängig gemacht werden können. Dies ergibt sich aus § 83 Abs. 2 ÖUrhG:
[§] »Ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands möglich und stehen ihr nicht überwiegende öffentliche Interessen oder überwiegende Interessen des Eigentümers entgegen, so kann der Schöpfer des Werkes nach seiner Wahl an Stelle der im Absatz 1 bezeichneten Maßnahmen verlangen, daß ihm die Wiederherstellung gestattet werde.«
Im Zusammenhang mit der Erörterung des Schadensersatzanspruchs haben Sie gesehen, dass ein Schadensersatzanspruch des in seinen Rechten verletzten Urhebers nur bei Verschulden, d. h. bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Verletzers, in Betracht kommen kann. Im deutschen Recht gilt also – dies zur Erinnerung: ohne Verschulden kein Schadensersatzanspruch.
Die Gesetzgebung in Österreich geht im Urheberrecht einen anderen Weg. Nach § 86 ÖUrhG hat derjenige, der unbefugt ein Lichtbildwerk oder ein Lichtbild auf eine dem Urheber vorbehaltene Verwertungsart benutzt, auch wenn ihn kein Verschulden trifft, dem Verletzten, dessen Einwilligung einzuholen gewesen wäre, ein angemessenes Entgelt zu zahlen. Was dabei angemessen ist, richtet sich danach, was üblicherweise zu zahlen gewesen wäre, hätte der Verletzer vom Urheber ordnungsgemäß eine Lizenz erworben. Damit ist ein Entgelt des Verletzten nach der Lizenzanalogie im österreichischen Gesetz normiert. Ob es allerdings in Österreich ein Pendant zur MFM-Liste in Deutschland gibt, ist mir nicht bekannt.
[ ! ] Gesetzlich normierter Lizenzanalogieanspruch
Der Anspruch auf eine angemessene, verschuldensunabhängige Entschädigung ist im Gegensatz zur Rechtslage in Deutschland in Österreich gesetzlich normiert.
Daneben gibt es nach § 87 ÖUrhG auch noch einen Schadensersatz auf Ausgleich des entgangenen Gewinns, der allerdings verschuldensabhängig ist. Es muss somit beim Verletzer mindestens Fahrlässigkeit vorgelegen haben. Um den Gewinn ermitteln zu können, stehen dem Verletzten umfangreiche Auskunftsansprüche zu, die in §§ 87a und 87b ÖUrhG geregelt sind. Aber auch hier gilt wie in Deutschland, dass es in der Praxis häufig schwierig sein wird, den entgangenen Gewinn schlüssig nachzuweisen. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber in § 87 Abs. 3 ÖUrhG vorgesehen, dass der Verletzte, wenn kein höherer Schaden nachgewiesen wird, als Schadensersatz das Doppelte des angemessenen Entgeltes nach § 86 ÖUrhG geltend machen kann. Wer allerdings das angemessene Entgelt nach § 86 ÖUrhG und den Schadensersatz nach § 87 ÖUrhG geltend macht, erhält nur maximal den zweifachen Betrag des angemessenen Entgeltes nach § 86 ÖUrhG.
Das Recht, Ansprüche und Rechte durch eine einstweilige Verfügung zu sichern, ist im deutschen UrhG nicht speziell geregelt, sondern ergibt sich aus den allgemeinen Vorschriften der Zivilprozessordnung (ZPO). Im ÖUrhG dagegen ist in § 87c das Recht, Ansprüche mit einstweiliger Verfügung zu sichern, ausdrücklich geregelt.
[ ! ] Einstweilige Verfügung
Das Rechtsmittel der einstweiligen Verfügung ist in Österreich im Urheberrechtsgesetz ausdrücklich geregelt, während es sich in Deutschland aus der Zivilprozessordnung (ZPO) ergibt.
Weitere Ausführungen zu Einzelheiten der prozessualen Durchsetzung von Rechten in Österreich kann ich an dieser Stelle nicht vornehmen, weil mir die dazu erforderliche Kompetenz mangels Erfahrung fehlt.
9.1.8 Strafvorschriften
Eine Verletzung urheberrechtlicher Vorschriften kann auch in Österreich auf Antrag strafrechtlich geahndet werden. Das Strafmaß ist allerdings deutlich milder als die Strafen, die in Deutschland verhängt werden können. Während in Deutschland Freiheitsstrafen von bis zu drei, bei gewerblicher Verletzung von bis zu fünf Jahren verhängt werden können, liegt das Strafmaß in Österreich bei sechs Monaten bzw. bei gewerblicher Verletzung bei zwei Jahren. Einzelheiten sind in § 91 ff. ÖUrhG geregelt.
9.1.9 Der Bildschutz und das Persönlichkeitsrecht in Österreich
In Österreich gibt es keine dem Kunsturhebergesetz (KUG) für das Recht am eigenen Bild entsprechende gesetzliche Vorschrift. Sie werden sich erinnern, dass wir in Kapitel 3, »Menschen«, festgestellt haben, dass kein Bildnis ohne Einwilligung veröffentlicht werden darf, wenn nicht die in § 23 näher beschriebenen und oben ausführlich behandelten Ausnahmetatbestände vorliegen.
Der Bildnisschutz in Österreich, d. h. das Recht der ohne Einwilligung fotografierten Person, ergibt sich aus § 78 ÖUrhG:
[§] »Bildnisse von Personen dürfen weder öffentlich ausgestellt noch auf eine andere Art, wodurch sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, verbreitet werden, wenn dadurch berechtigte Interessen des Abgebildeten oder, falls er gestorben ist, ohne die Veröffentlichung gestattet oder angeordnet zu haben, eines nahen Angehörigen verletzt würden.«
Das bedeutet, dass es den restriktiven Schutz des Persönlichkeitsrechts, der nach den deutschen Gesetzen gegeben ist, in Österreich nicht gibt. Nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut kann eine fotografierte Person nichts gegen die Veröffentlichung ihres Bildnisses unternehmen, solange dadurch ihre berechtigten Interessen nicht verletzt werden. Prominente, wie Politiker, Sportler und Künstler fallen dabei unter einen eingeschränkten Schutzbereich, was im Rahmen der Prüfung, ob nach § 78 ÖUrhG berechtigte Interessen verletzt werden, berücksichtigt wird. Das bedeutet umgekehrt, dass es nicht grundsätzlich verboten ist, ein Bildnis anzufertigen und zu verbreiten bzw. zu veröffentlichen. Nur wenn dabei schutzwürdige Interessen verletzt werden, steht der fotografierten Person ein Recht auf Unterlassung zu. Als schutzwürdige Interessen gelten dabei zum Beispiel die Verletzung der Privatsphäre, geheime Bildaufnahmen im Privatbereich, die Belagerung durch Paparazzi und herabwürdigende Darstellungen, wie sie zum Beispiel bei Nacktaufnahmen vorliegen können. Nach herrschender Meinung bietet § 78 ÖUrhG jedoch keinerlei Schutz gegen die ungewollte Aufnahme von Bildern.
So jedenfalls sind die Gesetzeslage und die bisherige Rechtsprechung, die sich in vielen Fällen mit Fragen des Bildnisschutzes und Persönlichkeitsrechts auseinanderzusetzen hatte.
Abbildung 9.3 Dieses Foto ist nach bisheriger Rechtslage in Österreich ohne Weiteres auch ohne Einwilligung zulässig, da berechtigte Interessen der abgebildeten Person offensichtlich nicht verletzt werden.
Tendenzwende durch Rechtsprechung des OGH | Es scheint sich jedoch gerade eine Trendwende im österreichischen Bildnisschutz abzuzeichnen, eingeleitet durch eine Entscheidung des OGH vom 27.02.2013 (6Ob256/12 h). Mit diesem Urteil hat der OGH, angelehnt an den deutschen BGH, entschieden, dass bereits die Herstellung eines Bildnisses ohne Einwilligung der fotografierten Person(en) eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts sein kann.
[zB] Dem vom OGH entschiedenen Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein Rechtsanwalt war anlässlich eines Ortstermins in einer baurechtlichen Auseinandersetzung vom Beklagten, dem Besitzer des Hauses, in dem der Ortstermin stattfand, ohne sein Einverständnis fotografiert worden – gemeinsam mit weiteren Personen, die bei dem Termin ebenfalls anwesend waren. Auf die Frage des Anwalts und späteren Klägers, warum der Beklagte die Bilder angefertigt habe, gab dieser die fragwürdige Antwort, dass er die Fotos »zur Belustigung« gemacht habe. Nachdem er der Aufforderung des Rechtsanwalts, die Bilder zu löschen, nicht nachgekommen war, klagte dieser auf Unterlassung.
Der OGH gab dem Kläger recht und führte unter Berufung auf die Rechtsprechung des deutschen BGH, die tendenziell bereits die Herstellung von Personenaufnahmen ohne Einwilligung als Persönlichkeitsrechtsverletzung einstuft, aus:
[§] »Der erkennende Senat schließt sich der Auffassung des deutschen Bundesgerichtshofs an. (…)
Das Recht am eigenen Bild stellt eine besondere Erscheinungsform des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar. Daher kann bereits die Herstellung eines Bildnisses ohne Einwilligung des Abgebildeten einen unzulässigen Eingriff in dessen allgemeines Persönlichkeitsrecht darstellen. Dabei wird das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen nicht nur dann verletzt, wenn Abbildungen einer Person in deren privatem Bereich angefertigt werden, um diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Vielmehr kann auch die Herstellung von Bildnissen einer Person in der Öffentlichkeit zugänglichen Bereichen und ohne Verbreitungsabsicht einen unzulässigen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen darstellen.«
Zwar bedarf es nach OGH – wie auch nach BGH – einer Interessenabwägung im Einzelfall. Es kommt auch entscheidend darauf an, ob und wie gut die abgebildete Person erkennbar ist, ob sie zielgerichtet fotografiert wurde oder das Interesse des Fotografen eigentlich auf etwas anderes gerichtet war. Die Aussage des Beklagten, er habe die Fotos nur »zur Belustigung« gemacht, war sicherlich nicht geeignet, ein schützenswertes Interesse des Beklagten erkennen zu lassen, der deshalb auch antragsgemäß zur Unterlassung verurteilt wurde. Als nicht entscheidend hat der OGH dabei im Übrigen die Tatsache angesehen, dass die Aufnahme im Zusammenhang mit einer Befundaufnahme durch den Sachverständigen gemacht worden war. Die Wiederholungsgefahr sah das Gericht auch als gegeben an, da der Beklagte sich geweigert hatte, die Aufnahme zu löschen, und seine Handlung im Verfahren noch verteidigt hatte.
Auch wenn – wie der OGH festgestellt hat – in jedem Einzelfall eine Interessenabwägung zwischen Fotograf und Fotografiertem erforderlich ist, ist dieses Urteil für den Bildnisschutz in Österreich von weitreichender Bedeutung, der damit deutlich restriktiver geworden ist und in der Zukunft möglicherweise sein wird, als dies bisher der Fall war.
Gerade im Hinblick auf das Prüfkriterium der Zielgerichtetheit der Aufnahme bleibt es jedoch dabei, dass auch in Zukunft Urlaubs- oder Partybilder, auf denen Personen zu erkennen sind, keine rechtlichen Probleme bereiten dürften. Allerdings wird die weitere Entwicklung der Rechtsprechung dazu abzuwarten sein.
[ ! ] Annäherung an die deutsche Rechtsprechung
Waren bislang in Österreich Herstellung und Veröffentlichung von Personenaufnahmen unproblematisch, solange dadurch berechtigte Interessen der fotografierten Person nicht verletzt wurden, kann nach der neuesten Rechtsprechung des OGH zumindest in bestimmten Fällen bereits die Herstellung von Aufnahmen eine Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellen.
9.1.10 Der postmortale Persönlichkeitsschutz
Da es in Österreich keine dem § 22 KUG vergleichbare Vorschrift gibt, wonach eine Veröffentlichung von Bildnissen noch zehn Jahre nach dem Tod der Einwilligung der Angehörigen bedarf, stellt sich die Frage, ob die Persönlichkeitsrechte nach österreichischem Recht mit dem Tod untergehen oder ob es insoweit einen postmortalen Urheberschutz gibt.
Von Letzterem geht der OGH aus und führt in seiner Entscheidung vom 29.08.2002 (6 Ob 283/01) aus:
[§] »Obwohl die Persönlichkeitsrechte zu den unvererblichen Rechten zählen, steht dies einem postmortalen Persönlichkeitsschutz nicht entgegen. Der OGH hat bereits wiederholt ausgesprochen, dass die Bestimmung des § 16 ABGB nicht als bloßer Programmsatz, sondern als Zentralnorm unserer Rechtsordnung anzusehen ist, da sie die Persönlichkeit als Grundwert anerkennt. Für Erben und nahe Angehörige wird die Schutzwürdigkeit der Ehre und der Privatsphäre des Verstorbenen bejaht und ausgeführt, dass Persönlichkeitsrechte insg. den Zweck haben, die freie Entfaltung der Persönlichkeit möglichst weitgehend zu gewährleisten. Da dieses Ziel nur verwirklicht werden kann, wenn auch nach dem Tod ein gewisser Schutz bestehen bleibe, geht der OGH somit vom Bestehen eines postmortalen Persönlichkeitsrechtes aus. Auch die dt. Rspr. anerkennt ein allgemeines postmortales Persönlichkeitsrecht, da es allgemein anerkannt sei, dass der Verstorbene nicht nur übertragbare materielle Werte hinterlasse, sondern dass auch immaterielle Güter seinen Tod überdauerten, die verletzbar und auch nach dem Tod noch schutzwürdig seien. Da das fortwirkende Lebensbild eines Verstorbenen wenigstens gegen grobe ehrverletzende Beeinträchtigungen weiterhin geschützt ist, werden nahe Angehörige daher grundsätzlich als prozessführungsbefugt angesehen. Auch die österr. Lehre anerkennt den Schutz der Persönlichkeit eines Verstorbenen selbst über dessen Tod hinaus. Das aus § 16 ABGB abzuleitende Persönlichkeitsrecht beruhe zudem auf Wertungen, die aus einer Reihe von Vorschriften, die über die gesamte Rechtsordnung verstreut seien, hervorkommen. Diese hätten den Zweck, die freie Entfaltung der Persönlichkeit möglichst weitgehend zu gewährleisten. Dieses Ziel könne nur verwirklicht werden, wenn auch nach dem Tod ein gewisser Schutz bestehen bleibe.«
Dies trifft allerdings nicht ganz den Kern des § 22 KUG, der ja schon für die Veröffentlichung eines Bildnisses nach dem Tode des Abgebildten die Einwilligung der Angehörigen fordert. Mangels einer vergleichbaren Regelung kann das Bildnis, das von einem Verstorbenen zu Lebzeiten gemacht wurde, ohne die Einwilligung der Angehörigen veröffentlicht werden. Dabei ist allerdings der postmortale Persönlichkeitsschutz zu beachten, der jedoch zeitlich nicht ausdrücklich befristet ist. Es wird deshalb – wie im deutschen Recht – davon auszugehen sein, dass der postmortale Persönlichkeitsschutz mit zunehmendem zeitlichen Abstand zum Tod immer mehr verblasst.
9.1.11 Multicopter – das Recht in Österreich
Auch in Österreich erfreuen sich unbemannte Luftfahrzeuge wachsender Beliebtheit. Im Jahr 2015 wurden dort laut einem Bericht des ORF ca. 20.000 Stück an private Endverbraucher verkauft.
Die Bestimmungen im österreichischen Luftfahrtgesetz (LFG) | Der Gesetzgeber in Österreich hat bereits auf die zunehmende Zahl von unbemannten Fluggeräten, die den Himmel bevölkern, reagiert und zum 01.01.2014 ein »Drohnen-Gesetz« in Kraft gesetzt, das jedoch nur im alltäglichen Sprachgebrauch auch so bezeichnet wird. Genau genommen handelt es sich um eine Novellierung des Luftfahrtgesetzes (LFG), und zwar speziell um die Einfügung der zusätzlichen Paragraphen 24c bis 24l in das LFG. Der Begriff »Drohne« wird dabei vom Gesetzgeber überhaupt nicht verwendet. In Österreich ist in den offiziellen Vorschriften stets von »unbemannten Luftfahrzeugen (ULFZ)« die Rede, sodass ich im Nachfolgenden diesen Begriff ebenfalls verwenden werde.
Die Vorschriften in Österreich sind zum einen auf den ersten Blick recht kompliziert und verwirrend. Zudem beinhalten sie auch, wie Sie sehen werden, weitaus stärkere Einschränkungen als die Regelungen in Deutschland, sodass sich der Leser aus Österreich keinesfalls an den für Deutschland geltenden Bestimmungen orientieren darf.
Die Komplexität der österreichischen Regelungen, die nebenbei die strengsten Vorschriften für Multicopterflüge in Europa sind, resultieren daraus, dass die ULFZ zunächst einmal in verschiedene Klassen eingeteilt werden, und zwar in:
- Spielzeuge (ohne Kamera)
- Flugmodelle (ohne Kamera)
- Flugmodelle über 25 kg (ohne Kamera)
Für Fluggeräte, die eine Kamera an Bord haben, gibt es wiederum zwei Klassen, nämlich:
- Klasse 1 ULFZ
- Klasse 2 ULFZ
Daneben gibt es für die Klasse 1 ULFZ noch vier unterschiedliche Einsatzgebiete, I bis IV, die wiederum zusammen mit dem Gewicht des ULFZ zu bestimmten Kategorien (A bis D) von ULFZ führen, für welche dann jeweils gesonderte Anforderungen für eine Bewilligung gelten. Nach Einsatzgebieten wird unterschieden in:
- Einsatzgebiet I – unbebautes Gebiet
- Einsatzgebiet II – unbesiedeltes Gebiet
- Einsatzgebiet III – besiedeltes Gebiet
- Einsatzgebiet IV – dicht besiedeltes Gebiet
Mit diesen Klassen und Einsatzgebieten werden wir uns gleich etwas näher befassen.
Zunächst möchte ich an dieser Stelle nur ganz kurz auf die Klassen Spielzeuge, Flugmodelle und Flugmodelle über 25 kg eingehen, da hierunter nur solche Fluggeräte fallen, die nicht mit einer Kamera ausgestattet sind. Da die Zielgruppe dieses Buches in erster Linie aus Fotografen und Videografen besteht, gehe ich davon aus, dass Vorschriften über kameralose Fluggeräte für Sie nur von untergeordnetem Interesse sind. Als Spielzeuge, die auch nicht unter die Bestimmungen des LFG fallen (§ 24d LFG), gelten nur unbemannte Luftfahrzeuge bis zu einer Bewegungsenergie von maximal 79 Joule (was ca. 250 g Gewicht entspricht), die nicht höher als 30 m über dem Grund geflogen werden. Diese Fluggeräte können bewilligungsfrei betrieben werden. Gleiches gilt für Flugmodelle mit einem Gewicht bis 25 kg (§ 24c Abs. 2 LFG), die ebenfalls ohne Bewilligung betrieben werden dürfen, wobei der Pilot in beiden Klassen stets darauf zu achten hat, dass durch den Betrieb dieser Flugmodelle keine Personen oder Sachen gefährdet werden. Flugmodelle mit einem Gewicht über 25 kg dürfen grundsätzlich nur mit einer Bewilligung betrieben werden (§ 24 c Abs. 3 LFG).
Sobald ein ULFZ mit einer Kamera ausgestattet ist, bedarf es zum Betrieb grundsätzlich und ausnahmslos einer luftfahrtrechtlichen Bewilligung, die im Übrigen vom Piloten immer mitgeführt werden muss, wenn das ULFZ zum Einsatz kommt. Die Bewilligung ist unabhängig vom Gewicht des ULFZ einzuholen und gleichgültig, ob es privat oder gewerblich genutzt wird. Eine solche Bewilligung wird in Österreich ausschließlich von der dortigen Luftüberwachungsbehörde Austro Control GmbH (AC) erteilt, wobei die Art der Bewilligung und deren Voraussetzungen im Einzelfall davon abhängen, in welche Klasse und Kategorie das ULFZ fällt. Bewilligungsverfahren dauern in der Regel sechs bis acht Wochen, und die Kosten, die dafür anfallen, belaufen sich in der Regel auf etwa 300 €, richten sich jedoch grundsätzlich nach dem Aufwand, den die AC mit der Erteilung der Bewilligung hat, was bedeutet, dass sie im Einzelfall auch niedriger oder höher ausfallen können. Mit Erteilung der Bewilligung erhält der Betreiber ein Datenschild mit einer Ordnungsnummer, ähnlich der Plakette in Deutschland, die am ULFZ haltbar zu befestigen ist. Damit kann der Eigentümer eines ULFZ jederzeit identifiziert werden.
Die Systematik der gesetzlichen Vorschriften lässt erkennen, dass der Gesetzgeber vordringlich auf das Gefährdungspotenzial eines ULFZ abgestellt hat. Um den richtigen Bewilligungsantrag stellen zu können, muss der Betreiber eines ULFZ also zunächst bestimmen, in welche Klasse gemäß § 24 f LFG sein Fluggerät einzuordnen ist, und sodann das gewünschte Einsatzgebiet festlegen. Daraus ergibt sich dann, in welche Kategorie das ULFZ fällt und welchen Bewilligungsantrag der Betreiber bei der AC stellen muss. Die Einordnung in die verschiedenen Klassen, Einsatzgebiete und Kategorien bedingt, dass es für den einen oder anderen Hobbypiloten eines ULFZ wohl gar nicht so leicht sein mag, den richtigen Bewilligungsantrag für sein Fluggerät zu stellen. Dies dürfte auch der Grund dafür sein, dass es spezielle Seiten im Internet gibt, wie zum Beispiel www.drohnenbewilligung.at, auf denen damit geworben wird, bei der Stellung des Bewilligungsantrags behilflich zu sein.
Die zwei Klassen der ULFZ | Zunächst möchte ich die Klasseneinteilung bei den ULFZ darstellen. Es gibt, wie bereits erwähnt, zwei Klassen von ULFZ:
Nach § 24 f LFG fallen in die Klasse 1 alle ULFZ mit einem Gewicht von maximal 150 kg, die gewerblich oder zu einem anderen Zweck als dem Flug selbst (also zum Beispiel für Foto- und Filmaufnahmen) und mit Sichtverbindung von maximal 500 m zum Piloten betrieben werden.
Nach § 24 g LFG beinhaltet die Klasse 2 alle ULFZ mit den Spezifikationen der Klasse 1, welche jedoch ohne Sichtverbindung zum Piloten betrieben werden.
Der Unterschied zwischen beiden Klassen besteht somit lediglich darin, dass Klasse 1 diejenigen ULFZ umfasst, die mit Sichtverbindung betrieben werden, die Klasse zwei dagegen solche, die ohne Sichtverbindung eingesetzt werden. Für die Klasse 2 gelten naturgemäß verschärfte Bedingungen, hier sind gemäß § 24g LFG sämtliche für zivile Luftfahrzeuge und deren Betrieb geltende Bestimmungen anzuwenden, d. h., sie werden von der AC auch wie Zivilluftfahrzeuge zertifiziert und zugelassen, wobei eine Erfüllung von Bauvorschriften bzw. eine Musterprüfung notwendig ist und überprüft wird. Der Betreiber von ULFZ benötigt zudem eine Pilotenlizenz. Damit steht fest, dass in Österreich das sogenannte autonome Fliegen nach GPS oder durch Gesichtserkennung im Follow-me-Modus für private Anwender ohne Pilotenschein nicht realisierbar sein dürfte.
Die hobbymäßig betriebenen ULFZ fallen somit in aller Regel in die Klasse 1 gemäß § 24f LFG.
Die Einsatzgebiete I bis IV | Im nächsten Schritt möchte ich kurz darlegen, welche Merkmale für die Einsatzgebiete I bis IV gelten.
Das Einsatzgebiet I (unbebautes Gebiet) eines ULFZ erlaubt den Flug ausschließlich über unbebautem Gebiet, also Flächen, auf denen sich keine Gebäude befinden. Außerdem dürfen sich außer dem Piloten des ULFZ und etwaigen weiteren Personen, die zum Zwecke des Fluges erforderlich sind, keine weiteren Personen in dem Gebiet aufhalten.
Das Einsatzgebiet II (unbesiedeltes Gebiet) ist dadurch kennzeichnet, dass es gänzlich unbesiedelt ist und allenfalls eine partielle Sekundärbebauung aufweist, wie beispielsweise landwirtschaftliche Lagerstätten, aber keine Wohnbebauung oder Gebäude, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht bewohnt werden und auch nicht bewohnt werden können (Gebäuderuinen etc.).
Im Einsatzgebiet III (besiedeltes Gebiet) sind Wohnhäuser, Versorgungsgebäude, Versammlungshäuser und gewerblich genutzte Bauwerke vorhanden, die auch als solche genutzt werden. Auch fallen Erholungs- und Freizeitgebiete hierunter.
Beim Einsatzgebiet IV (dicht besiedeltes Gebiet) handelt es sich um ein räumlich geschlossenes und besiedeltes Gebiet, etwa Städte und größere Gemeinden mit einem Ortskern.
Die Kategorien A bis D | Kennt man nun das Gewicht seines ULFZ, so kann man anhand von Tabelle 9.1 ablesen, in welche Kategorie das eigene ULFZ fällt. Nach der Kategorie richtet sich die Strenge der Auflagen und Voraussetzungen für die Bewilligungserteilung.
| Einsatzgebiet | ||||
|---|---|---|---|---|
|
I unbebaut |
II unbesiedelt |
III besiedelt |
IV dicht besiedelt |
|
| Betriebsmasse bis einschließlich 5 kg | A | A | B | C |
| Betriebsmasse bis einschließlich 25 kg | A | B | C | D |
| Betriebsmasse über 25 kg und bis einschließlich 150 kg | B | C | D | D |
Tabelle 9.1 Einsatzgebiet und Gewicht ergeben die Bewilligungskategorie. (Quelle: Austro Control, www.austrocontrol.at)
Wiegt beispielsweise das eigene ULFZ 8 kg und soll es in unbesiedeltem Gebiet betrieben werden, handelt es sich um ein ULFZ der Kategorie B, und es ist ein Antrag für diese Kategorie bei der AC zu stellen. Möchte man dagegen mit dem gleichen ULFZ über besiedeltes oder gar dicht besiedeltes Gebiet fliegen, benötigt man eine Erlaubnis der Klasse C oder D. Für diese beiden Kategorien ist jedoch entweder eine Pilotenlizenz erforderlich, oder es müssen luftfahrtrechtliche Kenntnisse durch eine bestandene Prüfung nachgewiesen werden, und in beiden Fällen muss zusätzlich ein medizinischer Flugtauglichkeitstest beigebracht werden. Eine solche Prüfung ist bei der AC abzulegen. Für die Klassen A und B ist eine Kenntnisprüfung nicht erforderlich. Entsprechende Bewilligungsanträge für die einzelnen Kategorien können im Übrigen von der Website der AC (www.austrocontrol.at) heruntergeladen werden.
Da ich davon ausgehe, dass die meisten von Ihnen über keine Fluglizenz verfügen und auch nicht die Kosten für die ansonsten notwendige strenge Prüfung der luftfahrtrechtlichen Kenntnisse durch die AC und für eine ebenfalls erforderlich medizinische Flugtauglichkeitsprüfung aufbringen werden oder möchten, beschränke ich mich nachfolgend auf die Voraussetzungen und Erfordernisse einer Bewilligung für die Kategorien A und B, wobei die jeweils höhere Kategorie immer die Anforderungen der vorherigen Kategorie, aber noch bestimmte zusätzliche Erfordernisse beinhaltet. Wer gleichwohl einen Antrag in den Kategorien C oder D stellen möchte, den verweise ich auf die Website der AC, wo Sie weitere Hinweise zum Prozedere und entsprechende Antragsformulare als PDF-Dateien finden.
In der Kategorie A sind erforderlich:
- technische Beschreibung des ULFZ und seiner Steuerung unter Beifügung von Fotos, auf denen alle Seiten des ULFZ zu sehen sind
- Deklaration der Betriebssicherheit
- Nachweis einer Haftpflichtversicherung
- Lichtbild des Piloten
In der Kategorie B sind zusätzlich erforderlich:
- Nachweis und Bestätigung der Übereinstimmung des ULFZ mit allen Bauvorschriften und Prüfdokumenten
- Lärmmessbericht
- Betriebssicherheitsanalyse nach Vorschriften der AC
- Deklaration der Befähigung des Piloten
Deklaration der Betriebssicherheit bei der Kategorie A bedeutet, dass der Pilot selbst zu bestätigen hat, dass sein ULFZ-Betrieb sicher ist, der Betrieb unter Beachtung aller luftfahrtbehördlichen Vorschriften ohne Gefährdung von Personen und Sachen erfolgt und dass ein Datenschild der AC am ULFZ angebracht ist. Bei der Deklaration der Befähigung des Piloten ist zusätzlich die Erklärung erforderlich, dass der Pilot die Steuerung des ULFZ beherrscht. Ein »Drohnen-Führerschein«, wie er in Deutschland in Kürze wohl eingeführt werden wird, ist nach den Bestimmungen in Österreich derzeit nicht vorgesehen.
[+] Austro Control
Weitergehende Hinweise finden Sie auf der Website der AC, die hier noch einmal genannt sei: www.austrocontrol.at.
Es empfiehlt sich dringend, ein ULFZ nicht ohne Einwilligung der AC aufsteigen zu lassen und nicht den Vorschriften des LFG zuwider zu handeln. Denn die Strafen, die für Verstöße gegen die Bewilligungsvorschriften und gegen das LFG verhängt werden können, reichen bis zu 22.000 €. Dabei ist es auch nicht erforderlich, dass die Behörden einen Vorgang zur Anzeige bringen. Anzeige kann in Österreich vielmehr jede Person erstatten, und es ist auch nicht erforderlich, dass der Pilot bei Rechtsverstößen in flagranti ertappt wird. Selbst das Posten einer entsprechenden Luftaufnahme in sozialen Medien gibt jedermann das Recht zur Anzeige, wenn er der Meinung ist oder den Verdacht hat, dass eine entsprechende Bewilligung nicht vorgelegen hat.
Weitere Einschränkungen beim Betrieb von ULFZ | Allein schon die Tatsache, dass man ohne entsprechende Pilotenlizenz sein ULFZ nur in bestimmten Einsatzgebieten nutzen darf, schränkt den Betrieb solcher Fluggeräte und damit auch den Freizeitspaß nicht unerheblich ein. So ist es beispielsweise ohne Flugschein nicht zulässig, über Gebäude zu fliegen. Der Hobbypilot, der gerne ein Wahrzeichen des Landes aus der Luft mit einem ULFZ filmen oder fotografieren möchte, wird hierauf verzichten müssen, während dies – wie Sie im Zusammenhang mit den Betriebsverboten gesehen haben – in Deutschland so strikt nicht verboten ist. Ebenso wird auch in Österreich derjenige, der die Absicht hat, über Menschenansammlungen, d. h. über Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, aber auch über den nahe gelegenen Freizeit- oder Erholungspark zu fliegen, enttäuscht sein.
Allerdings konnte ich nirgendwo einen Hinweis finden, ab wie vielen Personen man in Österreich von einer Menschenansammlung auszugehen hat. In Foren im Internet wird diese Frage auch gestellt, aber nicht beantwortet. Angesichts der hohen Geldstrafen, die in Österreich bei einem Verstoß drohen, empfehle ich, einen Überflug über mehrere Menschen, die irgendwo zusammenstehen, ohne entsprechende Genehmigung zu unterlassen.
Wie in Deutschland gibt es auch in Österreich eine Reihe von Bestimmungen außerhalb des LFG, die bei einem bewilligten Flug zu beachten sind und die bei Hobbypiloten nicht gerade Begeisterung auslösen dürften:
Die von der AC erteilten Bewilligungen sind bei der Ersterteilung lediglich ein Jahr gültig. Danach können Folgelizenzen erteilt werden, die auf zwei Jahre befristet sind. Dies bedeutet natürlich, dass nach ein, respektive zwei Jahren wieder erhebliche Kosten auf den Hobbypiloten zukommen.
Ärgerlich für einen Hobbypiloten ist auch, dass gerade dann, wenn er in der Regel Zeit hat, seinem Hobby nachzugehen, von ihm weitere Einschränkungen zu beachten sind. Denn die Einwilligungen der AC werden werktags für die Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr, frühestens jedoch ab Sonnenaufgang bis spätestens Sonnenuntergang und samstags lediglich bis 14:00 Uhr erteilt. An Sonntagen darf überhaupt nicht geflogen werden.
Außerdem sind natürlich auch in Österreich datenschutzrechtliche Vorschriften zu beachten. Bei allen Foto- und Videoaufnahmen, die mit ULFZ gemacht werden, ist zum Schutz der Persönlichkeitsrechte Dritter eine Meldung an die Datenschutzkommission verpflichtend. Es ist auch ausdrücklich verboten, Luftaufnahmen, auf denen Dritte zu sehen sind, zu veröffentlichen. Solche Fotos sind lediglich für den Privatgebrauch, also ohne damit an die Öffentlichkeit zu treten, zulässig. Lediglich in den Fällen, in denen mit dem ULZF keine Bilder oder Filme aufgezeichnet und veröffentlicht werden, ist dies unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten nicht gesondert genehmigungspflichtig. Der Betrieb eines ULFZ über einer Menschenansammlung ist im Übrigen grundsätzlich nicht ohne Bewilligung der AC zulässig. Es ist vielmehr eine gesonderte Bewilligung einzuholen, die jedoch sehr zurückhaltend und nur im Ausnahmefall erteilt wird.
Das Bestehen einer Haftpflichtversicherung ist bei den Kategorien A und B bereits eine der Voraussetzungen für die Erteilung einer luftverkehrsrechtlichen Bewilligung. Jedoch auch in all den Fällen, in denen keine Bewilligung erforderlich ist, also bei Spielzeugen und Flugmodellen bis 25 kg, jeweils ohne Kamera, empfiehlt es sich, eine entsprechende Haftpflichtversicherung abzuschließen, die von Flugobjekten verursachte Schäden abdeckt. Auch mit diesen Fluggeräten können durchaus Unfälle passieren und Schäden verursacht werden, für die der Betreiber auch in Österreich grundsätzlich haftbar ist. Mit einer entsprechenden Haftpflichtversicherung lässt sich das Hobby deshalb ganz sicher sorgenfreier betreiben. Nach meinen Recherchen im Internet werden Versicherungen in Österreich ab einer Jahresprämie von ca. 60 € angeboten. Näheres sollten Sie persönlich bei den in Betracht kommenden Versicherungsgesellschaften in Erfahrung bringen.
Fazit | Wie eingangs des Abschnitts erwähnt, gelten in Österreich derzeit mit Abstand die strengsten Vorschriften für unbemannte Luftfahrzeuge in Europa. Einerseits sind die Vertreter von Regierung und Flugsicherung, wie man Berichten und Interviews im Internet entnehmen kann, mit einem gewissen Stolz erfüllt, Vorreiter einer sehr strikten Flugregelung für unbemannte Luftfahrzeuge zu sein. Andererseits führen die gesetzlichen Regelungen, das strenge Bewilligungsverfahren und die zeitlichen Begrenzungen, insbesondere am Wochenende, für die Hobbyflieger zu sehr großen Einschränkungen ihres Hobbys. Diese könnten nach meiner persönlichen Einschätzung durchaus dazu führen, dass viele doch entweder den Spaß am Hobby verlieren oder sich das Hobby aufgrund der hohen und regelmäßig wiederkehrenden Bewilligungskosten im Ein- bzw. Zweijahresrhythmus nicht mehr leisten können oder wollen.